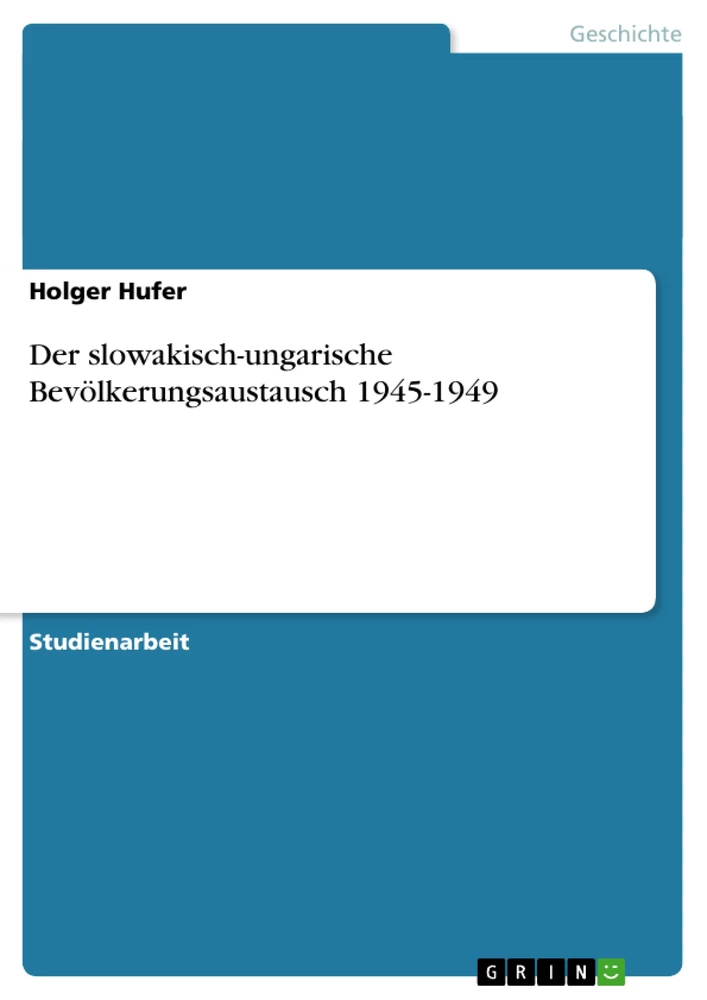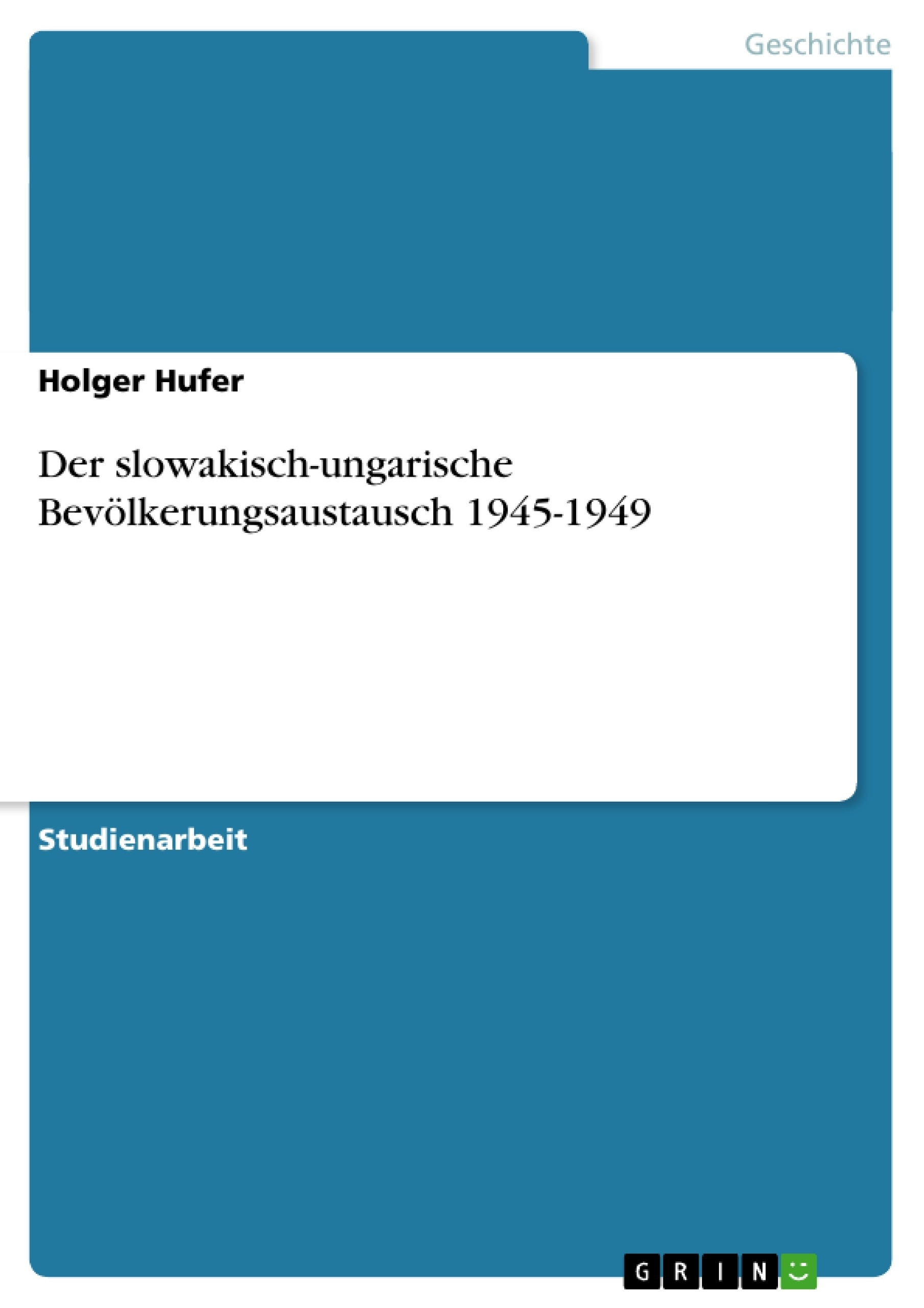Die Arbeit thematisiert als zentralen Aspekt den slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausch, der sich hauptsächlich zwischen 1945 und 1949 vollzog; im Mittelpunkt genauerer Untersuchungen sollen dabei die Wurzeln des Konflikts der beiden Ethnien stehen, die in einem Rückblick auf die Geschichte des Verhältnisses der Tschechoslowakei zu seiner ungarischen Minderheit von 1918 an behandelt werden. Konkrete Gründe für die Konfliktverschärfung sollen ebenso wenig außer Acht gelassen werden wie der letztliche Ablauf des „Bevölkerungsaustausches“ im Kontext des Grades seiner Grausamkeitsdimension bzw. quantitativer Aspekte dieses Vertreibungsaktes. Abschließend sollen die unmittelbaren Folgen für das weitere Zusammenleben der beiden Ethnien wie das Verhältnis ihrer beider Staaten zueinander in der Folgezeit beleuchtet werden.
Bevölkerungsverschiebungen im 20. Jahrhundert, und gemeint sind damit in erster Linie durch Gewalt heraufbeschworene oder erzwungene, weisen in der Regel eine Reihe gemeinsamer Merkmale auf: so wird der Austausch zum einen von den siegreichen Staaten organisiert und findet seine Begründung in einer vermeintlichen Notwendigkeit, zukünftigen Nationalitätenkonflikten durch die Herbeiführung ethnisch homogener Territorien vorzubeugen. Der Bevölkerungstausch bzw. die Vertreibung – bereits der Terminus impliziert es – beruht auf einer Zwangsmaßnahme des Staates gegenüber seinen (ehemaligen) Bürgern. Der Akt der Vertreibung vollzieht sich während eines Krieges oder in unmittelbarer zeitlicher Nähe. Begründet werden die Vertreibungsaktionen nahezu homophon mit mangelnder Loyalität der betroffenen Minderheit gegenüber dem Staat bzw. im schlimmsten Falle mit dem Vorwurf der Kollaboration mit dem äußeren Feind. Ziel dieser Arbeit ist es, den slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausch auch auf diese vermeintlich typischen Merkmale einer Vertreibung im 20. Jahrhundert hin zu beleuchten.
Zur Literatur bzw. hinsichtlich der aktuellen Forschungslage ist zu vermerken, dass naturgemäß viele Historiker, die sich der Thematik angenommen haben, selbst den betroffenen Ethnien angehören. Ein gewisses Maß an Schönfärbung des historischen Agierens der eigenen Volksgruppe mag zwar menschlich nachvollziehbar sein, in der historischen Beurteilung muss sie hingegen unterbleiben, weswegen die Bemühungen meinerseits dahin tendieren Sekundärliteratur und deren historischen Realitätsgehalt möglichst durch die Zuhilfenahme eines weiteren Autors ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Diskriminierungsmaßnahmen der Prager Regierung gegenüber der magyarischen Bevölkerung bis zum Ersten Wiener Schiedsspruch 1938
- Das Ende der Ersten Tschechoslowakischen Republik und die Machtansprüche Ungarns
- Beneš und die Idee des ethnisch homogenen Staates
- Die Budapester Reaktion im Kontext zunehmender Schikanierungen der Volksungarn
- Das bilaterale Abkommen über den Bevölkerungsaustausch 1946
- Von der Pariser Friedenskonferenz bis zur geregelten Wiederaufnahme des Austausches 1947
- Harte Jahre – Ungarn im Zeichen der Aufnahme seiner Neubürger
- Der Wandel der Beziehungen der Prager Regierung zu seiner magyarischen Minderheit seit 1949
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausch von 1945 bis 1949. Im Mittelpunkt steht die Analyse der historischen Wurzeln des Konflikts zwischen beiden Ethnien, beginnend mit dem Verhältnis der Tschechoslowakei zu ihrer ungarischen Minderheit ab 1918. Die Arbeit beleuchtet konkrete Konfliktverschärfungen, den Ablauf des Bevölkerungsaustausches inklusive seiner grausamen Dimensionen und quantitativen Aspekte. Abschließend werden die unmittelbaren Folgen für das Zusammenleben beider Ethnien und das Verhältnis ihrer Staaten untersucht.
- Die Diskriminierung der ungarischen Minderheit in der Tschechoslowakei
- Die Ursachen und der Verlauf des Bevölkerungsaustausches
- Die Rolle der politischen Akteure (Beneš, etc.)
- Quantitative Aspekte des Bevölkerungsaustausches
- Langfristige Folgen für die Beziehungen zwischen Slowakei und Ungarn
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert den slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausch (1945-1949), untersucht dessen historische Ursachen im Verhältnis der Tschechoslowakei zu ihrer ungarischen Minderheit seit 1918 und beleuchtet den Ablauf des Austausches, seine Grausamkeit und quantitative Aspekte sowie die langfristigen Folgen für die Beziehungen zwischen beiden Ethnien und Staaten. Der Fokus liegt auf der Beleuchtung der vermeintlich typischen Merkmale einer Vertreibung im 20. Jahrhundert.
Die Diskriminierungsmaßnahmen der Prager Regierung gegenüber der magyarischen Bevölkerung bis zum Ersten Wiener Schiedsspruch 1938: Trotz der verfassungsmäßig garantierten Gleichberechtigung aller Staatsbürger wurde die ungarische Minderheit in der Tschechoslowakei diskriminiert. Die Prager Regierung untergrub die Gleichberechtigung, indem sie zentrale Punkte der Vereinbarung über die Rechte nationaler Minderheiten nicht umsetzte. Dies betraf den Aufbau und Betrieb von Schulen und sozialen Einrichtungen, sowie deren finanzielle Unterstützung. Die Maßnahmen umfassten die Entlassung ungarischer Staatsbediensteter und die Verweigerung der Staatsbürgerschaft für Tausende. Trotzdem blieb eine starke ungarische Minderheit entlang der Südgrenze bestehen.
Schlüsselwörter
Slowakisch-ungarischer Bevölkerungsaustausch, Vertreibung, ethnische Minderheiten, Tschechoslowakei, Ungarn, Diskriminierung, Nationalitätenkonflikt, Trianon, Beneš, ethnische Homogenität, Volksgruppen, Minderheitenrechte.
Häufig gestellte Fragen zum slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausch (1945-1949)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht den slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausch zwischen 1945 und 1949. Sie analysiert die historischen Wurzeln des Konflikts zwischen den beiden Ethnien, beginnend mit dem Verhältnis der Tschechoslowakei zu ihrer ungarischen Minderheit ab 1918. Die Arbeit beleuchtet konkrete Konfliktverschärfungen, den Ablauf des Bevölkerungsaustausches inklusive seiner grausamen Dimensionen und quantitativen Aspekte. Abschließend werden die unmittelbaren Folgen für das Zusammenleben beider Ethnien und das Verhältnis ihrer Staaten untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Diskriminierung der ungarischen Minderheit in der Tschechoslowakei, die Ursachen und den Verlauf des Bevölkerungsaustausches, die Rolle politischer Akteure (wie Beneš), quantitative Aspekte des Austausches und die langfristigen Folgen für die Beziehungen zwischen der Slowakei und Ungarn.
Wie wird die Diskriminierung der ungarischen Minderheit dargestellt?
Die Arbeit beschreibt, wie trotz verfassungsmäßig garantierter Gleichberechtigung die ungarische Minderheit in der Tschechoslowakei diskriminiert wurde. Die Prager Regierung untergrub die Gleichberechtigung durch Nichtumsetzung zentraler Punkte der Vereinbarung über die Rechte nationaler Minderheiten, was sich in Bereichen wie Bildung, soziale Einrichtungen und Staatsbürgerschaft manifestierte.
Welche Rolle spielte Edvard Beneš?
Die Rolle von Edvard Beneš und anderer politischer Akteure im Kontext des Konflikts und des Bevölkerungsaustausches wird in der Arbeit beleuchtet. Die genaue Ausarbeitung seiner Rolle ist jedoch nicht im Preview ersichtlich.
Welche quantitativen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beinhaltet eine Betrachtung der quantitativen Aspekte des Bevölkerungsaustausches, die genaue Darstellung der Daten ist jedoch im Preview nicht detailliert aufgeführt.
Welche langfristigen Folgen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die langfristigen Folgen des Bevölkerungsaustausches für das Zusammenleben der beiden Ethnien und das Verhältnis zwischen der Slowakei und Ungarn.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Diskriminierungsmaßnahmen der Prager Regierung, Ende der Ersten Tschechoslowakischen Republik und ungarische Machtansprüche, Beneš und die Idee des ethnisch homogenen Staates, Budapester Reaktion, bilaterales Abkommen über den Bevölkerungsaustausch, Pariser Friedenskonferenz und Wiederaufnahme des Austausches, die Aufnahme der Neubürger in Ungarn, den Wandel der Beziehungen seit 1949 und eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Slowakisch-ungarischer Bevölkerungsaustausch, Vertreibung, ethnische Minderheiten, Tschechoslowakei, Ungarn, Diskriminierung, Nationalitätenkonflikt, Trianon, Beneš, ethnische Homogenität, Volksgruppen und Minderheitenrechte.
- Quote paper
- Holger Hufer (Author), 2005, Der slowakisch-ungarische Bevölkerungsaustausch 1945-1949, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76588