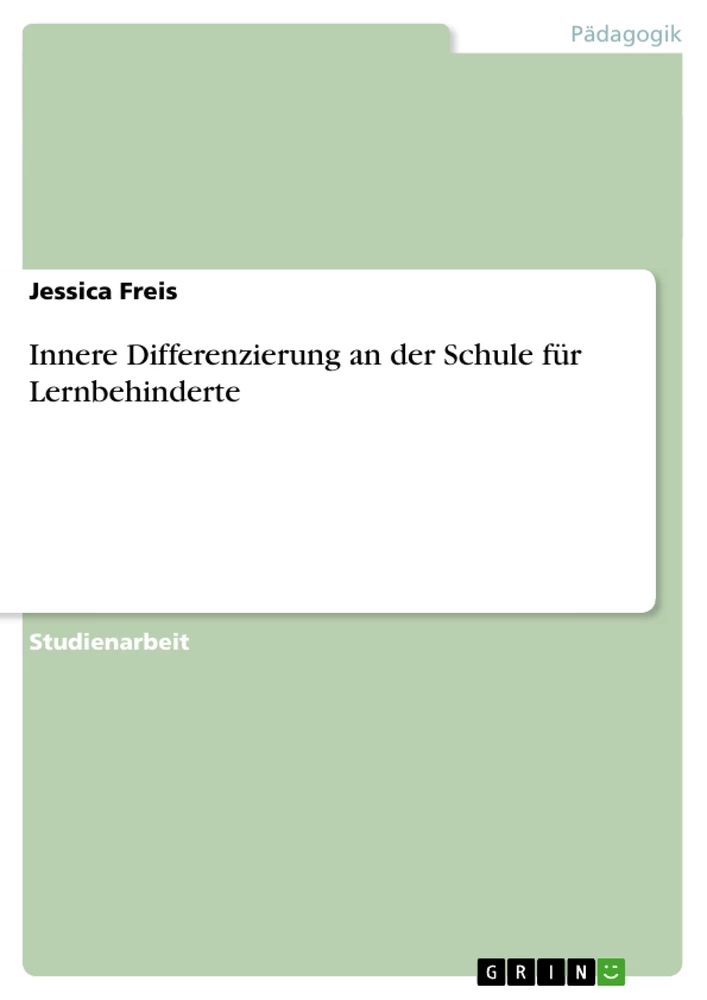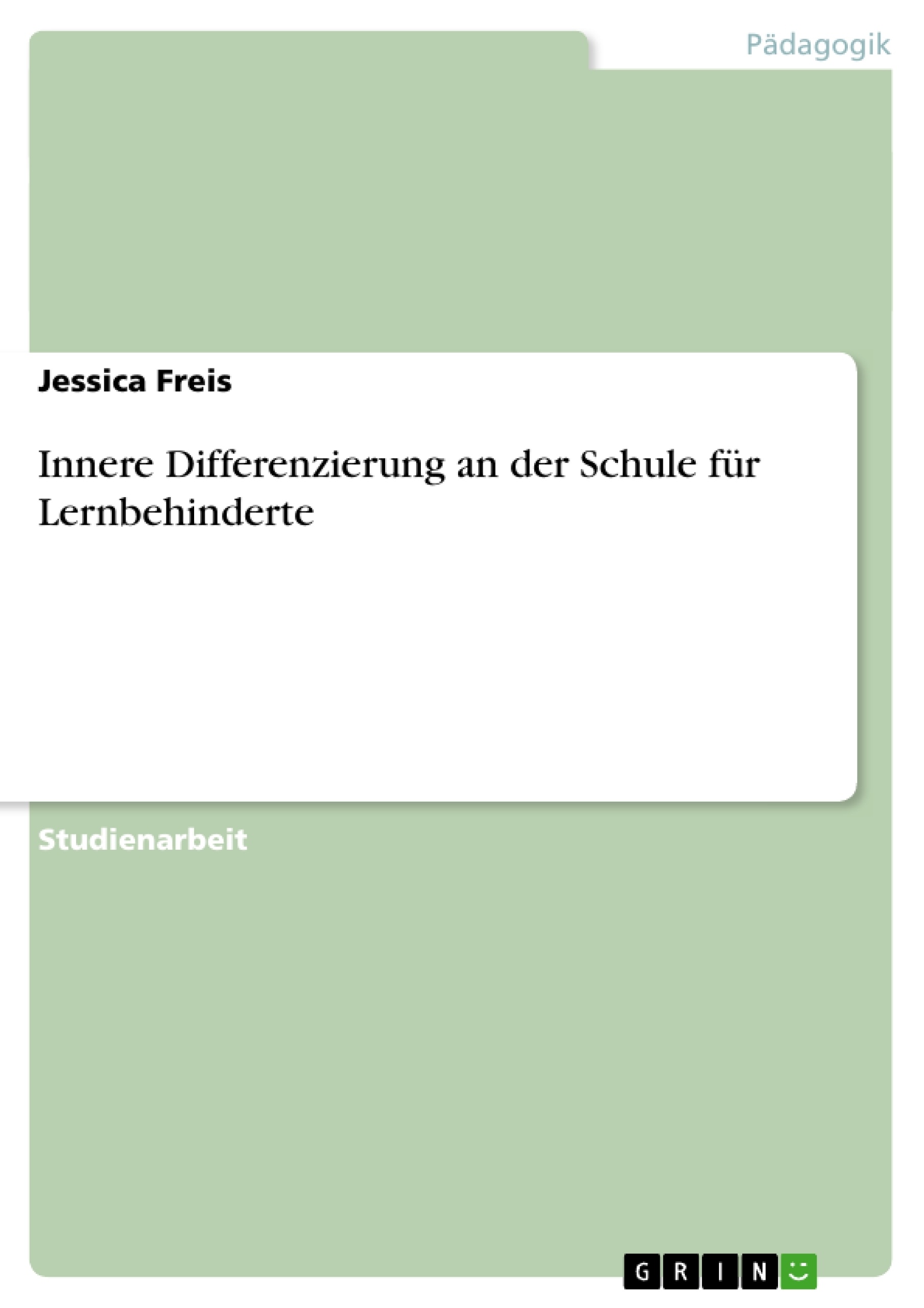Aufgrund der großen Heterogenität der Lebens- und Entwicklungsbedingungen gibt es auch große Unterschieden der Lernvoraussetzungen - auch bei Kindern gleichen Alters differieren Interessen, Fähigkeiten, Kenntnisse, Sozialisationserfahrungen etc. Homogenität ist also selbst bei Kindern gleichen Alters eine Utopie. Eine allen S. gemeinsame geltende Lernsituation führt nach einiger Zeit zu Über-/Unterforderung, da sie keinem Kind gerecht werden kann. Moderner Unterricht muss sich deshalb Heterogenität annehmen und sich nach unterschiedlichen Lerntypen ausrichten. Insbesondere lernschwächere S. profitieren von heretogenen Lerngruppen, da sie von leistungsstärkeren S. Impuse zur Entwicklung und Unterstützung erhalten (vgl. Modellernen (Bandura)). Zusätzlich wird in heterogenen Gruppen Etikettierung vermieden, was im Hinblick auf lernschwache S. wichtig für die uneingeschränkte Persönlichkeitsentwicklung ist.
Das Bestreben der Differenzierung ist, Unterricht an den unterschiedlichen Lernausgangslagen (Sozialisation, Entwicklung, Begabungen, Interessen, Bedürfnisse, Lernfähigkeit) der S. zu orientieren, um eine weitgehende Individualisierung zu erreichen, ohne jedoch das soziale Lernen auszuschließen.
Zu Beginn dieser Klausur werde ich die Begriffe Differenzierung, ÄD und ID klären. Dann gehe ich vertiefend auf die ID, ihre Ziele, Inhalte, Kennzeichen und Formen ein. Das Modell von Klafki und Stöcker bildet dabei den zentralen Ansatz. Für die Umsetzung an der Schule für Lernbehinderte beschreibe ich kurz mögliche Unterrichtsformen und gehe exemplarisch auf das Stationenlernen näher ein. Abschließend zeige ich kritisch Chancen und Probleme der ID für den Unterricht mit lernbehinderten S. auf.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Differenzierung
- Äußere Differenzierung
- Innere Differenzierung/ Binnendifferenzierung
- Ziele und Merkmale ID
- Ziele Innerer Differenzierung
- Merkmale und Bedingungen Innerer Differenzierung
- Das Dimensionen- und Kriterienschema zur Innerer Differenzierung
- Innere Differenzierung an der Schule für Lernbehinderte
- Der Personenkreis
- Prinzipien des Unterrichts
- Innere Differenzierung und Unterrichtsformen
- Formen Offenen Unterrichts
- Sozialformen
- Voraussetzungen
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Inneren Differenzierung (ID) im Kontext der Schule für Lernbehinderte. Es wird eine umfassende Klärung des Begriffs der Differenzierung, insbesondere der ID, mit ihren Zielen, Merkmalen und Bedingungen gegeben. Der Fokus liegt auf dem Dimensionen- und Kriterienschema von Klafki und Stöcker sowie der Anwendung und Bedeutung von ID in der Praxis an der Schule für Lernbehinderte.
- Begriffliche Klärung von Differenzierung, äußerer Differenzierung und innerer Differenzierung
- Analyse der Ziele und Merkmale von ID
- Anwendung des Dimensionen- und Kriterienschemas von Klafki und Stöcker
- Bedeutung von ID im Kontext der Schule für Lernbehinderte
- Untersuchung möglicher Unterrichtsformen und ihrer Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Thema der Inneren Differenzierung, indem sie die Notwendigkeit und den Stellenwert der ID im schulischen Kontext hervorhebt. Die Begriffsklärung des 3. Kapitels differenziert zwischen verschiedenen Arten der Differenzierung, insbesondere der inneren Differenzierung, und erklärt ihre Bedeutung für das individualisierte Lernen. Kapitel 4 beschreibt die Ziele und Merkmale der ID, während Kapitel 5 das Dimensionen- und Kriterienschema von Klafki und Stöcker zur Anwendung und Analyse von ID darstellt. Kapitel 6 widmet sich der konkreten Umsetzung von ID an der Schule für Lernbehinderte, einschließlich des Personenkreises und der Prinzipien des Unterrichts. Im Kapitel 7 werden die Auswirkungen von ID auf verschiedene Unterrichtsformen und Sozialformen analysiert. Das Kapitel 8 befasst sich mit den Voraussetzungen für die erfolgreiche Anwendung von ID.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf das Thema der Inneren Differenzierung, insbesondere im Kontext der Schule für Lernbehinderte. Zentrale Schlüsselwörter sind Differenzierung, Äußere Differenzierung, Innere Differenzierung, Binnendifferenzierung, Lernvoraussetzungen, Lernziele, Unterrichtsformen, Sozialformen, Dimensionen- und Kriterienschema, Klafki und Stöcker.
- Citation du texte
- Jessica Freis (Auteur), 2002, Innere Differenzierung an der Schule für Lernbehinderte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7651