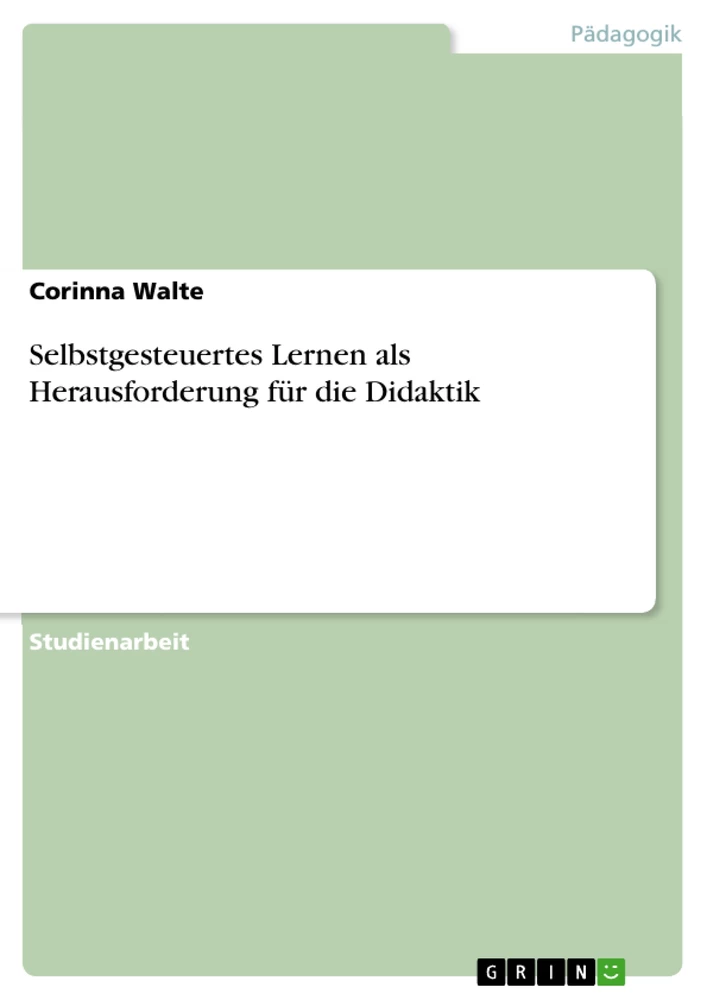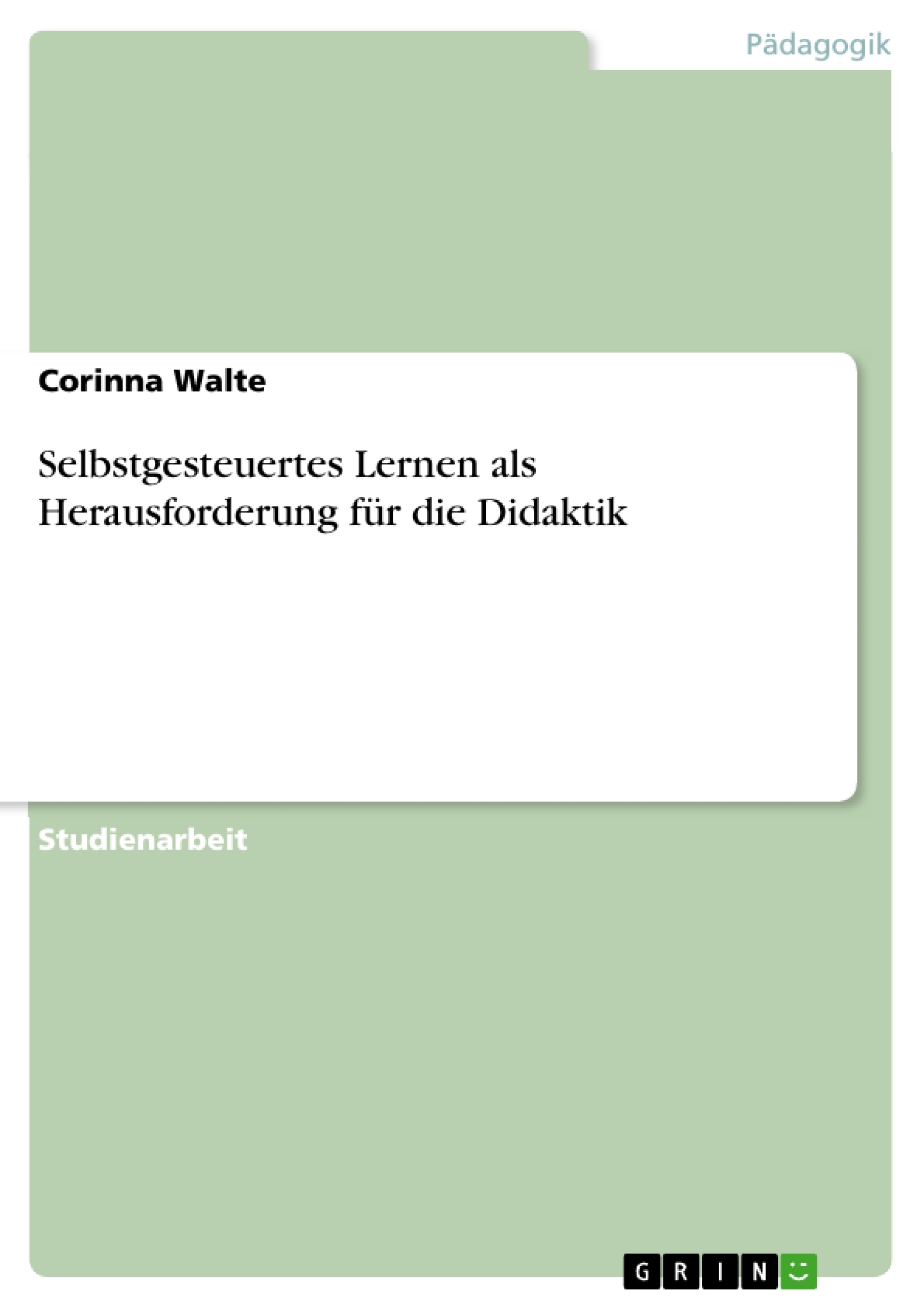Der Begriff des Selbstständigen Lernens mit seinen Differenzierungen nimmt gegenwärtig in den Diskursen der Schulpädagogik, der Erwachsenenbildung und der pädagogischen Psychologie einen großen Stellenwert ein und somit ist selbstgesteuertes und selbstständiges Lernen – nicht nur unter den Didaktikern – ein aktuelles Thema, was nicht zuletzt an PISA liegt.
PISA machte deutlich, dass es den deutschen Schülern an bedeutenden Kompetenzen fehlt. Kompetenzen die - wie in der folgenden Arbeit deutlich wird - durch selbstgesteuertes Lernen vermittelt werden können.
Ein zentrales schulpädagogisches und zugleich gesellschaftspolitisches Problem ist das Erreichen des Ziels von Schule und Unterricht, die Schüler auf ein lebenslanges Lernen vorzubereiten, dass in der heutigen Wissensgesellschaft unerlässlich ist.
Schüler sollten sich in aktiver Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten zunehmend diejenigen Fähigkeiten aneignen, die benötigt werden, um auch über die Schulzeit hinaus selbstständig und eigenverantwortlich weiterlernen zu können.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich eine zentrale Frage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema selbstständiges und selbstgesteuertes Lernen:
Wie kann Unterricht methodisch so gestaltet werden, dass in ihm den Schülern einerseits eine zunehmend eigenständige Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten ermöglicht wird und andererseits gleichzeitig diejenigen Fähigkeiten entwickelt, gefördert und aufgebaut werden, die zur selbstständigen Gestaltung von Lernprozessen auch über die Schulzeit hinaus benötigt werden?
Im Folgenden werde ich bedeutende Begrifflichkeiten klären und differenzieren sowie auf zentrale Merkmale des selbstgesteuerten Lernens eingehen, um im Anschluss daran mit der Fragestellung arbeiten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Thema
- Begriffsbestimmung und -differenzierung
- Wichtige Gründe für selbstständiges Lernen
- Zentrale Merkmale selbstgesteuerten Lernens
- Voraussetzungen selbstorganisierten und selbstgesteuerten Lernens
- Starke und offene Lernumgebungen
- Frontalunterricht vs. selbstgesteuertes Lernen
- Wege zum Aufbau von Selbststeuerungsfähigkeiten und ihre Förderung
- Stadienmodell nach Grow
- Prozessorientiertes Lernen nach Simons
- Beispielmethoden des selbstgesteuerten Lernens
- Möglichkeiten des selbstständigen und selbstgesteuerten Lernens
- Grenzen des selbstständigen und selbstgesteuerten Lernens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht selbstgesteuertes Lernen als Herausforderung für die Didaktik. Das Ziel ist, die zentralen Merkmale, Voraussetzungen und Möglichkeiten, aber auch die Grenzen selbstgesteuerten Lernens zu beleuchten und didaktische Implikationen aufzuzeigen. Die Arbeit klärt zudem wichtige Begrifflichkeiten und differenziert zwischen verschiedenen Formen des selbstbestimmten Lernens.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung selbstgesteuerten Lernens
- Voraussetzungen für erfolgreiches selbstgesteuertes Lernen
- Methoden und Möglichkeiten der Förderung von Selbststeuerungsfähigkeiten
- Didaktische Herausforderungen und Grenzen selbstgesteuerten Lernens
- Potenzial von selbstgesteuertem Lernen für lebenslanges Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in das Thema: Die Einführung stellt selbstgesteuertes Lernen als ein aktuelles und wichtiges Thema in der Pädagogik dar, insbesondere im Kontext von PISA-Studien, die Defizite bei deutschen Schülern aufzeigen. Es wird die zentrale Frage nach der methodischen Gestaltung von Unterricht formuliert, um Schülern sowohl eigenständige Auseinandersetzung mit Lerninhalten als auch die Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten für lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Die Arbeit kündigt die Klärung wichtiger Begriffe und die Analyse zentraler Merkmale selbstgesteuerten Lernens an.
Begriffsbestimmung und -differenzierung: Dieses Kapitel beleuchtet die uneinheitliche Definition von selbstgesteuertem Lernen in der pädagogischen Psychologie und differenziert es von verwandten Begriffen wie selbstorganisiertem, selbstreguliertem und selbstbestimmtem Lernen. Es wird eine allgemein akzeptierte Definition vorgestellt und die Bedeutung von Selbststeuerung im Lernprozess hervorgehoben. Der Unterschied zwischen „absoluter Autonomie“ und „vollständiger Fremdsteuerung“ wird diskutiert, wobei selbstgesteuertes Lernen als ein Spektrum zwischen diesen Polen verstanden wird. Der enge Zusammenhang zwischen selbstgesteuertem und selbstbestimmtem Lernen wird betont, sowie Unterschiede bezüglich der Kontrolle über Lerninhalte und -ziele herausgearbeitet. Die Situation in der Schule und in der Erwachsenenbildung wird verglichen, wobei in der Schule oft ein fremdbestimmtes Lernen vorherrscht.
Schlüsselwörter
Selbstgesteuertes Lernen, Selbstbestimmtes Lernen, Selbstorganisiertes Lernen, Selbstreguliertes Lernen, Didaktik, Lebenslanges Lernen, Lernmethoden, Selbststeuerungsfähigkeiten, Unterrichtsgestaltung, PISA.
Häufig gestellte Fragen zu: Selbstgesteuertes Lernen - Eine didaktische Betrachtung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert selbstgesteuertes Lernen aus didaktischer Perspektive. Sie beleuchtet zentrale Merkmale, Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen dieses Lernansatzes und zeigt didaktische Implikationen auf. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung und Differenzierung relevanter Begrifflichkeiten im Kontext selbstbestimmten Lernens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einführung in das Thema, eine detaillierte Begriffsbestimmung und -differenzierung (inkl. Abgrenzung zu verwandten Lernformen wie selbstorganisiertem und selbstbestimmtem Lernen), die Untersuchung wichtiger Voraussetzungen für erfolgreiches selbstgesteuertes Lernen, die Darstellung von Methoden und Möglichkeiten zur Förderung von Selbststeuerungsfähigkeiten, die Diskussion didaktischer Herausforderungen und Grenzen, sowie das Potenzial selbstgesteuerten Lernens für lebenslanges Lernen. Konkrete Beispiele für Methoden des selbstgesteuerten Lernens werden ebenfalls behandelt.
Welche Lernformen werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen selbstgesteuertem, selbstorganisiertem, selbstreguliertem und selbstbestimmtem Lernen. Sie betont den Unterschied zwischen „absoluter Autonomie“ und „vollständiger Fremdsteuerung“, wobei selbstgesteuertes Lernen als ein Spektrum zwischen diesen Polen verstanden wird. Der enge Zusammenhang zwischen selbstgesteuertem und selbstbestimmtem Lernen wird hervorgehoben, aber auch Unterschiede hinsichtlich der Kontrolle über Lerninhalte und -ziele herausgearbeitet.
Welche Voraussetzungen sind für erfolgreiches selbstgesteuertes Lernen notwendig?
Die Arbeit identifiziert und beschreibt die zentralen Voraussetzungen für erfolgreiches selbstgesteuertes Lernen. Diese werden im Detail im entsprechenden Kapitel behandelt.
Welche Methoden zur Förderung von Selbststeuerungsfähigkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Methoden und Möglichkeiten zur Förderung von Selbststeuerungsfähigkeiten. Genannt werden unter anderem das Stadienmodell nach Grow und das prozessorientierte Lernen nach Simons.
Welche didaktischen Herausforderungen und Grenzen werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert die didaktischen Herausforderungen und Grenzen selbstgesteuerten Lernens. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen selbstgesteuertem Lernen und Frontalunterricht und untersucht die Implikationen für die Unterrichtsgestaltung.
Welche Rolle spielt selbstgesteuertes Lernen im Kontext des lebenslangen Lernens?
Die Arbeit untersucht das Potenzial selbstgesteuerten Lernens für lebenslanges Lernen und dessen Bedeutung im Kontext von PISA-Studien, die Defizite bei deutschen Schülern aufzeigen.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Selbstgesteuertes Lernen, Selbstbestimmtes Lernen, Selbstorganisiertes Lernen, Selbstreguliertes Lernen, Didaktik, Lebenslanges Lernen, Lernmethoden, Selbststeuerungsfähigkeiten, Unterrichtsgestaltung, PISA.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Begriffsbestimmung und -differenzierung, Kapitel zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten selbstgesteuerten Lernens, ein Kapitel zu Methoden zur Förderung von Selbststeuerungsfähigkeiten, ein Kapitel zu den Grenzen des selbstgesteuerten Lernens und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis gibt einen detaillierten Überblick über die Kapitel und Unterkapitel.
- Quote paper
- Corinna Walte (Author), 2006, Selbstgesteuertes Lernen als Herausforderung für die Didaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76434