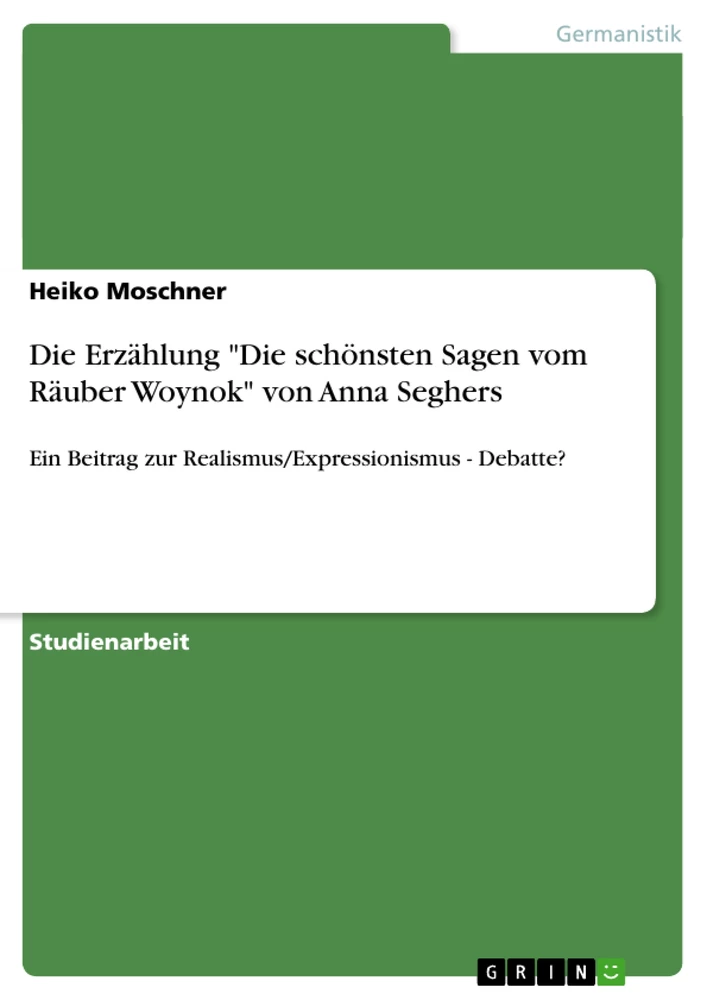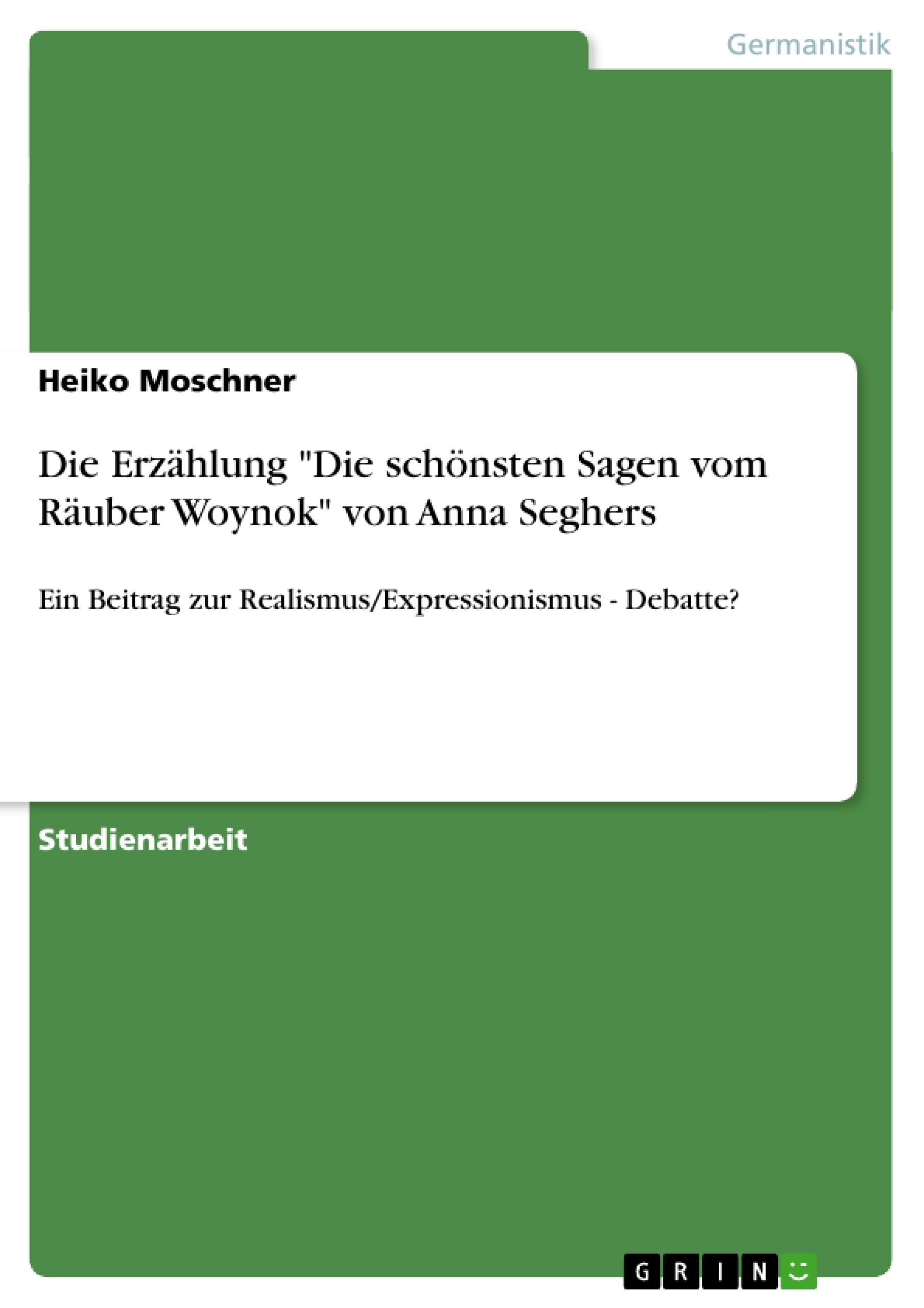Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland veranlasste Anna Seghers und viele andere antifaschistische Schriftsteller und Intellektuelle 1933 ins Ausland zu emigrieren. Im Ausland versuchten Schriftsteller wie Becher, Brecht und Seghers von Beginn an die intellektu-ellen Kräfte des Exils zu bündeln, gemeinsame Ziele zu definieren und Aktionen zu starten. Sie wollten so eine breite Koalition gegen Hitler schmieden, der nicht nur Kommunisten sondern auch andere antifaschistischen Kräfte angehören sollten. Sie entwickelten hier schon einen Gedanken für den kulturellen Bereich, wie er dann 1935 auf dem VII. Kongress der Komintern als Volksfrontgedanke zur politischen Losung im Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismus wurde. War man sich unter den antifaschistischen Schriftstellern einig, dass ihre Arbeiten Waffen im Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismus sein sollten, so gab es doch Diskussionen darüber, wie eine marxistische Kunst beschaffen sein müsse, um das zu leisten. Schon seit dem Ende der Weimarer Republik wanderten die Diskussionen linker Intellektueller um die Themen Erbe, Tradition und Realismus in der marxistischen Kunst. Eine dieser öffentlich geführten Dis-kussionen war die Realismus/Expressionismus - Debatte.
Die Debatte begann mit zwei Aufsätzen von Klaus Mann und Gottfried Kurella in der in Moskau erscheinenden volksfrontnahen Zeitschrift Das Wort im September 1937 und galt 1938 als beendet. Sie wurde vor allem zwischen Georg Lukács auf der einen Seite und Ernst Bloch, Bertolt Brecht sowie Anna Seghers auf der anderen Seite geführt. Es ging dabei vorrangig um die Definierung eines Realismusbegriffes und um die Methoden, mit der der Künstler die Wirklichkeit darzustellen habe. Im Speziellen wurde darüber diskutiert, in wie weit der Expressionismus bzw. Techniken des Expressionismus einen Platz in der marxistischen Kunst hätten.
In der Arbeit wird untersucht, inwieweit die 1936 entstandene und 1938 in der Zeitschrift "Das Wort" veröffentlichte Erzählung "Die schönsten Sagen vom Räuber Woynok" eine literarische Antwort auf die Debatte sein könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Realismus/Expressionismus – Debatte..
- 2.1 Die Sagen im Kontext von Seghers Exilwerk.
- 2.2 Handlung und Figuren………………...
- 2.3 Die Motive und das Mittel des Erzählens
- 2.4 Das Vorwort und die Kunstthematik...
- 3. Schluss: Die,Sagen' als Seghers Beitrag zur Debatte und ein Ausblick auf\nSpäteres.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Erzählung "Die schönsten Sagen vom Räuber Woynok" von Anna Seghers im Kontext der Realismus/Expressionismus-Debatte der 1930er Jahre. Der Autor untersucht, wie die Erzählung sich auf die Debatte bezieht und welche künstlerischen Mittel Seghers einsetzt.
- Die Realismus/Expressionismus-Debatte und ihre Bedeutung im Exil.
- Die Rolle von Märchen und Sagen im Werk von Seghers.
- Die künstlerischen Mittel der Erzählung, wie z.B. Montagetechnik und Simultantechnik.
- Die Verbindung von Realismus und Phantasie in Seghers’ Werk.
- Die „höchstmögliche Annäherung an die Realität“ als Ziel der Erzählkunst.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel behandelt die Realismus/Expressionismus-Debatte im Kontext der antifaschistischen Bewegung im Exil. Es wird auf die unterschiedlichen Positionen von Georg Lukács und Ernst Bloch eingegangen und die Rolle von Seghers in dieser Debatte erläutert.
- Die schönsten Sagen vom Räuber Woynok: Dieses Kapitel analysiert die Erzählung "Die schönsten Sagen vom Räuber Woynok" im Kontext des Exilwerks von Seghers. Es geht auf die Handlung, die Figuren und die verwendeten Motive ein.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter, die im Text eine wichtige Rolle spielen, sind: Realismus, Expressionismus, Exil, Seghers, "Die schönsten Sagen vom Räuber Woynok", Märchen, Sagen, Montagetechnik, Simultantechnik, Volksfront, Faschismus, Realität.
- Quote paper
- Heiko Moschner (Author), 2006, Die Erzählung "Die schönsten Sagen vom Räuber Woynok" von Anna Seghers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76357