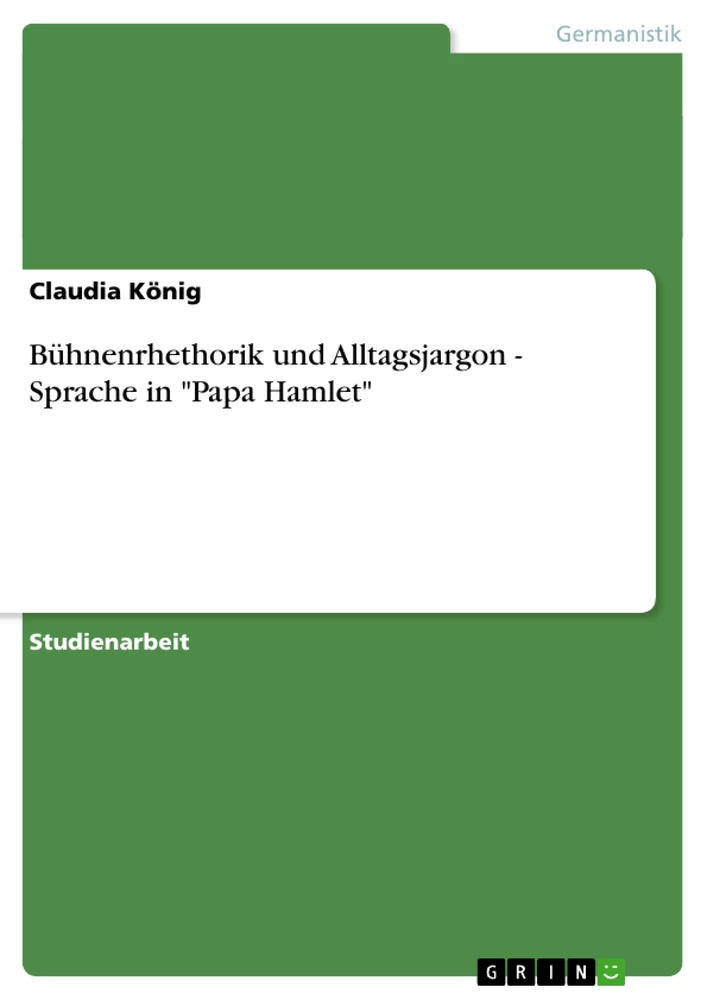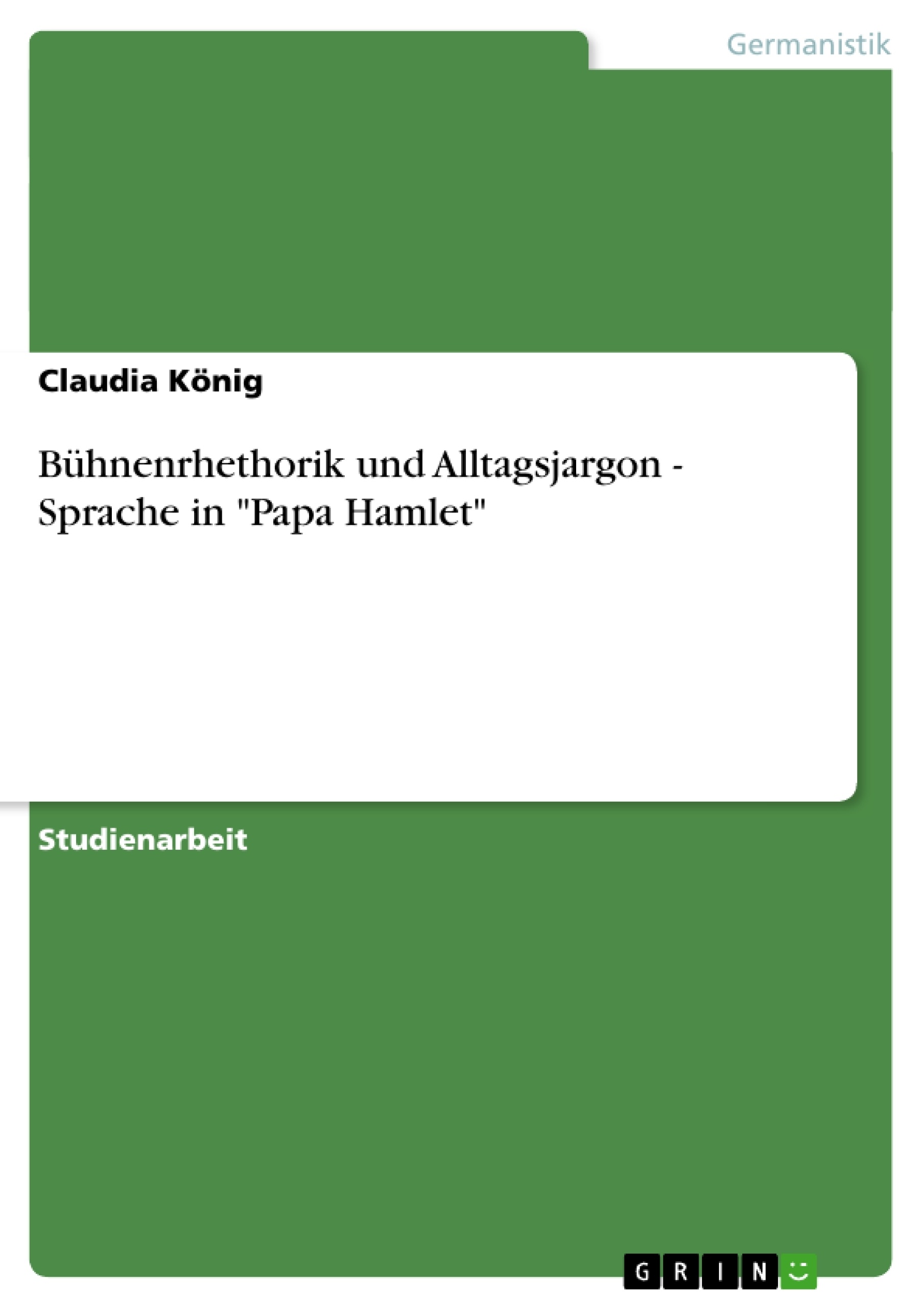„Die Kunst hat die Tendenz wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Massgabe ihrer jedweiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung“.
Mit diesem von Arno Holz so formulierten „Kunstgesetz“ ist die Auffassung, Sprache sei ein bloßes Reproduktionsmittel, das eine unverstellte Darstellung der Geschehnisse mehr hemmt als ihr förderlich zu sein, untrennbar verbunden. Für zeitgenössische Kritiker war dies wahrlich „schwere Kost“. Eine konsequente Umsetzung wurde anfangs aus stilistischen Prinzipien abgelehnt oder für unmöglich gehalten. 1889 legte Arno Holz in dem Werk Neue Gleise sieben, in Zusammenarbeit mit Johannes Schlaf entstandene, Prosaskizzen vor. Waren dies die Resultate einer ungebrochenen Umsetzung solcher Stilprinzipien? Schnell entbrannte darüber ein immenser Gelehrtenstreit.
Die dieser Interpretation zu Grunde liegende Skizze Papa Hamlet erregte dabei besonderes Aufsehen. Inhaltlich scheint sie mehr ein Verlegenheitswerk zu sein: Ein alternder, verarmter Schauspieler kann sich in der Realität nicht zurechtfinden, erschlägt im Affekt seinen Sohn und stirbt schließlich im Alkoholrausch. Auf sprachlicher Ebene aber etabliert Holz eine neue Darstellungsart, die, glaubt man seinen Kritikern, entweder den Weg in die Zukunft oder den in die Steinzeit weise.
Die vorliegende Arbeit soll vor dem Hintergrund dieser Wertungen die Funktionalität von Sprache in Papa Hamlet näher beleuchten. Erscheint sie tatsächlich nur als grobes Mittel Bild und Abbild zur vollständigen Deckung zu bringen, oder flechtet Holz vielleicht in der Art der „Reproduktion“ weitere Bedeutungsebenen mit ein?
Zur vollständigen Klärung dieser Frage werden zuerst die wörtliche Figurenrede und die Besonderheiten der Erzählersprache untersucht; besondere Berücksichtigung findet dabei die Sprache des verarmten Schauspielers Niels Thienwiebel. Hiernach sollen die im Vorangegangen festgestellten Phänomene auch auf den Berichtsstil der Gegenstands- und Naturdarstellungen übertragen werden. Den Abschluss der Betrachtungen wird ein kurzer Blick auf die sprachliche Ausformung des letzten Kapitels bilden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorwort
- II. Analyse der Einzelcharakteristika
- 1.) Die Alltagssprache - suggeriert sie wirklich Authentizität?
- 2.) Erzählen auf naturalistische Art eine kurze Vorbemerkung
- 3.) Die sprachliche Ausgestaltung der Berichtspassagen
- 5.) Die Beschreibung der Gegenstände und der Natur
- 6.) Die Sonderstellung des letzten Kapitels
- III. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Sprache in Arno Holz’ Skizze „Papa Hamlet“. Die zentrale Fragestellung lautet, ob die Sprache in der Skizze tatsächlich nur ein bloßes Reproduktionsmittel ist oder ob Holz in der Art der „Reproduktion“ weitere Bedeutungsebenen einflechtet.
- Analyse der Alltagssprache und deren Authentizität
- Untersuchung des naturalistischen Erzählstils und seiner Besonderheiten
- Bedeutung der sprachlichen Ausgestaltung der Berichtspassagen
- Analyse der Beschreibungen von Gegenständen und der Natur
- Untersuchung der Sonderstellung des letzten Kapitels
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Vorwort
Das Vorwort stellt das „Kunstgesetz“ von Arno Holz vor, das besagt, dass Sprache ein blosses Reproduktionsmittel ist. Es wird auf die Kritik an dieser Auffassung eingegangen und die Skizze „Papa Hamlet“ als Beispiel für eine konsequente Umsetzung der naturalistischen Prinzipien vorgestellt.
- Kapitel II: Analyse der Einzelcharakteristika
- 1.) Die Alltagssprache - suggeriert sie wirklich Authentizität?
In diesem Kapitel wird die Verwendung von graphostilistischen Mitteln, Hesitationsfülseln und Jargonwendungen in der Skizze „Papa Hamlet“ untersucht. Es wird gezeigt, wie diese Elemente die Alltagssprache imitieren und zu einer Zerstörung der logisch-syntaktischen Einheit führen. Darüber hinaus werden einzelne Laute, Silben und Wörter akzentuiert, und Satzteile sprengen den normativen Rahmen von Syntax und Grammatik.
- 2.) Erzählen auf naturalistische Art - eine kurze Vorbemerkung
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderung für den naturalistischen Erzähler, der als bloßer Berichterstatter fungiert. Die Schwierigkeit liegt darin, dass alles, was nicht perzeptiv erfassbar ist, ausserhalb seines Bereichs liegt.
- 1.) Die Alltagssprache - suggeriert sie wirklich Authentizität?
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Naturalismus, Sprache, Alltagssprache, Authentizität, Reproduktion, Arno Holz, Papa Hamlet, Erzählstil, Sprachliche Ausgestaltung, Jargon, Hesitationsfülsel.
- Quote paper
- Claudia König (Author), 2007, Bühnenrhethorik und Alltagsjargon - Sprache in "Papa Hamlet", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76274