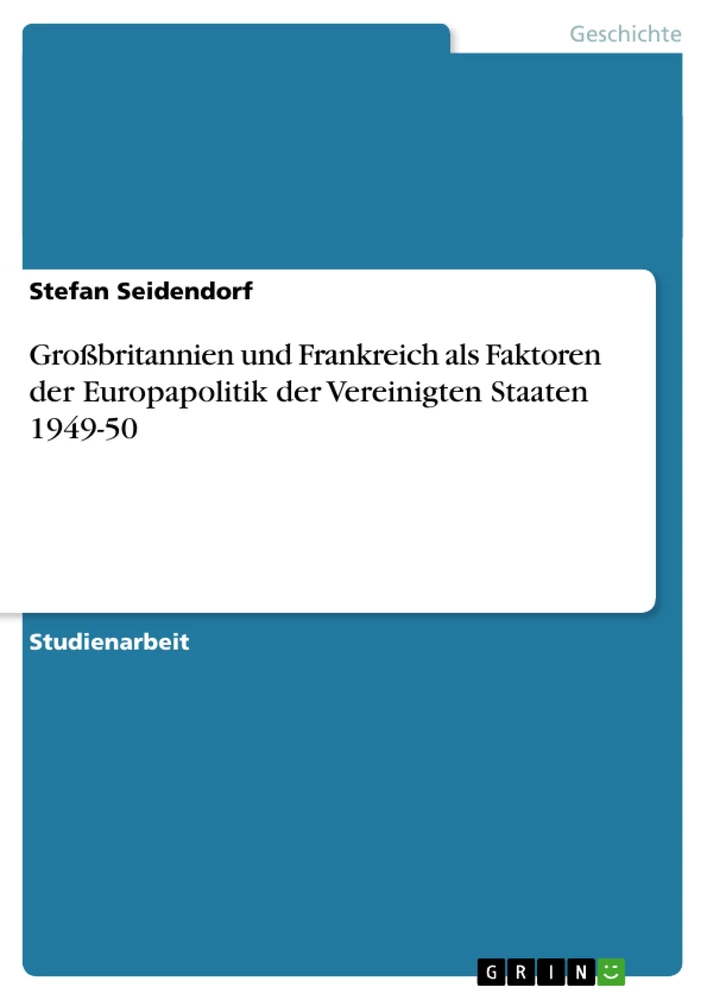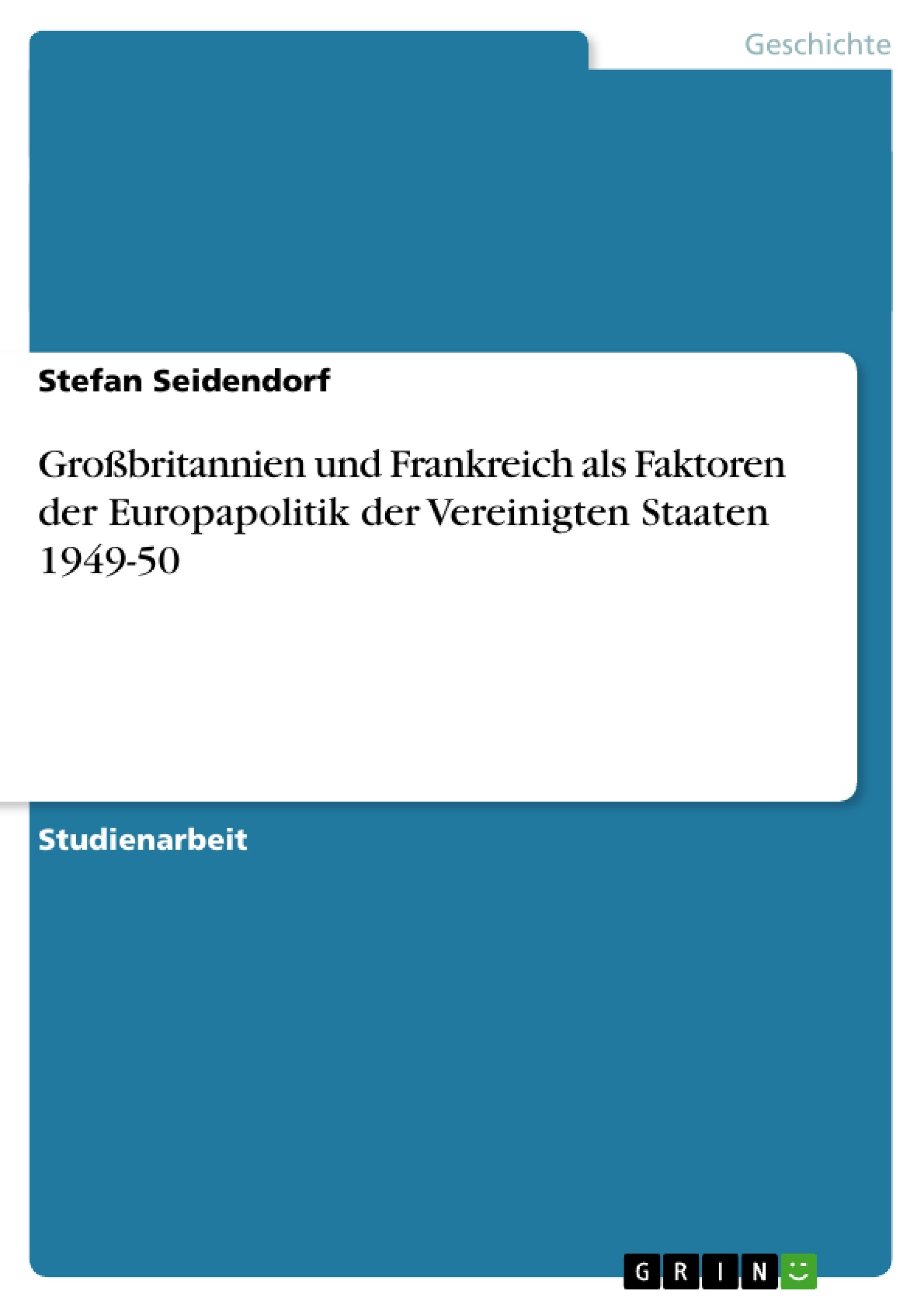1. Einleitung - Die Europapolitik der USA
Betrachtet man die amerikanischen Reaktionen auf den Schumanplan, so stößt man fast ausnahmslos auf positive bis überschwängliche Anteilnahme1. Das verwundert zunächst, scheint doch die Initiative Frankreichs nicht mit den bisherigen Plänen der USA übereinzustimmen: Bis jetzt hatte man in Amerika eine europäische Einigung ohne Großbritannien schlicht für unmöglich gehalten2, man wollte den Partner aus zwei Weltkriegen nicht vor den Kopf stoßen. Außerdem gab es eine ganze Reihe von Vorbehalten gegenüber einer französischen Führung3. Dann war auch eine der Vorgaben des Marshallplans, daß er sich an alle europäischen Länder wendete, der Schumanplan bedeutete aber faktisch die Zweiteilung Europas. Und schließlich war das Ziel, das Amerika seit dem ersten Weltkrieg zu erreichen suchte, der freie und ungehinderte Zugang zu den europäischen Märkten, durch die Möglichkeit zur Kartellbildung, die im Schumanplan angelegt war, in Frage gestellt4.
Diese Arbeit soll durch eine Untersuchung der amerikanischen Absichten in und mit Europa und der Alternativen, wie diese zu erreichen waren, die Gründe für die scheinbare Abkehr von feststehenden Positionen Amerikas in der Zeit zwischen Sommer 1949 und Frühjahr 1950 und das tatsächlich dahinterstehende Kalkül beleuchten.
Zunächst soll nach möglichen Alternativen der amerikanischen Europapolitik in der Nachkriegszeit gesucht werden, dann muß auf das ,,Problem Deutschland" eingegangen werden, das gerade im untersuchten Zeitraum eine entscheidende Rolle spielt. Schließlich muß das Verhältnis zu den möglichen Partnern bei einer europäischen Einigung, Frankreich und Großbritannien, untersucht werden, um darauf aufbauend die möglichen Lösungsansätze darzustellen.
[...]
1 Klaus Schwabe: ,,Ein Akt konstruktiver Staatskunst" - die USA und die Anfänge des Schuman-Plans, S. 211 - 239 in: Klaus Schwabe (Hrsg.): Die Anfänge des Schumanplans, Beiträge des Kolloquiums in Aachen, 28.-30. Mai 1986, S. 215. Im folgenden: Schwabe, Staatskunst und Seitenzahl.
2 Klaus Schwabe: Die Vereinigten Staaten und die Europäische Integration: Alternativen der amerikanischen Außenpolitik (1950-1955), S. 41 - 54 in: Gilbert Trausch (Hrsg.) u. a.: Die europäische Integration vom Schuman-Plan bis zu den Verträgen von Rom, Baden-Baden 1993.[...]
3 Holger Schröder: Jean Monnet und die amerikanische Unterstützung für die europäische Integration 1950 - 1957, Frankfurt am Main 1994. [...]
4 Schwabe, Staatskunst, S. 228.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Die Europapolitik der USA
- Die Lage nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Truman-Doktrin und die neuen Ziele in Europa
- Mögliche Alternativen der amerikanischen Europapolitik
- Die Zuspitzung 1949
- Deutschland als zentrales Problem...
- Das deutsche Wirtschaftspotential
- Die Westbindung Deutschlands
- Der Verteidigungsbeitrag Deutschlands
- Die britische Sonderrolle .......
- Großbritannien als amerikanischer Hauptverbündeter.....
- Das Verhältnis USA - Großbritannien mit Blick auf Europa.............
- Frankreich als Führungsmacht
- Eine Union unter Frankreichs Führung.......
- Die Botschafterkonferenz und die französische Führung
- Die Lösungssuche
- Kennan: Das Modell der zwei Säulen ....
- Die Vorschläge der amerikanischen Botschafter in Europa .....
- Die Analyse des Policy - Planning- Staffs im Januar 1950..\li>
- Die (Er-)Lösung: Der Schumanplan ....
- Die Aufnahme des Plans in den USA
- Das Verhalten der USA während der Verhandlungen
- Ein pragmatisches Vorgehen der Vereinigten Staaten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die amerikanischen Absichten in und mit Europa sowie die Alternativen, wie diese zu erreichen waren. Sie beleuchtet die Gründe für die scheinbare Abkehr von festen Positionen Amerikas in der Zeit zwischen Sommer 1949 und Frühjahr 1950 und das tatsächlich dahinterstehende Kalkül.
- Mögliche Alternativen der amerikanischen Europapolitik in der Nachkriegszeit
- Das „Problem Deutschland“ im untersuchten Zeitraum
- Das Verhältnis zu Frankreich und Großbritannien als möglichen Partnern bei einer europäischen Einigung
- Die möglichen Lösungsansätze
- Die Frage, wie der Schumanplan die Vorgaben erfüllt und möglicherweise noch darüber hinausgeht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der amerikanischen Europapolitik nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Sie skizziert die Herausforderungen der Nachkriegszeit, die Truman-Doktrin und den Marshallplan, sowie die verschiedenen möglichen Alternativen der amerikanischen Politik gegenüber Europa.
Das zweite Kapitel analysiert die Zuspitzung der Situation im Jahr 1949. Es geht dabei insbesondere auf das „Problem Deutschland“ ein, die Rolle Großbritanniens als amerikanischem Hauptverbündeten und die französischen Bestrebungen nach einer Führungsrolle in Europa.
Kapitel 3 befasst sich mit der Suche nach einer Lösung für die bestehenden Herausforderungen in Europa. Es werden die Ansätze Kennans, die Vorschläge der amerikanischen Botschafter in Europa und die Analyse des Policy Planning Staffs im Januar 1950 dargestellt.
Das vierte Kapitel untersucht die (Er-)Lösung durch den Schumanplan und betrachtet die Aufnahme des Plans in den USA sowie das Verhalten der Vereinigten Staaten während der Verhandlungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der amerikanischen Europapolitik, dem Kalten Krieg, der Integration Europas, dem "Problem Deutschland", der Rolle Großbritanniens und Frankreichs sowie dem Schumanplan. Weitere wichtige Begriffe sind Marshallplan, Truman-Doktrin, Containment, Hegemonie, supranationale Strukturen und die strategischen und wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten in Europa.
- Quote paper
- Stefan Seidendorf (Author), 1997, Großbritannien und Frankreich als Faktoren der Europapolitik der Vereinigten Staaten 1949-50, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7583