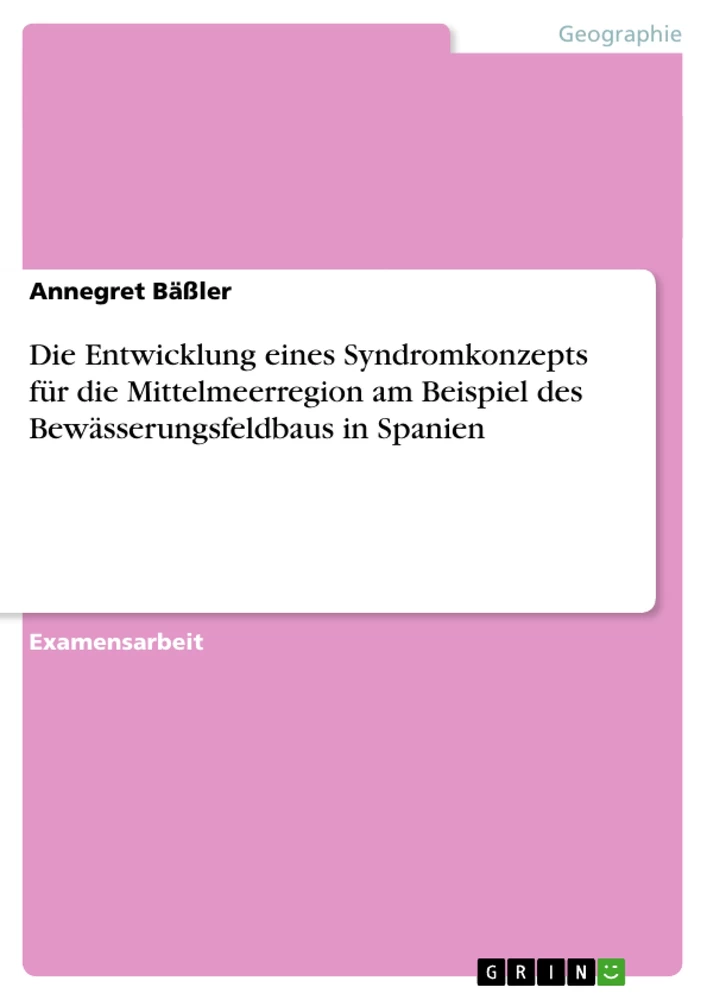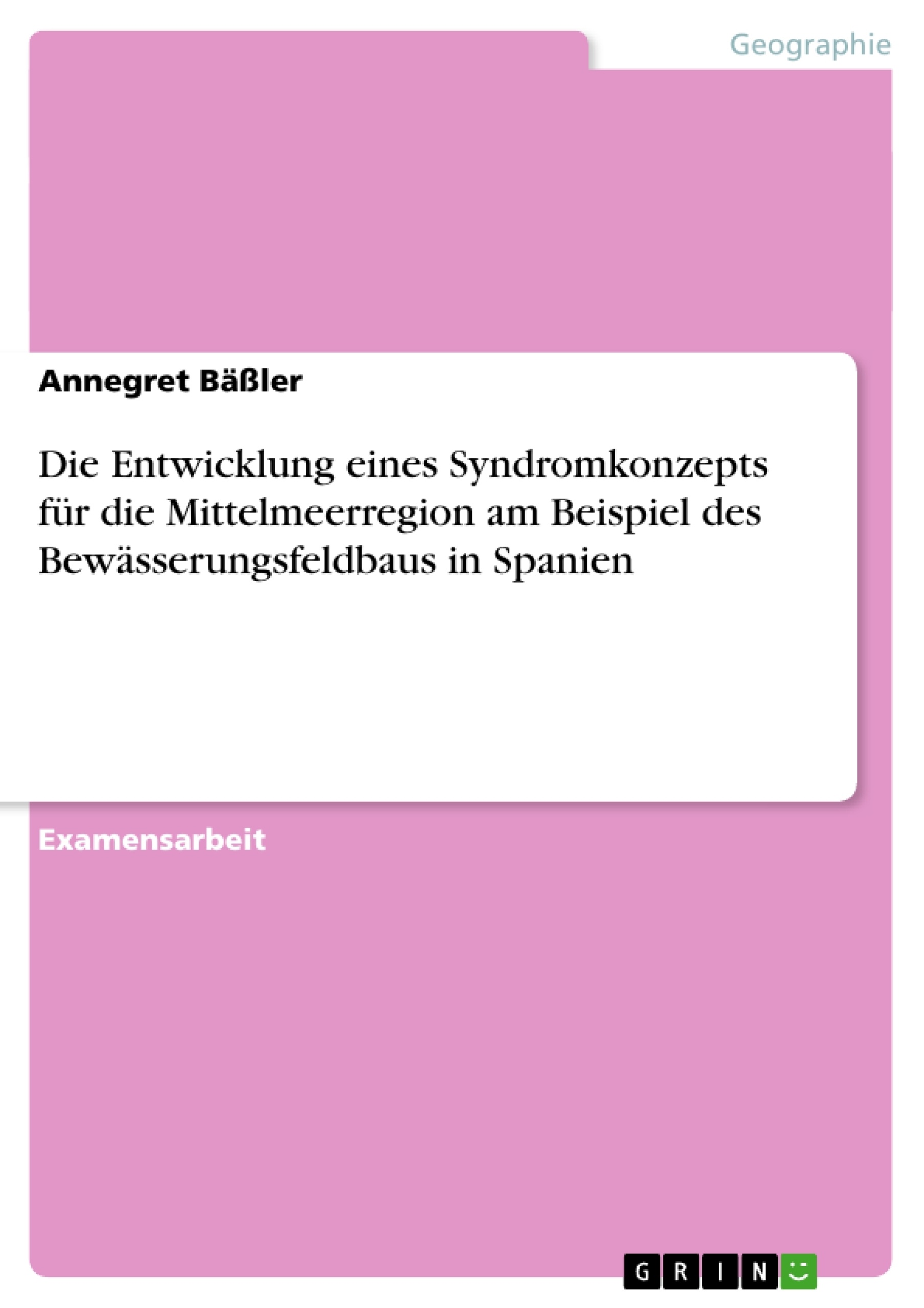Der ORF in Österreich brachte am 28. Juni 2005 die Meldung „Spaniens Erde verdurstet. In der Berichterstattung hieß es: Seit Wochen stöhnt die Iberische Halbinsel unter der schlimmsten Hitze- und Dürreperiode seit 60 Jahren: Verdorrte Ackerflächen, riesige Waldbrände und ausgetrocknete Stauseen kennzeichnen das Bild. In Spanien führt kein einziger Fluss zwischen Barcelona und Malaga noch Wasser, in vielen Regionen musste das Wasser bereits rationiert werden“.
Diesem Problem des Wassermangels der Mittelmeerregion soll in dieser Arbeit am Beispiel Spaniens auf den Grund gegangen werden.
Um eine unfangreiche Bearbeitung der Problematik des Wasserdefizits in der Mittelmeerregion, speziell in Spanien, zu gewähleisten, wird nicht nur aus einer Perspektive betrachtet, sondern das Syndromkonzept des globalen Wandels findet hier seine Anwendung. Daher wird im 2. Kapitel der Syndromansatz kurz erläutert.
Da das Wasser-Problem Spaniens auch in anderen Ländern auftritt, obgleich in veränderter Intensität, ist es notwendig die klimatische Einordnung dieser Region mit einfließen zu lassen. Dieses geschieht in Kapitel 3, was gleichzeitig auch als Sphärenbetrachtung der Atmosphäre zu sehen ist.
Da das Syndromkonzept des globalen Wandels neben der Atmosphäre, noch 8 weitere Sphären beinhaltet, werden in Kapitel 4 für die Betrachtung und Erläuterung des Bewässerungsfeldbaus hauptsächlich die Blickwinkel der Sphären Wirtschaft, Pedosphäre und Hydrosphäre verwendet. Dabei werden mit Hilfe der Dokumentenanalyse verschiedene Symptome herausgearbeitet.
In Kapitel 5 werden die herausgearbeiteten Symptome mit denen der Symptomsammlung der WBGU abgeglichen. Auch die Prüfung auf die Verwendbarkeit schon vorhandener Syndrome bleibt nicht außen vor. Aufgrund mangelnder Passung werden dann alle Sphären gemeinsam mit den neu kombinierten Symptomen zu dem Syndrom der Mittelmeerregion zusammengefügt. Die Umsetzung des Syndroms der Mittelmeerregion findet sowohl in verbaler, als auch in graphischer Form statt. Dabei werden Zusammenhänge, Ursachen und Folgen (die Syndromdiagnose) verdeutlicht und mögliche Handlungsoptionen werden aufgezeigt.
Kapitel 6 stellt abschließend eine Idee für die Anwendungsmöglichkeit des Syndroms der Mittelmeerregion für die Gymnasialstufe vor, die mit dem Lehrplan konform gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Syndromkonzept – Ein kurzer Abriss
- Globaler Wandel und Nachhaltigkeit
- Definition: Symptom, Wechselwirkungen und Syndrom
- Die Subtropen
- Klimatische Bedingungen Spaniens
- Das thermische Klima Spaniens
- Das hygrische Klima Spaniens
- Klimatische Bedingungen Spaniens
- Bewässerungsfeldbau in Spanien
- Die Entwicklung der Wasserwirtschaft in Spanien
- Bewässerungsfeldbau in Spanien
- Formen des Bewässerungsfeldbaus
- Bewässerungsfeldbau in einer ausgewählten spanischen Region
- Die geoökologischen und sozioökonomischen Folgen des Bewässerungsfeldbaus
- Syndrom für die Mittelmeerregion
- Kernprobleme der Mittelmeerregion
- Kernprobleme im Sahel-Syndrom
- Kernprobleme im Dust-Bowl-Syndrom
- Kernprobleme im Grüne-Revolution-Syndrom
- Konzeption: Syndrom der Mittelmeerregion
- Kernprobleme der Mittelmeerregion
- Anwendungsmöglichkeit im Unterricht
- Lehrplanbezug (Gymnasialstufe)
- Idee zur Anwendung im Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit entwickelt ein Syndromkonzept für die Mittelmeerregion am Beispiel des Bewässerungsfeldbaus in Spanien. Ziel ist es, die komplexen Wechselwirkungen zwischen natürlichen und anthropogenen Faktoren im Kontext des globalen Wandels zu analysieren und ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen dieser Region zu schaffen. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Bewässerungsfeldbaus auf die Umwelt und die Gesellschaft.
- Entwicklung eines Syndromkonzepts für die Mittelmeerregion
- Analyse des Bewässerungsfeldbaus in Spanien
- Geoökologische und sozioökonomische Folgen des Bewässerungsfeldbaus
- Vergleich mit anderen Syndromen (Sahel, Dust Bowl, Grüne Revolution)
- Didaktische Anwendung des Syndromkonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die Bedeutung eines Syndromkonzepts für das Verständnis der komplexen Herausforderungen der Mittelmeerregion. Sie begründet die Wahl des Bewässerungsfeldbaus in Spanien als Fallbeispiel und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Syndromkonzept – Ein kurzer Abriss: Dieses Kapitel erläutert das Konzept des Syndroms im Kontext des globalen Wandels und der Nachhaltigkeit. Es definiert die Begriffe Symptom, Wechselwirkung und Syndrom und legt die Grundlage für die spätere Anwendung des Konzepts auf die Mittelmeerregion. Es unterstreicht die Bedeutung von Wechselwirkungen und Rückkopplungsschleifen im Verständnis komplexer Systeme.
Die Subtropen: Der Abschnitt beschreibt die klimatischen Bedingungen der mediterranen Subtropen mit Fokus auf Spanien. Die Analyse von thermischen und hygrischen Klimafaktoren legt den Grundstein für das Verständnis der Herausforderungen des Bewässerungsfeldbaus in dieser Region. Die Darstellung der klimatischen Gegebenheiten unterstreicht die Notwendigkeit nachhaltiger Bewirtschaftungsmethoden.
Bewässerungsfeldbau in Spanien: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Wasserwirtschaft in Spanien und die verschiedenen Formen des Bewässerungsfeldbaus. Es untersucht ein konkretes Beispiel einer spanischen Region, um die komplexen geoökologischen und sozioökonomischen Folgen des Bewässerungsfeldbaus aufzuzeigen. Dabei werden die positiven und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung beleuchtet und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Umgangs mit Wasserressourcen betont.
Syndrom für die Mittelmeerregion: Dieses Kapitel präsentiert das entwickelte Syndromkonzept für die Mittelmeerregion. Es identifiziert die Kernprobleme der Region und vergleicht sie mit ähnlichen Syndromen wie dem Sahel-Syndrom, dem Dust-Bowl-Syndrom und dem Syndrom der Grünen Revolution. Die Analyse der gemeinsamen und spezifischen Merkmale ermöglicht ein tieferes Verständnis der Herausforderungen der Mittelmeerregion im Kontext des globalen Wandels.
Anwendungsmöglichkeit im Unterricht: Dieses Kapitel beschreibt Möglichkeiten, das entwickelte Syndromkonzept didaktisch im Unterricht der Gymnasialstufe einzusetzen. Es zeigt auf, wie der Lehrplanbezug hergestellt und das komplexe Thema für Schüler verständlich aufbereitet werden kann. Konkrete Unterrichtsideen werden vorgestellt, um die Schüler zum selbstständigen Denken und Handeln anzuregen.
Schlüsselwörter
Mittelmeerregion, Bewässerungsfeldbau, Spanien, Syndromkonzept, Globaler Wandel, Nachhaltigkeit, Wasserwirtschaft, Geoökologie, Sozioökonomie, Didaktik, Lehrplanbezug, Sahel-Syndrom, Dust-Bowl-Syndrom, Grüne Revolution.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Syndromkonzept für die Mittelmeerregion am Beispiel Spaniens
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Arbeit entwickelt ein Syndromkonzept für die Mittelmeerregion, anhand des Bewässerungsfeldbaus in Spanien als Fallbeispiel. Sie analysiert die komplexen Wechselwirkungen zwischen natürlichen und anthropogenen Faktoren im Kontext des globalen Wandels und untersucht die Auswirkungen des Bewässerungsfeldbaus auf Umwelt und Gesellschaft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Hausarbeit umfasst die Entwicklung eines Syndromkonzepts, die Analyse des Bewässerungsfeldbaus in Spanien (einschließlich der Entwicklung der spanischen Wasserwirtschaft und verschiedener Bewässerungsformen), die geoökologischen und sozioökonomischen Folgen des Bewässerungsfeldbaus, einen Vergleich mit anderen Syndromen (Sahel, Dust Bowl, Grüne Revolution) und didaktische Anwendungsmöglichkeiten des Konzepts im Schulunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Syndromkonzept, ein Kapitel zu den klimatischen Bedingungen in Spanien, ein Kapitel zum Bewässerungsfeldbau in Spanien, ein Kapitel zum Syndrom der Mittelmeerregion und abschließend ein Kapitel zur didaktischen Anwendung im Unterricht. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Was wird unter einem Syndromkonzept verstanden?
Das Syndromkonzept beschreibt die komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Faktoren (Symptomen) im Kontext des globalen Wandels und der Nachhaltigkeit. Es betont die Bedeutung von Rückkopplungsschleifen und Wechselwirkungen im Verständnis komplexer Systeme.
Welche klimatischen Bedingungen Spaniens werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die thermischen und hygrischen Klimafaktoren Spaniens, um die Herausforderungen des Bewässerungsfeldbaus in dieser Region zu verstehen und die Notwendigkeit nachhaltiger Bewirtschaftungsmethoden zu belegen.
Welche Aspekte des Bewässerungsfeldbaus in Spanien werden untersucht?
Die Untersuchung umfasst die Entwicklung der spanischen Wasserwirtschaft, verschiedene Formen des Bewässerungsfeldbaus, ein Beispiel aus einer spezifischen spanischen Region, sowie die positiven und negativen geoökologischen und sozioökonomischen Folgen.
Welche anderen Syndrome werden mit dem Mittelmeersyndrom verglichen?
Die Arbeit vergleicht das entwickelte Mittelmeersyndrom mit dem Sahel-Syndrom, dem Dust-Bowl-Syndrom und dem Syndrom der Grünen Revolution, um gemeinsame und spezifische Merkmale zu identifizieren und ein tieferes Verständnis der Herausforderungen der Mittelmeerregion zu ermöglichen.
Wie kann das Syndromkonzept im Unterricht angewendet werden?
Die Arbeit bietet Vorschläge zur didaktischen Anwendung des Syndromkonzepts im gymnasialen Unterricht, inklusive Lehrplanbezug und konkreter Unterrichtsideen, um Schülern das komplexe Thema verständlich zu vermitteln und sie zum selbstständigen Denken und Handeln anzuregen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mittelmeerregion, Bewässerungsfeldbau, Spanien, Syndromkonzept, Globaler Wandel, Nachhaltigkeit, Wasserwirtschaft, Geoökologie, Sozioökonomie, Didaktik, Lehrplanbezug, Sahel-Syndrom, Dust-Bowl-Syndrom, Grüne Revolution.
- Quote paper
- Annegret Bäßler (Author), 2006, Die Entwicklung eines Syndromkonzepts für die Mittelmeerregion am Beispiel des Bewässerungsfeldbaus in Spanien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75723