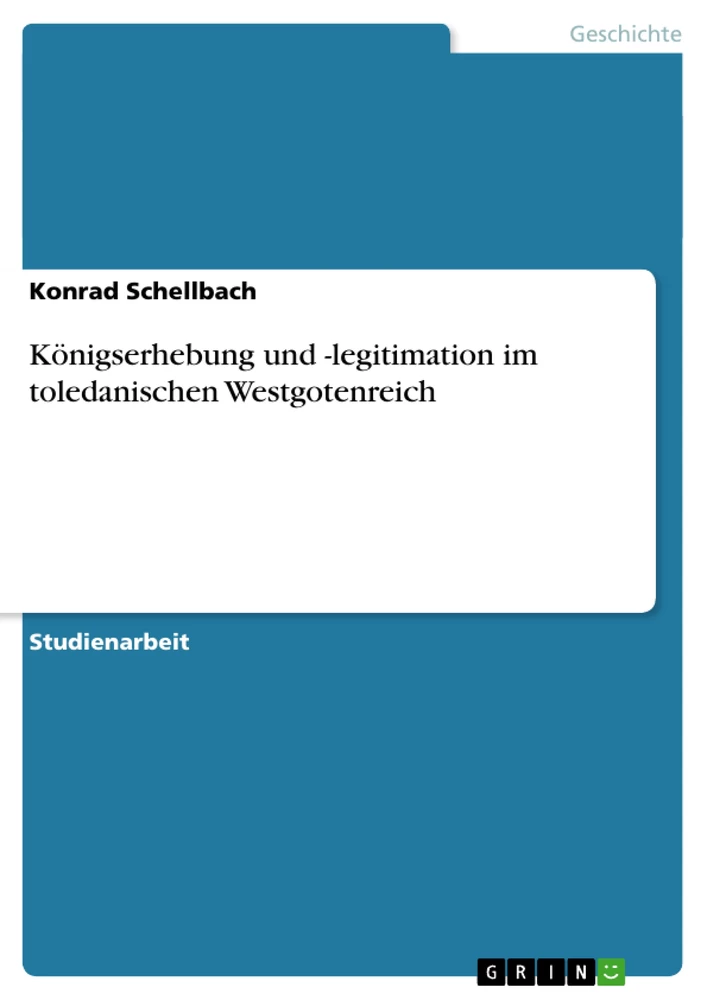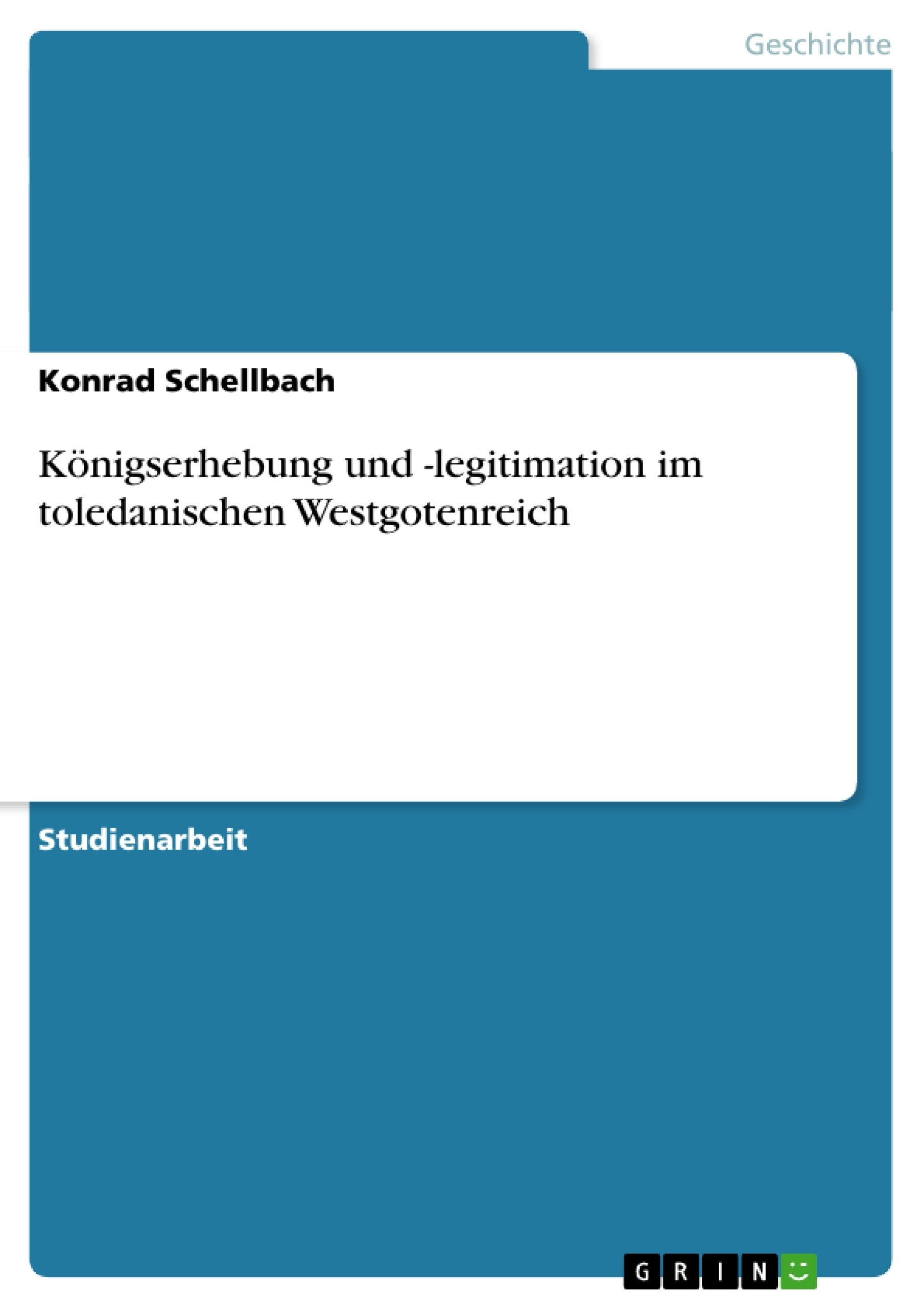Das Ziel dieser Hausarbeit besteht darin, dem Leser einen Einblick in die Königserhebung und -legitimation der westgotischen Herrscher im Toledanischen Reich zu ermöglichen.
Im ersten Gliederungspunkt gehe ich auf die westgotischen Herrschaftsinsignien ein, wobei ich in den jeweils untergeordneten Kapiteln die Rolle und möglichen Stellenwert von Thron, Szepter, Gewand und Krone näher beschreibe.
Im besonderen Maße ist die Bedeutung der Krone in der Forschung umstritten. Ich habe dies zum Anreiz genommen, ebendiese auf Basis der zuvor erarbeiteten Erkenntnisse mit den Zeugnissen der Primärquellen zu vergleichen, um somit die Eventualität eines westgotischen Krönungsbrauches im zweiten Abschnitt zu überprüfen.
Der dritte und letzte Gliederungspunkt dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Salbung der toledanischen Herrscher. Hierbei beschreibe ich den Entwicklungsprozess, welcher sich über die Bemühungen zur Schaffung einer konfessionellen Einheit der Westgoten während der Herrschaft Leovigilds, sowie der beginnenden Verchristlichung des Königtums seit Reccared I. bis hin zum endgültig konstitutiven und somit maßgeblichen Akt der westgotischen Königsweihe, spätestens seit Wamba, entwickelt hat. Da der genaue Stellenwert der Salbung im westgotischen Zeremoniell ebenso in der Forschung umstritten ist, habe ich in diesem Gliederungspunkt zusätzlich die originalen Quellen einigen vorherrschende Forschungsmeinungen gegenübergestellt und miteinander verglichen.
Unter Berücksichtigung meiner schriftlichen Hauptquellen Isidor von Sevilla, Julian von Toledo, Johannes von Biclaro, der Illustration aus dem Codex Albeldense, dem Fresko von Qusejr ’Amra, einer Auswahl von Münzen sowie einschlägiger Sekundärliteratur habe ich versucht in dieser Hausarbeit der Fragestellung nachzugehen, wie sich die westgotische Königsweihe darstellte und mit welchen Mitteln die toledanischen Herrscher versuchten, ihre Macht zu legitimieren bzw. ebendiese zum Ausdruck zu bringen. Außerdem ist die Gegenüberstellung von möglicher Krönung sowie Salbung als konstitutive Akte der westgotischen Herrscherweihe von Interesse.
Inhaltsverzeichnis
- Königserhebung und -legitimation im toledanischen Westgotenreich
- Einleitung
- Herrschaftsinsignien der Westgotenkönige
- Einführung
- Der Thron
- Szepter und Königsgewand der Westgotischen Herrscher
- Die Krone
- Krönung ohne Krone? – Die Rolle der Krone bei der westgotischen Herrschaftserhebung
- Die Salbung - Entstehung und Bedeutung
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Königserhebung und -legitimation der westgotischen Herrscher im toledanischen Reich. Sie analysiert die Rolle von Herrschaftsinsignien (Thron, Szepter, Gewand, Krone) und beleuchtet die umstrittene Bedeutung der Krone im westgotischen Krönungsbrauch. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Bedeutung der Salbung als konstitutiver Akt der Königsweihe, unter Berücksichtigung des Forschungsdiskurses und der Quellenlage.
- Westgotische Herrschaftsinsignien und ihre Symbolik
- Die Rolle der Krone bei der westgotischen Königsweihe
- Entwicklung und Bedeutung der Salbung im westgotischen Königtum
- Legitimation und Machtdemonstration westgotischer Herrscher
- Auswertung schriftlicher und archäologischer Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Königserhebung und -legitimation im toledanischen Westgotenreich: Diese Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit: einen Einblick in die Königserhebung und -legitimation der westgotischen Herrscher zu geben. Es wird der Aufbau der Arbeit erläutert, mit Fokus auf Herrschaftsinsignien, die Rolle der Krone und die Bedeutung der Salbung. Die Arbeit befasst sich mit der schwierigen Quellenlage und dem Forschungsdiskurs um die westgotische Königsweihe, wobei Isidor von Sevilla, Julian von Toledo und Johannes von Biclaro als wichtige Quellen genannt werden. Die Hausarbeit untersucht, wie die westgotischen Könige ihre Macht legitimierten und zum Ausdruck brachten und vergleicht mögliche Krönungs- und Salbungsrituale.
Herrschaftsinsignien der Westgotenkönige: Dieses Kapitel analysiert die westgotischen Herrschaftsinsignien im Kontext der Regentschaft Leovigilds (568-586). Es beschreibt die innenpolitischen Krisen und Konflikte zwischen Adel und Monarchie und wie Leovigild durch die Einführung von Herrschaftsinsignien (Thron, Königsgewand etc.) die königliche Macht neu definierte und konsolidierte. Isidor von Sevilla wird als Quelle zitiert, der die Einführung königlicher Insignien durch Leovigild beschreibt und damit einen Bruch mit der bisherigen Praxis gleichberechtigter Kleidung und Sitzordnung zwischen König und Adel markiert. Das Kapitel verdeutlicht die Notwendigkeit der Legitimation der königlichen Autorität angesichts der starken Machtposition des Adels.
Schlüsselwörter
Westgoten, Toledanisches Reich, Königserhebung, Königslegitimation, Herrschaftsinsignien, Krone, Szepter, Königsgewand, Thron, Salbung, Leovigild, Isidor von Sevilla, Julian von Toledo, Johannes von Biclaro, Codex Albeldense, Münzen, Archäologie, Forschungsdiskurs, Primärquellen, Sekundärliteratur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Königserhebung und -legitimation im toledanischen Westgotenreich"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Königserhebung und -legitimation der westgotischen Herrscher im toledanischen Reich. Sie analysiert die Rolle von Herrschaftsinsignien (Thron, Szepter, Gewand, Krone) und die Bedeutung der Krone und der Salbung im westgotischen Krönungsbrauch. Die Arbeit berücksichtigt den Forschungsdiskurs und die Quellenlage, insbesondere Isidor von Sevilla, Julian von Toledo und Johannes von Biclaro.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf westgotische Herrschaftsinsignien und ihre Symbolik, die Rolle der Krone bei der Königsweihe, die Entwicklung und Bedeutung der Salbung, die Legitimation und Machtdemonstration westgotischer Herrscher sowie die Auswertung schriftlicher und archäologischer Quellen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Königserhebung und -legitimation im toledanischen Westgotenreich (Einleitung mit Überblick und methodischem Vorgehen), Herrschaftsinsignien der Westgotenkönige (Analyse der Insignien im Kontext der Regentschaft Leovigilds und deren Bedeutung für die Konsolidierung der königlichen Macht), Krönung ohne Krone? – Die Rolle der Krone bei der westgotischen Herrschaftserhebung, Die Salbung - Entstehung und Bedeutung und eine abschließende Betrachtung. Die Kapitel analysieren die Quellenlage und den Forschungsstand zum Thema.
Welche Quellen werden verwendet?
Wichtige Quellen sind die Schriften von Isidor von Sevilla, Julian von Toledo und Johannes von Biclaro. Die Arbeit bezieht sich zudem auf archäologische Funde und Münzen, sowie auf den Forschungsdiskurs zu den Primär- und Sekundärquellen.
Welche Rolle spielen die Herrschaftsinsignien?
Die Herrschaftsinsignien (Thron, Szepter, Gewand, Krone) werden als zentrale Elemente der Königslegitimation und Machtdemonstration analysiert. Die Einführung dieser Insignien durch Leovigild wird als ein Schritt zur Konsolidierung der königlichen Macht gegenüber dem Adel interpretiert.
Welche Bedeutung hat die Krone und die Salbung?
Die Arbeit untersucht die umstrittene Bedeutung der Krone im westgotischen Krönungsbrauch und die Entwicklung und Bedeutung der Salbung als konstitutiver Akt der Königsweihe. Es wird analysiert, inwiefern diese Rituale zur Legitimation der Könige beitrugen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Westgoten, Toledanisches Reich, Königserhebung, Königslegitimation, Herrschaftsinsignien, Krone, Szepter, Königsgewand, Thron, Salbung, Leovigild, Isidor von Sevilla, Julian von Toledo, Johannes von Biclaro, Codex Albeldense, Münzen, Archäologie, Forschungsdiskurs, Primärquellen, Sekundärliteratur.
- Quote paper
- Konrad Schellbach (Author), 2006, Königserhebung und -legitimation im toledanischen Westgotenreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75641