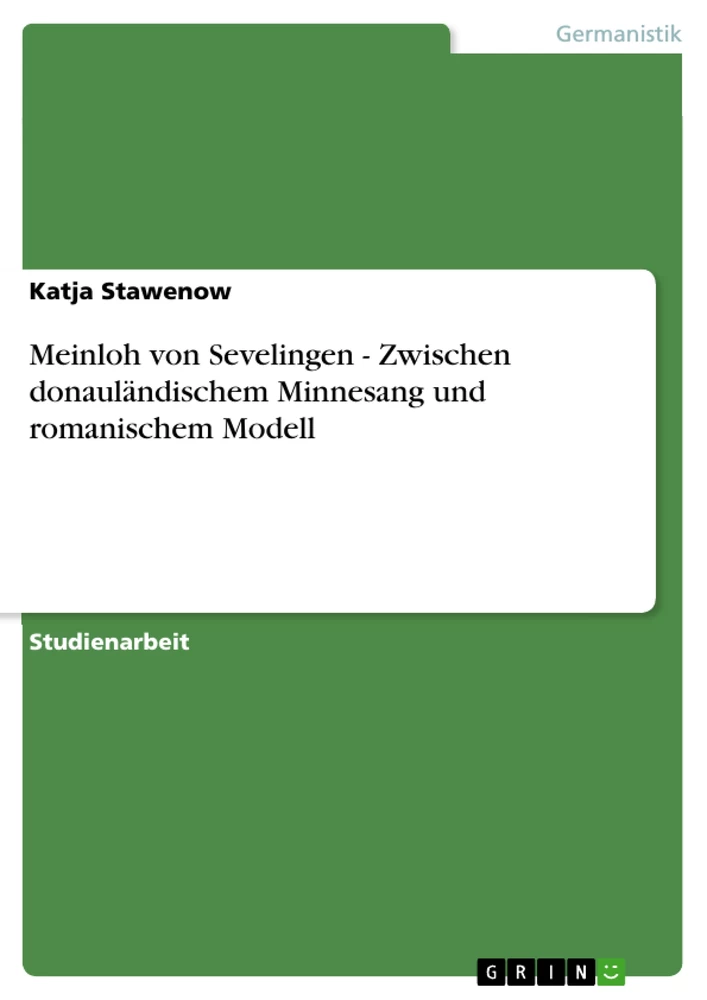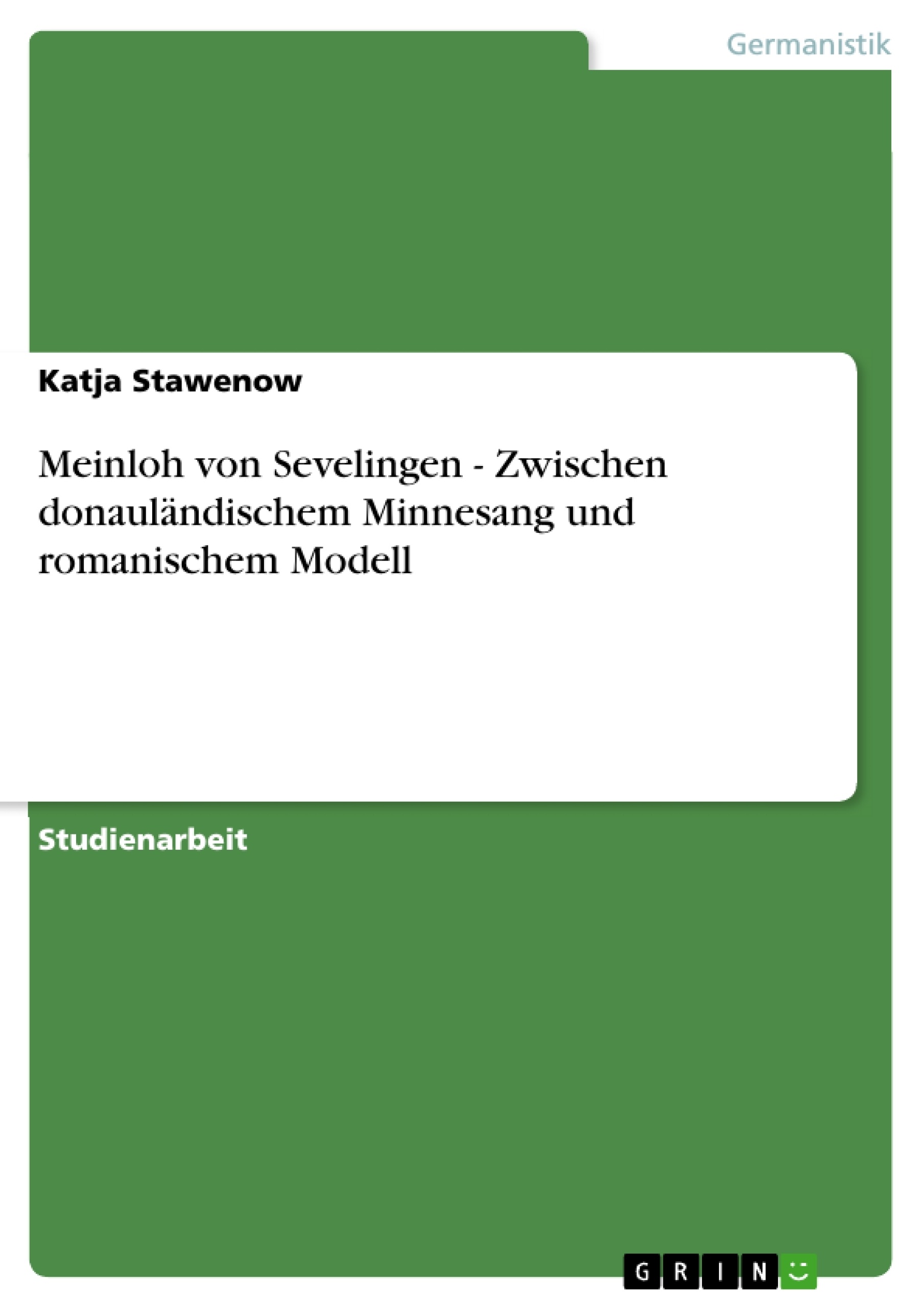Ein Thema, das wohl im Leben nahezu jedes Menschen eine Rolle spielt, ist die Liebe. Sie zeigt sich als Emotion, die vielfältig variierende Erscheinungsformen kennt und sich zu keiner Zeit in eine umfassende, wissenschaftliche Definition pressen ließ. Dies liegt neben den unterschiedlichen Formen der Liebe, ihrer jeweils ausgeprägten Intensität und weiteren Eigenschaften daran, dass zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Kulturräumen sich voneinander unterscheidende Liebeskonzeptionen existieren. Man darf nicht voraussetzen, dass immer und überall der Liebesbegriff vorherrschte, den man heute kennt und nutzt. Vielmehr handelt es sich um ein Gefüge, das im spezifischen kulturellen Kontext eine je eigene Ausprägung und Bedeutung erhält. Immer stehen die Liebe oder deren Teilaspekte im Zentrum emotionalen Handelns und repräsentieren eine Vorstellung von Liebe, also ein Liebeskonzept.
Die modernen Vorstellungen von Liebe basieren auf Einflüssen sich völlig von unserer Zeit unterscheidenden kultureller Hintergründe. Die Geschichte des Liebesbegriffs ist keineswegs einheitlich, sondern integriert sich diachron betrachtet durch historisch bedingte Kontexte in neue Bedeutungsordnungen. So fußt beispielsweise unsere Vorstellung von Liebe sowohl auf antiken Grundmustern als auch auf denen des christlichen Abendlandes, die im Mittelalter stark geprägt wurden.
Das Mittelalter galt lange Zeit und gilt teilweise noch heute als ‚dunkles’ Zeitalter, das zwischen zwei als großartig empfundenen Abschnitten der Geschichte eine enorme Zeitspanne beherrschte, in der es vermeintlich barbarischer, grausamer und kulturell ärmer zuging als in der griechischen und römischen Antike beziehungsweise in der Renaissance. Zunehmend gelangt die moderne Wissenschaft jedoch zu der Ansicht, dass das Mittelalter keineswegs nur ‚dunkel’ gewesen sei, sondern im Gegenteil durch die historischen Ereignisse prägend für die weiteren, unter anderem kulturellen Entwicklungen war. In dieser Zeit festigte sich das Fundament unseres neuzeitlichen gesellschaftlichen Gefüges.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heranführen an die Thematik
- Problemstellung der Arbeit
- Minnesang im historischen Kontext
- Höfisches Leben des Adels als Entwurf einer Einstellung zum Leben
- Donauländischer Minnesang
- Romanisches Modell
- Meinloh von Sevelingen
- Biografisches: Herkunft, Wirken und Bedeutung
- Textkorpus
- Überlieferung
- Wesenszüge des Meinloh’schen Korpus
- Ausgewählte inhaltliche Aspekte
- Verhältnis zwischen Mann und Frau
- Ausgewählte Motive
- Vieldiskutierte Ansätze
- Liebesidee Meinlohs
- Liebeskonzeptionen als Träger von Vorstellungen unterschiedlicher Zeiten und Kulturen
- Kombination der Modelle bei Meinloh
- Umgang mit Lebensfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit zentralen Lebensfragen in einer Zeit, in der sich ein Wandel in der Liebeskonzeption abzeichnet. Am Beispiel von Meinlohs von Sevelingen werden die besonderen Merkmale zweier Minnesangmodelle herausgearbeitet, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beleuchten. Die Arbeit geht der Frage nach, welche Haltung zum Leben die Konzeptionen einnehmen, welche Mittel ihnen bezüglich der Umsetzung zur Verfügung stehen und ob Widersprüche in Meinlohs Werk entstehen.
- Die Entwicklung der Liebeskonzeption im Minnesang
- Das Zusammenspiel von höfischer Lebenswelt und Liebeskonzeptionen
- Die Rolle von Meinloh von Sevelingen als Übergangsfigur zwischen donauländischem und romanischem Minnesang
- Die Kombination von formalen und inhaltlichen Aspekten in Meinlohs Werk
- Die Bedeutung der Liebe als Spiegel gesellschaftlicher und individueller Wertvorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Liebe als einem vielschichtigen Phänomen ein und beleuchtet die Bedeutung verschiedener Liebeskonzeptionen im historischen Kontext. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Minnesang im Kontext der höfischen Kultur und stellt die beiden Hauptmodelle des donauländischen und romanischen Minnesangs vor.
Das dritte Kapitel analysiert das Werk von Meinloh von Sevelingen und beleuchtet dessen Einordnung als Übergangsfigur zwischen den beiden Minnesangmodellen. Es werden die Besonderheiten seines Textkorpus, die Beziehung zwischen Mann und Frau sowie ausgewählte Motive näher betrachtet.
Schließlich werden im vierten Kapitel die verschiedenen Liebeskonzeptionen als Träger von Vorstellungen unterschiedlicher Zeiten und Kulturen beleuchtet. Es wird untersucht, wie Meinloh von Sevelingen die beiden Modelle in seinem Werk kombiniert und wie diese Kombination seinen Umgang mit Lebensfragen widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Minnesang, donauländischer Minnesang, romanisches Modell, Meinloh von Sevelingen, Liebeskonzeption, höfische Kultur, Übergangszeit, Frauenbild, Motiv, Dienst, Harmonie, Begehren, Verzicht, Ethisierung, Rationalisierung.
- Quote paper
- Katja Stawenow (Author), 2006, Meinloh von Sevelingen - Zwischen donauländischem Minnesang und romanischem Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75602