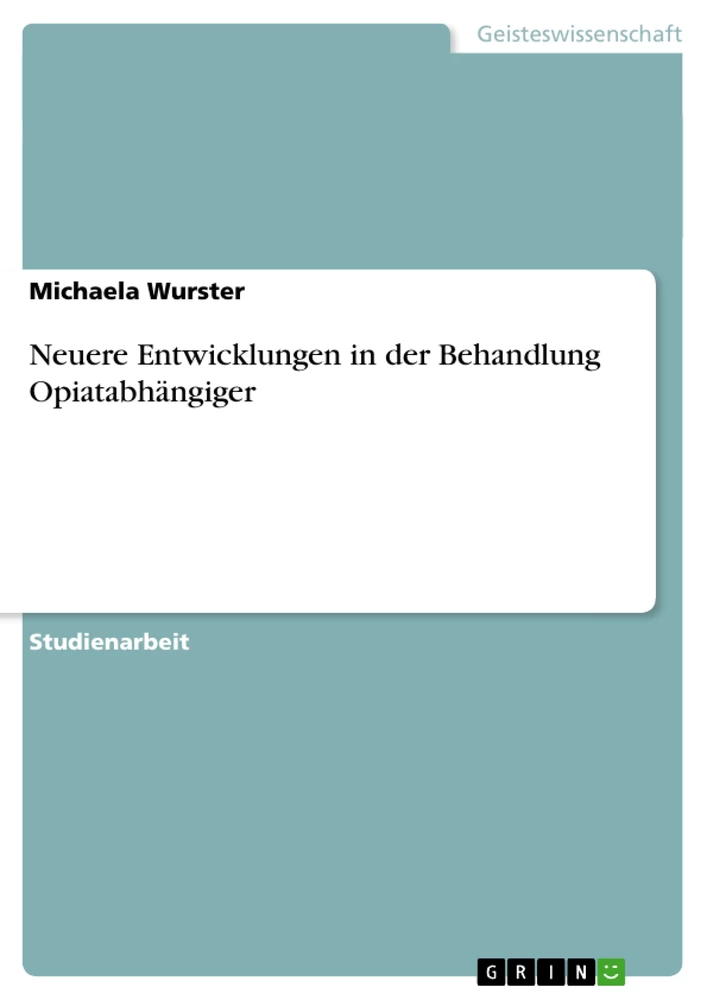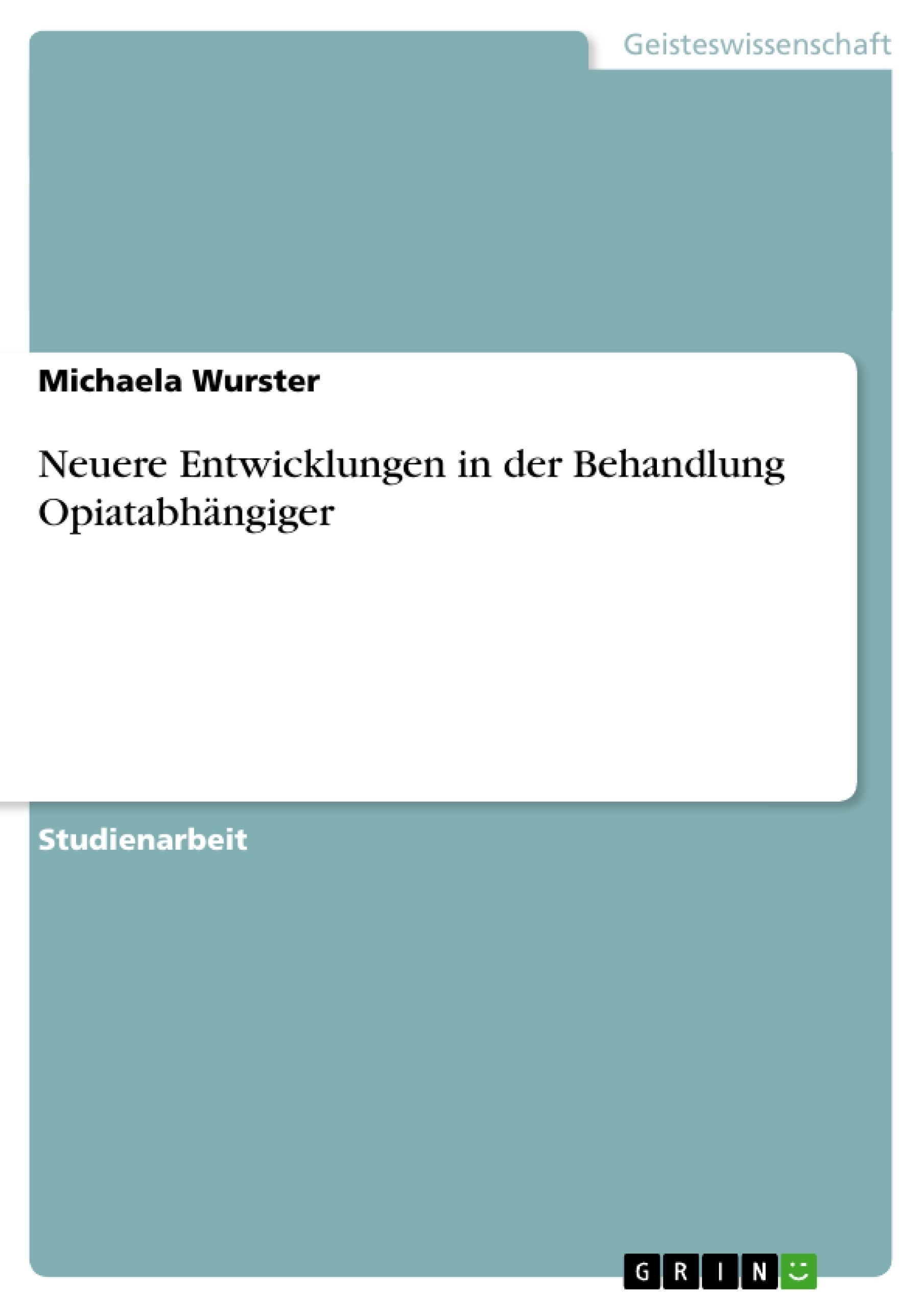Zur Geschichte und Entdeckung des Morphins und den daraus entstandenen Opiaten
Als es dem deutschen Chemiker und Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner im Jahre 1804 gelang, das Morphium, als Schlafmacher, aus dem bereits weit verbreiteten Opium zu isolieren, begann ein "neues Zeitalter des Morphinismus".
Bereits 1828 wurde es von dem Pharmakonzern Merck, unter dem Namen " Merck`s
Morphine", produziert und vermarktet.
Im 19. Jahrhundert war Opium in nahezu jedem westlichen Haushalt zu finden. Ob nun als Schlummertrunk für Kleinkinder ("soothing Syrup") oder als Rauschdroge für jene,, die sich Alkohol nicht leisten konnten. Ob bei einfachen Arbeitern oder in Intellektuellenkreisen, Opium war zu dieser Zeit "allgegenwärtig".
Es war angezeigt für jegliche Art von Schmerzen, Durchfall, Asthma u.v.m.
Zitat: "Es wäre vermutlich einfacher, die Krankheiten aufzuzählen, bei denen Opium nie eingesetzt wurde, als diejenigen bei denen es verwendet wurde"(Kreutel 1988)
Mit der Zeit bemerkten allerdings immer mehr Menschen auch die negativen Auswirkungen des Opiumkonsums, da sich mehr und mehr Abhängigkeiten ausbildeten.
Von der Isolierung des Morphins erhoffte man sich, nun endlich einen Weg gefunden zu haben, die gewünschten Wirkungen des Opiums, wie die analgetische, die schlaffördernde und die antitussive, zu erhalten, ohne dabei die negative Auswirkung der Abhängigkeit zu erzeugen.
Nachdem diese Hoffnung fehlschlug, spekulierte man, das Problem durch die Entwicklung der Injektionsspritze Mitte der 50 er Jahre lösen zu können. Diese Erwartung ging auf die Annahme zurück, dass sich eine Abhängigkeit nur bei oraler Einnahme einstellte (Opiumhunger).
Doch auch diese Hoffnung schlug fehl, und ein Injizieren des Morphiums beschleunigte die Ausbildung einer Toleranzentwicklung hingegen noch.
Im deutsch - französischen Krieg 1870/71 wurde Morphium zum ersten mal im großen Maßstab eingesetzt. Durch die vielen morphinabhängigen Veteranen wurde dessen Gefahr nun zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit deutlich.
Auch die Soldaten des amerikanischen Bürgerkriegs, sowie die des preußisch- österreichischen, erhielten teilweise schon Morphium, so dass die Entzugssymptome im Volksmund schon als "Soldatenkrankheit" bezeichnet wurden.
Im Jahre 1879 wurde die suchtbildende Eigenschaft des Morphins dann von Louis Lewin wissenschaftlich nachgewiesen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Zur Geschichte und Entdeckung des Morphins und den daraus entstandenen Opiaten
- Die Rezeptoren
- Die „gängigsten“ Substanzen bei der Behandlung von Opiatabhängigen
- Opium
- Morphium
- Heroin
- Codein
- Dihydrocodein
- Die Methadone L-Polamidon und d,l Methadon
- Buprenorphin
- 1,4 Benzodiazepine
- Barbiturate
- Substitution in den „Kinderschuhen“
- Die ersten akzeptierenden Ansätze
- Die Rahmenbedingungen
- Die Umsetzung der Substitutionsprogramme
- Die Codeinsubstitution
- Die Methadonsubstitution
- Beigebrauch
- zwei „Erfahrungsberichte“ von Betroffenen
- Die Substitution mit Subutex
- Die Heroinstudie
- Persönliche Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Opiate, den verschiedenen Substanzen, die in der Behandlung Opiatabhängiger eingesetzt werden, und den Entwicklungen in der Substitutionstherapie. Der Fokus liegt auf der Darstellung des historischen Kontextes, der Wirkmechanismen der Substanzen und der Herausforderungen bei der Umsetzung von Substitutionsprogrammen.
- Die Geschichte der Opiate und ihre Entwicklung von der Entdeckung des Morphins bis zum Heroin.
- Die verschiedenen Substanzen, die in der Behandlung von Opiatabhängigkeit eingesetzt werden (Methadon, Buprenorphin, etc.).
- Die Herausforderungen der Substitutionstherapie und die Entwicklung verschiedener Programme.
- Die gesellschaftlichen und politischen Aspekte des Opiatmissbrauchs.
- Erfahrungsberichte von Betroffenen.
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Geschichte und Entdeckung des Morphins und den daraus entstandenen Opiaten: Die Entdeckung des Morphins im Jahre 1804 durch Sertürner leitete eine neue Ära des Morphinismus ein. Opium, zuvor weit verbreitet als Schmerzmittel und Rauschmittel, wurde nun auf seine wirksame Komponente reduziert. Die anfängliche Hoffnung, mit Morphin die positiven Effekte von Opium ohne die Suchtgefahr zu erzielen, zerschlug sich schnell. Die Entwicklung der Injektionsspritze verschlimmerte das Problem sogar noch. Der deutsch-französische Krieg von 1870/71 und andere Konflikte brachten die Problematik der Morphiumabhängigkeit in das öffentliche Bewusstsein. Die wissenschaftliche Bestätigung der Suchtgefahr durch Lewin und die anschließende Entwicklung und Vermarktung von Heroin als „Wundermittel“ unterstreichen die komplexen und oft tragischen Entwicklungen im Umgang mit Opiaten.
Die „gängigsten“ Substanzen bei der Behandlung von Opiatabhängigen: Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über verschiedene Substanzen, die in der Behandlung von Opiatabhängigkeit eingesetzt werden. Es beschreibt die Eigenschaften und Wirkmechanismen von Opium, Morphium, Heroin, Codein, Dihydrocodein, Methadon, Buprenorphin, Benzodiazepine und Barbiturate. Der Schwerpunkt liegt auf deren Verwendung in Substitutionstherapien und ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Die Darstellung der unterschiedlichen Substanzen beleuchtet die Entwicklung der Behandlungsmethoden und die Suche nach effektiven und sicheren Alternativen zu den stärker suchtgefährdenden Substanzen. Die Zusammenstellung dient als Grundlage für das Verständnis der späteren Kapitel, die sich mit den verschiedenen Ansätzen der Substitutionstherapie befassen.
Substitution in den „Kinderschuhen“: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge der Substitutionstherapie. Es beschreibt die ersten Ansätze, die noch stark von einem eher moralischen als medizinischen Verständnis geprägt waren. Es werden die Rahmenbedingungen geschildert, unter denen die ersten Programme entstanden und umgesetzt wurden. Die Beschreibung der frühen Codein- und Methadonsubstitution zeigt die Evolution der Therapieansätze und die Herausforderungen, die mit der Behandlung Opiatabhängiger verbunden sind. Es wird deutlich, wie die anfänglichen Programme und die zugrundeliegenden Konzepte sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben. Die Herausforderungen der Behandlung, wie z.B. Beigebrauch, wurden früh erkannt und beeinflussten die Weiterentwicklung der Therapie.
Die Substitution mit Subutex: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Substitutionstherapie mit Subutex (Buprenorphin). Es beschreibt den Wirkmechanismus des Medikaments und seine Rolle in der Behandlung von Opiatabhängigkeit. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile von Buprenorphin im Vergleich zu anderen Substitutionsmitteln wie Methadon. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Wirksamkeit und Sicherheit von Subutex sowie auf der praktischen Umsetzung der Therapie. Es werden Aspekte wie die Dosierung, die Überwachung der Patienten und mögliche Nebenwirkungen erörtert. Der Zusammenhang mit anderen Therapieansätzen und die langfristige Perspektive der Behandlung mit Subutex werden betrachtet.
Schlüsselwörter
Opiate, Morphin, Heroin, Sucht, Abhängigkeit, Substitutionstherapie, Methadon, Buprenorphin, Codein, Behandlung, Opiatabhängige, Entzug, Gesellschaftspolitik, Drogenmissbrauch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Eine umfassende Übersicht zur Opiatabhängigkeit und Substitutionstherapie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Geschichte der Opiate, den verschiedenen Substanzen, die in der Behandlung Opiatabhängiger eingesetzt werden, und den Entwicklungen in der Substitutionstherapie. Sie beleuchtet den historischen Kontext, die Wirkmechanismen der Substanzen und die Herausforderungen bei der Umsetzung von Substitutionsprogrammen, inklusive gesellschaftlicher und politischer Aspekte sowie Erfahrungsberichte Betroffener.
Welche Opiate werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Reihe von Opiaten, darunter Opium, Morphium, Heroin, Codein, Dihydrocodein, Methadon und Buprenorphin. Zusätzlich werden Benzodiazepine und Barbiturate erwähnt, die im Zusammenhang mit der Behandlung von Opiatabhängigkeit eingesetzt werden können.
Welche Aspekte der Geschichte der Opiate werden behandelt?
Die Arbeit beginnt mit der Entdeckung des Morphins im Jahr 1804 und verfolgt die Entwicklung der Opiate bis zum Heroin. Sie beleuchtet die anfänglichen Hoffnungen und die schnell darauf folgende Erkenntnis der Suchtgefahr, die Rolle von Kriegen (z.B. Deutsch-Französischer Krieg 1870/71) bei der Bekanntmachung des Problems und die Vermarktung von Heroin als „Wundermittel“.
Wie werden die verschiedenen Substanzen zur Behandlung von Opiatabhängigkeit beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Eigenschaften und Wirkmechanismen der genannten Substanzen, ihren Einsatz in Substitutionstherapien und die jeweiligen Vor- und Nachteile. Der Fokus liegt auf der Verwendung in der Substitutionstherapie und der Suche nach effektiven und sicheren Alternativen zu stärker suchtgefährdenden Substanzen.
Was wird in Bezug auf die Substitutionstherapie behandelt?
Die Arbeit behandelt die Substitutionstherapie von ihren Anfängen ("Kinderschuhen") mit den ersten, noch von moralischen Aspekten geprägten Ansätzen bis hin zur Substitution mit Subutex (Buprenorphin). Sie beleuchtet die Entwicklung von Codein- und Methadonsubstitution, Herausforderungen wie Beigebrauch und die Evolution der Therapieansätze im Laufe der Zeit.
Welche Rolle spielen Erfahrungsberichte?
Die Arbeit beinhaltet zwei Erfahrungsberichte von Betroffenen, um die persönlichen Perspektiven und die Realität der Opiatabhängigkeit und der Substitutionstherapie zu veranschaulichen.
Welche weiteren Themen werden behandelt?
Neben den oben genannten Punkten werden auch die Heroinstudie und eine persönliche Stellungnahme des Autors/der Autorin behandelt. Die gesellschaftlichen und politischen Aspekte des Opiatmissbrauchs werden ebenfalls angesprochen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Opiate, Morphin, Heroin, Sucht, Abhängigkeit, Substitutionstherapie, Methadon, Buprenorphin, Codein, Behandlung, Opiatabhängige, Entzug, Gesellschaftspolitik, Drogenmissbrauch.
Gibt es eine Kapitelzusammenfassung?
Ja, die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen, die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfassen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit den Themen Opiatabhängigkeit, Substitutionstherapie und den damit verbundenen gesellschaftlichen und medizinischen Aspekten auseinandersetzt. Aufgrund des detaillierten Inhalts kann sie auch für Fachleute im Gesundheitswesen relevant sein.
- Quote paper
- Michaela Wurster (Author), 2002, Neuere Entwicklungen in der Behandlung Opiatabhängiger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7546