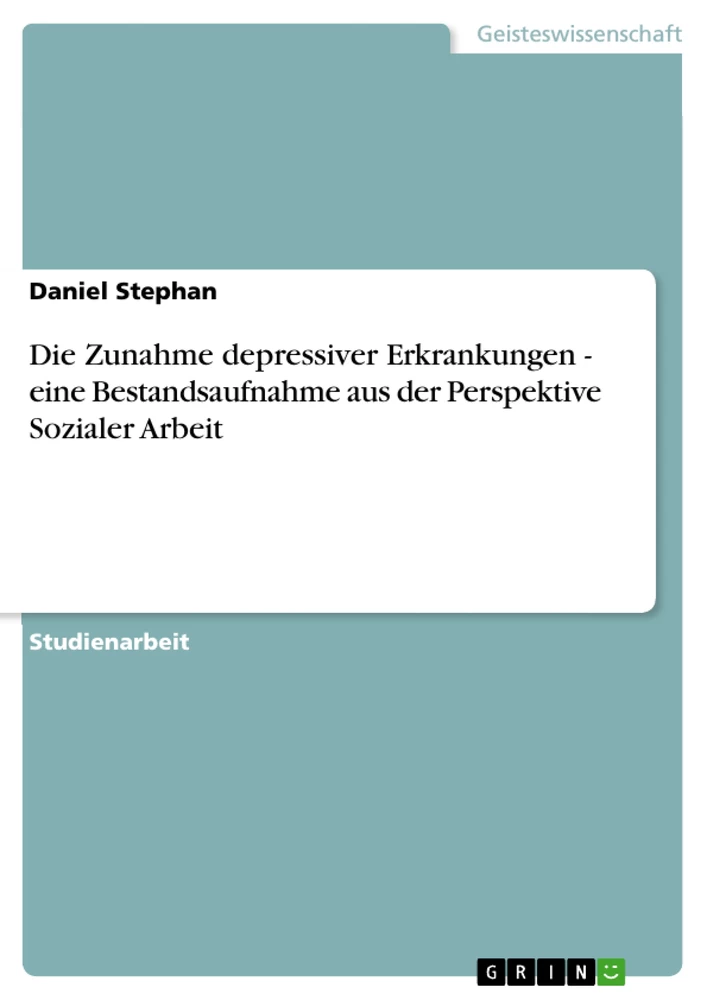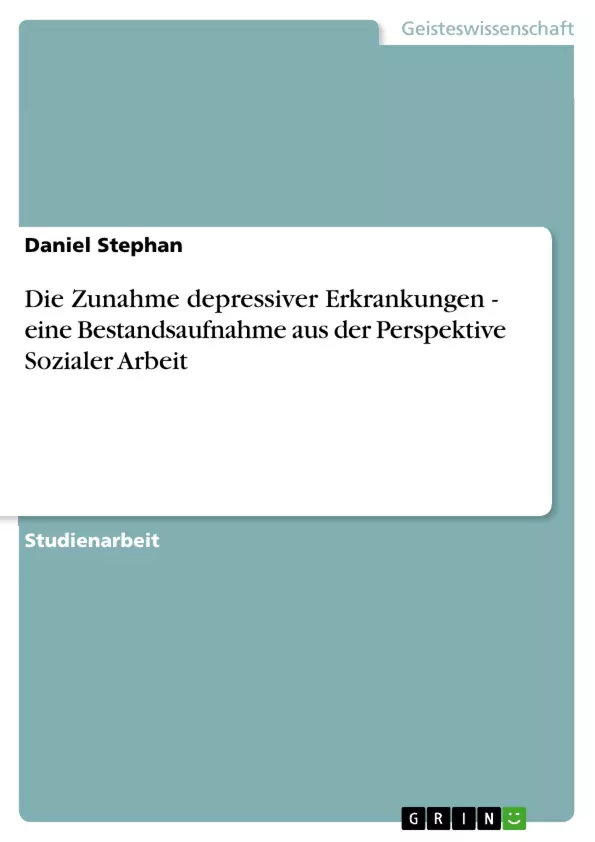Gibt es eine relevante Zunahme depressiver Erkrankungen? Diese Arbeit untersucht, aus der Perspektive Sozialer Arbeit und unter Einbeziehung neuester Erkenntnisse der Depressionsforschung die aktuelle Entwicklung. Die Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit der Situation in Deutschland, berücksichtigt aber auch die globale Entwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- Epidemie der Depression?
- Begriffsbestimmung, Diagnostische Kriterien
- Epidemiologie
- Frauen und Männer, welche Rolle spielt das Geschlecht?
- Volkswirtschaftliche Kosten der Depression
- Psychopharmaka
- Migration und kultureller Hintergrund
- Arbeitslosigkeit und sozioökonomischer Status
- Der gesellschaftliche Kontext
- Konsequenzen für Ausbildung und Praxis sozialer Arbeit
- Abschluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Zunahme depressiver Erkrankungen aus der Perspektive der Sozialen Arbeit. Sie setzt sich zum Ziel, die Frage zu untersuchen, ob tatsächlich von einem massiven Anstieg der Depression ausgegangen werden kann und welcher Teil dieses Anstiegs möglicherweise auf eine veränderte Sicht bzw. Definition von Depression zurückzuführen ist.
- Definition und diagnostische Kriterien der Depression
- Epidemiologie der Depression
- Soziokulturelle Faktoren, die zur Entstehung und Zunahme der Depression beitragen
- Konsequenzen der Depression für das Individuum und die Gesellschaft
- Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit und die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen
Zusammenfassung der Kapitel
- Epidemie der Depression?: Dieses Kapitel beleuchtet den Anstieg psychischer Erkrankungen, insbesondere der Depression, und untersucht die Frage, ob von einer globalen Epidemie ausgegangen werden kann.
- Begriffsbestimmung, Diagnostische Kriterien: In diesem Kapitel wird die Definition der Depression, die diagnostischen Kriterien und die Unterschiede zwischen den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV erläutert.
- Epidemiologie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbreitung der Depression und den Risikofaktoren, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Erkrankung verbunden sind.
- Frauen und Männer, welche Rolle spielt das Geschlecht?: Dieses Kapitel untersucht, wie das Geschlecht die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, beeinflusst.
- Volkswirtschaftliche Kosten der Depression: Hier werden die finanziellen Auswirkungen der Depression auf die Gesellschaft beleuchtet.
- Psychopharmaka: Dieses Kapitel behandelt die Rolle von Psychopharmaka in der Behandlung der Depression.
- Migration und kultureller Hintergrund: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Migration und kulturellem Hintergrund auf das Auftreten von Depression.
- Arbeitslosigkeit und sozioökonomischer Status: Hier werden die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit und sozioökonomischem Status auf die Depression beleuchtet.
- Der gesellschaftliche Kontext: Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftlichen Faktoren, die zur Entstehung und Zunahme der Depression beitragen.
- Konsequenzen für Ausbildung und Praxis sozialer Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der Depression auf die Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind: Depression, psychische Erkrankungen, Diagnostik, Epidemiologie, Soziale Arbeit, Ausbildung, Geschlechterunterschiede, sozioökonomische Faktoren, gesellschaftlicher Kontext, Volkswirtschaftliche Kosten.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine tatsächliche Zunahme depressiver Erkrankungen?
Studien zeigen einen Anstieg der Diagnosen, was teils auf reale Belastungen, teils auf eine sensibilisierte Wahrnehmung und veränderte diagnostische Kriterien (ICD-10/DSM-IV) zurückzuführen ist.
Welche Rolle spielt das Geschlecht bei Depressionen?
Frauen erhalten häufiger die Diagnose Depression, was sowohl biologische als auch soziokulturelle Gründe (Rollenbilder, Doppelbelastung) haben kann.
Wie beeinflusst der sozioökonomische Status das Depressionsrisiko?
Arbeitslosigkeit, Armut und ein niedriger Bildungsstand korrelieren stark mit einem höheren Risiko, an einer Depression zu erkranken.
Warum ist das Thema für die Soziale Arbeit relevant?
Sozialarbeiter sind oft die ersten Ansprechpartner für Betroffene. Sie unterstützen bei der Bewältigung sozialer Folgen der Krankheit und fördern die gesellschaftliche Teilhabe.
Was sind die volkswirtschaftlichen Kosten der Depression?
Die Kosten entstehen durch Behandlungskosten sowie indirekt durch Arbeitsausfälle, Frühverrentungen und Produktivitätsverluste.
- Citar trabajo
- Daniel Stephan (Autor), 2007, Die Zunahme depressiver Erkrankungen - eine Bestandsaufnahme aus der Perspektive Sozialer Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75435