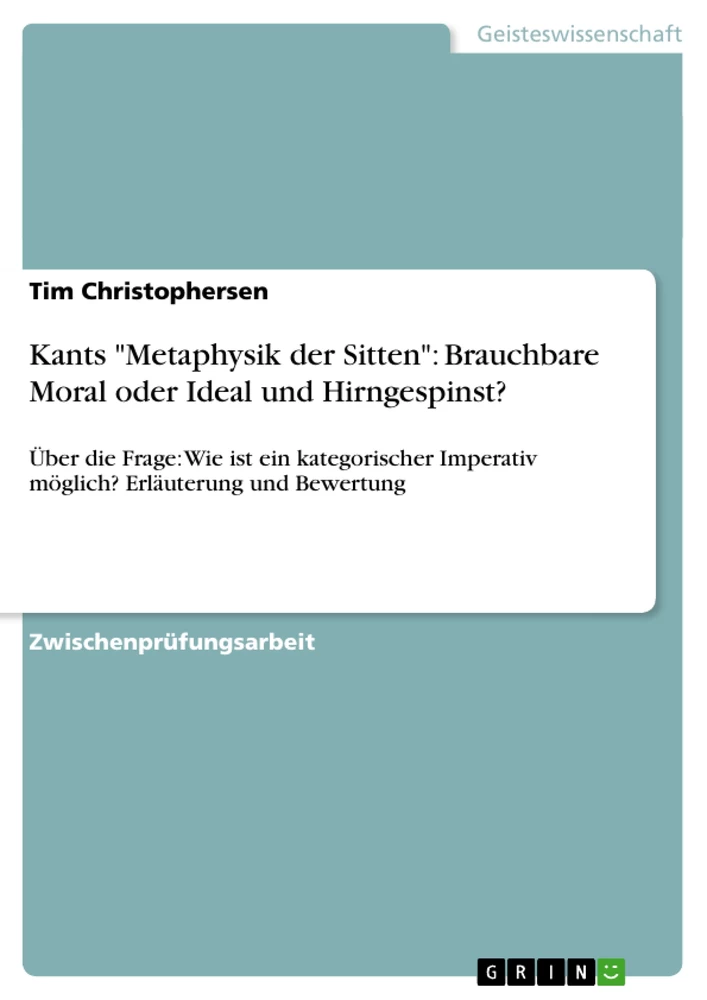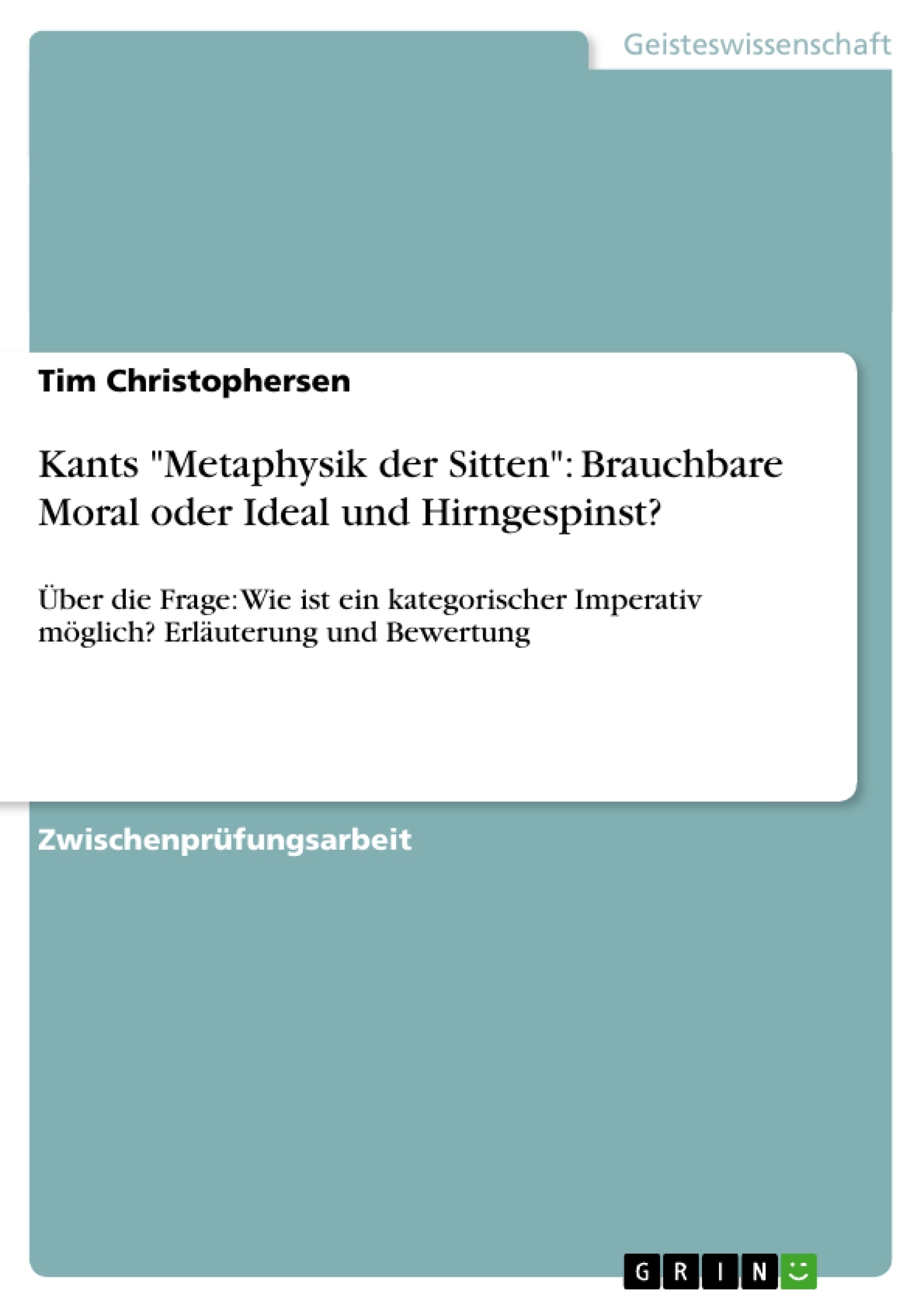Das Feld ethischer Konzeptionen ist weit und in vielerlei Hinsicht klaffen ebenfalls die Vorstellungen über diese weit auseinander. Es gibt wohl aber in praktischer Hinsicht vernünftigerweise nicht zurückweisbare Grundvoraussetzungen, die eine Moraltheorie zu leisten im Stande sein sollte. Ad hoc stellen sich meines Erachtens folgende Fragen an die Moral, die sich im Hange dieser Grundvoraussetzungen ergeben: I.) Ist die Theorie anwendbar? II.) Ist sie realisierbar? III.) Worin besteht für die Menschen die Motivation zur Befolgung dieser Moraltheorie?
In der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ sieht Kant die erste Frage durch die „Aufsuchung […] des obersten Prinzips der Moralität“ (Vgl. 392), des kategorischen Imperativs beantwortet. In seiner allgemeinsten Formel lautet er: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“. (GMS 421). Das Prinzip, dass uns Kant damit vorstellt, beansprucht also gewissermaßen Universalität seiner Kausalität, was ein äußerst wünschenswertes Kriterium an der Moral ist. Das bedeutet aber auch, dass Kant begründen muss - und damit kommen wir zur zweiten Frage -, wie dieses Prinzip sinnvoll zu bewerkstelligen ist und woraus der Universalitätsanspruch seine Geltung schöpft. Kant ist der Meinung, dass ein moralisches Gesetz „absolute Notwendigkeit bei sich führen“ und daher „von allem, was nur empirisch sein mag […], völlig gesäubert“ sein müsse (beide GMS 389). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, untersucht er „die Idee und Prinzipien eines möglichen reinen Willens“ (GMS 390). Das Prinzip des reinen Willens - also der kategorische Imperativ - ist ausschließlich und hebt sich dadurch von hypothetischen, d.h. auf einen anderen Zweck als die Moral selbst gerichteten, Imperativen ab, dass es dem Willen des Vernunftwesens selbst entspringt. Warum wir uns aber dieses sittliche Gesetz selbst auferlegen sollten – womit wir bei der Frage nach der Motivation zum moralischen Handeln angelangt wären – ist damit noch nicht gesagt. Diese Frage, auf die Kant vor allem im dritten Abschnitt der GMS versucht eine Antwort zu geben, ist der größere Gegenstand dieser Untersuchung. Im Hange aber des Titels dieser Untersuchung – „Die GMS: brauchbare Moral oder Ideal und Hirngespinst?“ -, der sich aus Kants Frage, „wie […] ein kategorischer Imperativ möglich [sei]“ (GMS 453), ergibt, wird die Untersuchung nicht umhin kommen, in einem Exkurs noch den Bereich der Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs kurz zu umreißen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 2.1 Warum gilt der kategorische Imperativ?
- a) Warum können Menschen moralisch sein?
- 2.1.1 Das Fundament für die Möglichkeit zur Beantwortung der Frage nach der Gültigkeit des kategorischen Imperativs. Das Verhältnis von Autonomie und Moral.
- 2.1.2 Warum ist der autonome Wille ein freier Wille? - Die Idee der Freiheit.
- 2.1.3 Können Menschen überhaupt frei sein? - Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Determinismus und Freiheit.
- b) Warum sollten Menschen moralisch sein?
- 2.1.4 Vom Interesse am und der Möglichkeit des kategorischen Imperativs. - Die Geltungsfrage und die äußerste Grenze der praktischen Philosophie.
- 2.1.5 Fragen im Anschluss an die Deduktion des kategorischen Imperativs.
- 2.2 Exkurs: Praxisferner Imperativ? - Der Bereich der Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs.
- 3. Fazit und Schlussanmerkungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ und analysiert den kategorischen Imperativ. Sie befasst sich mit der Frage, warum der kategorische Imperativ gilt und ob er in der Praxis anwendbar ist. Die Arbeit beleuchtet die Beziehung zwischen Autonomie und Moral sowie die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens.
- Der kategorische Imperativ als oberstes Prinzip der Moralität
- Das Verhältnis von Autonomie und Moral
- Die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens
- Die Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs in der Praxis
- Kritik an Kants Theorie und mögliche Schwächen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Grundvoraussetzungen einer Moraltheorie vor und fokussiert sich auf die drei Fragen nach Anwendbarkeit, Realisierbarkeit und Motivation zur Befolgung. Sie führt den kategorischen Imperativ als Kants Antwort auf die erste Frage ein und verdeutlicht die Notwendigkeit, seine Geltung und Anwendbarkeit zu begründen.
2.1 Warum gilt der kategorische Imperativ?
a) Warum können Menschen moralisch sein?
Dieser Abschnitt untersucht die Voraussetzungen für die Möglichkeit moralischer Handlungen. Er analysiert das Verhältnis von Autonomie und Moral und stellt die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens. Kant postuliert die Idee eines „Reichs der Zwecke“, in dem jeder zugleich Untertan und Gesetzgeber ist, und betont die Würde des Einzelnen als Zweck an sich selbst.
b) Warum sollten Menschen moralisch sein?
Dieser Abschnitt widmet sich der Frage nach der Motivation zum moralischen Handeln. Er beleuchtet das Interesse am und die Möglichkeit des kategorischen Imperativs sowie die Frage nach seiner Geltung. Kant argumentiert, dass ein moralisches Gesetz „absolute Notwendigkeit bei sich führen“ muss und von allen empirischen Einflüssen „völlig gesäubert“ sein soll.
2.2 Exkurs: Praxisferner Imperativ? - Der Bereich der Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs.
Dieser Exkurs beleuchtet die Frage, ob der kategorische Imperativ in der Praxis anwendbar ist. Er setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, ob Kants Theorie in der realen Welt umsetzbar ist.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, Autonomie, Moral, Freiheit, Wille, Reich der Zwecke, Pflicht, Maxime, deontologische Ethik, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kant, Universalität, Anwendbarkeit.
- Quote paper
- Tim Christophersen (Author), 2007, Kants "Metaphysik der Sitten": Brauchbare Moral oder Ideal und Hirngespinst? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75327