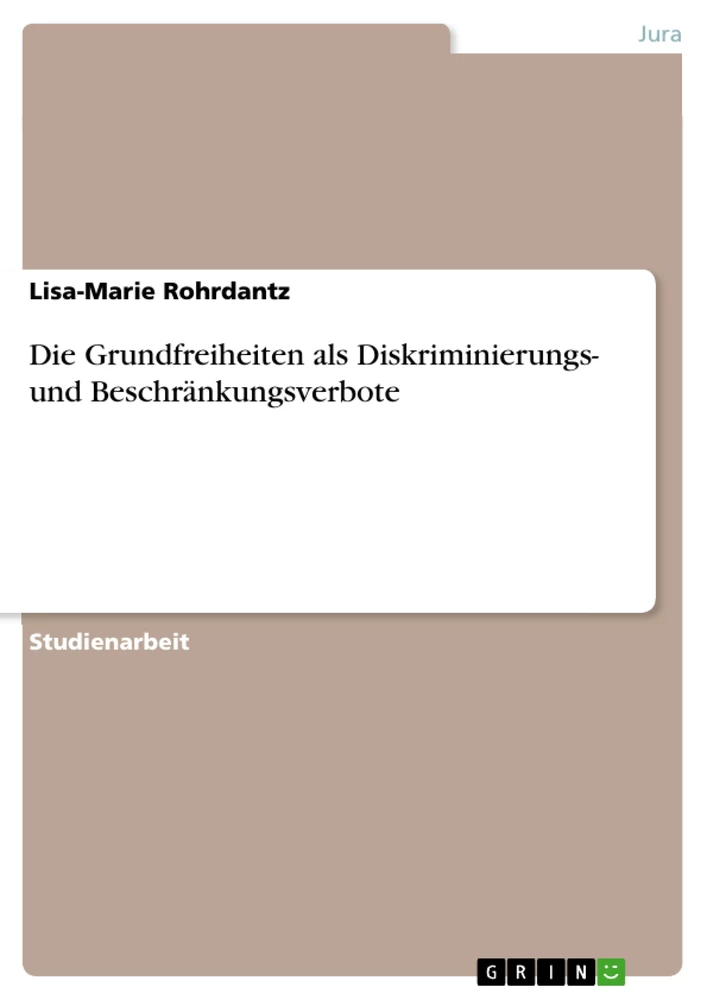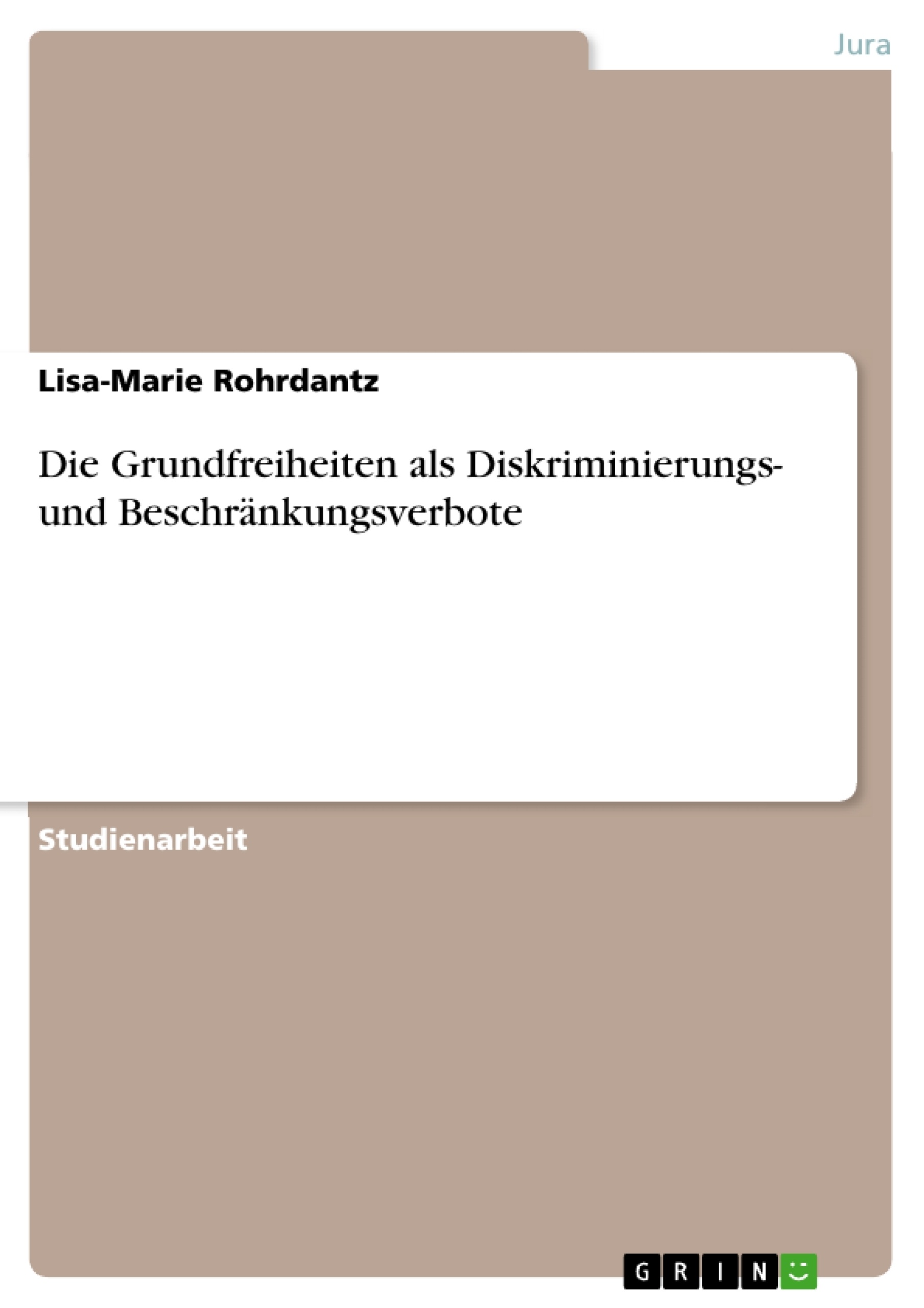Die Grundfreiheiten der EG bilden einen essentiellen Teil der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), die im EG-Vertrag geregelt sind . Die Europäische Gemeinschaft sollte ursprünglich vorrangig eine Wirtschaftseinheit sichern, deren Ziel es war, innerhalb der Europäischen Gemeinschaft „Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen“. Die Grundfreiheiten gewinnen vor allem durch den Hintergrund des angestrebten Binnenmarktes i.S.v. Art. 14 Abs. 2 EG, der sowohl Marktfreiheit als auch Marktgleichheit fordert, an Bedeutung und stellen zudem ein „Grundgerüst“ für die Verwirklichung dieser Idee dar. Das Gewicht der Grundfreiheiten wird infolgedessen in der juristischen Literatur sehr hoch eingeschätzt.
Diese Arbeit widmet sich dieser Schlüsselrolle der Grundfreiheiten in der EG, und soll zeigen, dass diese einen wesentlichen Bestandteil in der europäischen Integration einnehmen . Dabei wird auch auf die Problematik einer fehlenden Dogmatik der Grundfreiheiten eingegangen. Nach einer allgemeinen Vorstellung der Auslegung der Grundfreiheiten, wie sie aus der Rechtsprechung des EuGH hervorgeht, wobei insbesondere gezeigt werden soll, in wie weit sich die Grundfreiheiten in der EG als Diskriminierungs- bzw. Beschränkungsverbote beschreiben lassen, soll die Veränderung ihrer Bedeutung betrachtet werden, die sich aufgrund einer abweichenden Rechtsprechung des EuGH ab Mitte der 90er Jahre ergab . Die Veränderungen, die in dem Bereich der Grundfreiheiten in der Rechtsprechung des EuGH stattgefunden haben, lösten Prozesse aus, die bis dato keineswegs abgeschlossen sind. So kam es zu einer Ausweitung der Grundfreiheiten als Verbote von offenen, unmittelbaren Diskriminierungen auf Verbote, welche ebenfalls versteckte, mittelbare Diskriminierungen untersagen und mittlerweile darüber hinaus als allgemeine oder spezifische Beschränkungsverbote ausgelegt werden . Im Weiteren soll im Rahmen dieser Arbeit diskutiert werden, in wie weit ein einheitliches System der Grundfreiheiten verwirklicht werden konnte und in diesem Zusammenhang von einer zunehmenden „Konvergenz der Grundfreiheiten“ gesprochen werden kann. In der Schlussbetrachtung wird abschließend die Bedeutung der Grundfreiheiten im 21. Jahrhundert erläutert sowie ihr Verhältnis zu den EU-Grundrechten beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung: Die Grundfreiheiten der Europäischen Gemeinschaft (EG)
- 1. Die fehlende Dogmatik der Grundfreiheiten
- 2. Anwendung und Funktion der Grundfreiheiten
- 2.1 Unmittelbare Geltung und Anwendbarkeit
- 2.2 Der Vorrang der Grundfreiheiten
- 2.3 Das grenzüberschreitende Element und die Inländerdiskriminierung
- 2.4 Drittwirkung der Grundfreiheiten
- 2.6 Die Grundfreiheiten und das allgemeine Diskriminierungsverbot des Art. 12 EG
- 3. Die Grundfreiheiten
- 3.1 Die Freiheit des Warenverkehrs (Art. 23-31 EG)
- 3.2.2 Die Niederlassungsfreiheit (Art. 43-48 EG)
- 3.3 Die Dienstleistungsfreiheit (Art. 49-55 EG)
- 3.4 Der freie Kapital- und Zahlungsverkehr (Art. 56-60 EG)
- 4. Zusammenfassung: Die Grundfreiheiten als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote
- B Die Grundfreiheiten als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote
- I Die Grundfreiheiten im Überblick
- II Veränderungen in der Auslegung der Grundfreiheiten in den 90er Jahren
- 1. Die analoge Anwendung der Keck-Rechtsprechung auf sämtliche Grundfreiheiten
- 2. Die Rechtfertigung von sonstigen Beschränkungen der Grundfreiheiten im Sinne der Cassis-Formel
- III Auswirkungen auf die Dogmatik der Grundfreiheiten
- A. Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich
- B. Eingriffsverbote (Schutzumfang)
- C. Eingriffsmöglichkeiten (Schranken)
- D. Schlussbetrachtung und Ausblick: Die Grundfreiheiten im System der Gemeinschaftsgrundrechte
- Die Grundfreiheiten als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote
- Die Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH bezüglich der Grundfreiheiten ab Mitte der 90er Jahre
- Die Auswirkungen der veränderten Rechtsprechung auf die Dogmatik der Grundfreiheiten
- Die Bedeutung der Grundfreiheiten im 21. Jahrhundert und ihr Verhältnis zu den EU-Grundrechten
- Die Konvergenz der Grundfreiheiten und die Möglichkeit eines einheitlichen Systems
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich der Schlüsselrolle der Grundfreiheiten der Europäischen Gemeinschaft (EG) und soll zeigen, dass die EG-Grundfreiheiten einen wesentlichen Bestandteil in der europäischen Integration einnehmen. Dabei wird auch auf die Problematik einer fehlenden Dogmatik der Grundfreiheiten eingegangen. Nach einer allgemeinen Vorstellung der Auslegung der Grundfreiheiten, soll die Veränderung ihrer Bedeutung betrachtet werden, die sich aufgrund einer abweichenden Rechtsprechung des EuGH ab Mitte der 90er Jahre ergab.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Grundfreiheiten der Europäischen Gemeinschaft (EG) ein und beleuchtet deren zentrale Bedeutung für die europäische Integration. Sie geht auf die unterschiedlichen Bereiche der Grundfreiheiten ein und erläutert deren Funktion als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote.
Kapitel I stellt die Grundfreiheiten im Überblick vor und analysiert die fehlende Dogmatik, sowie die Anwendung und Funktion der Grundfreiheiten. Es werden die einzelnen Grundfreiheiten im Detail besprochen, wobei der Fokus auf die Rolle als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote gelegt wird.
Kapitel II beleuchtet die Veränderungen in der Auslegung der Grundfreiheiten in den 90er Jahren, insbesondere die analoge Anwendung der Keck-Rechtsprechung auf sämtliche Grundfreiheiten und die Rechtfertigung von sonstigen Beschränkungen der Grundfreiheiten im Sinne der Cassis-Formel.
Kapitel III untersucht die Auswirkungen der veränderten Rechtsprechung auf die Dogmatik der Grundfreiheiten und entwirft ein allgemeines, sämtliche Grundfreiheiten umfassendes Prüfungsschema. Es werden die persönlichen und sachlichen Anwendungsbereiche, die Eingriffsverbote und die Eingriffsmöglichkeiten der Grundfreiheiten betrachtet.
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die Bedeutung der Grundfreiheiten im System der Gemeinschaftsgrundrechte. Sie geht auf die Frage ein, ob die Grundfreiheiten als „wirtschaftliche Grundrechte“ bezeichnet werden können und diskutiert deren Rolle in einer zukünftigen EU-Verfassung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Grundfreiheiten der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere mit ihrer Funktion als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote. Es werden die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die Keck-Rechtsprechung, die Cassis-Formel, die Konvergenz der Grundfreiheiten, die Dogmatik der Grundfreiheiten und die Gemeinschaftsgrundrechte thematisiert.
- Quote paper
- Lisa-Marie Rohrdantz (Author), 2007, Die Grundfreiheiten als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbote, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75010