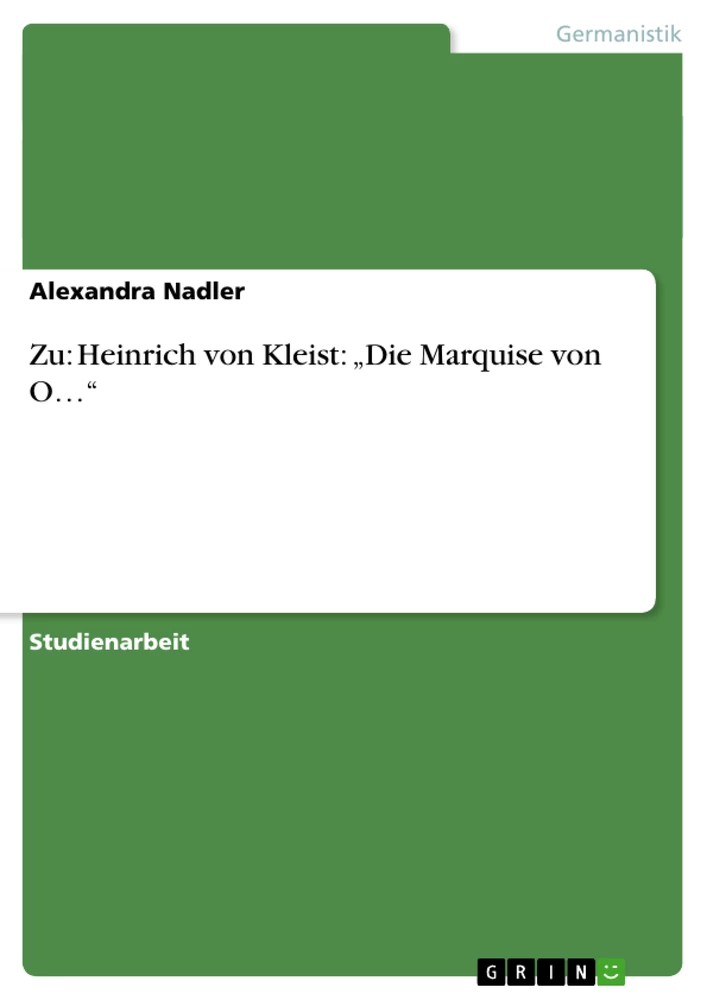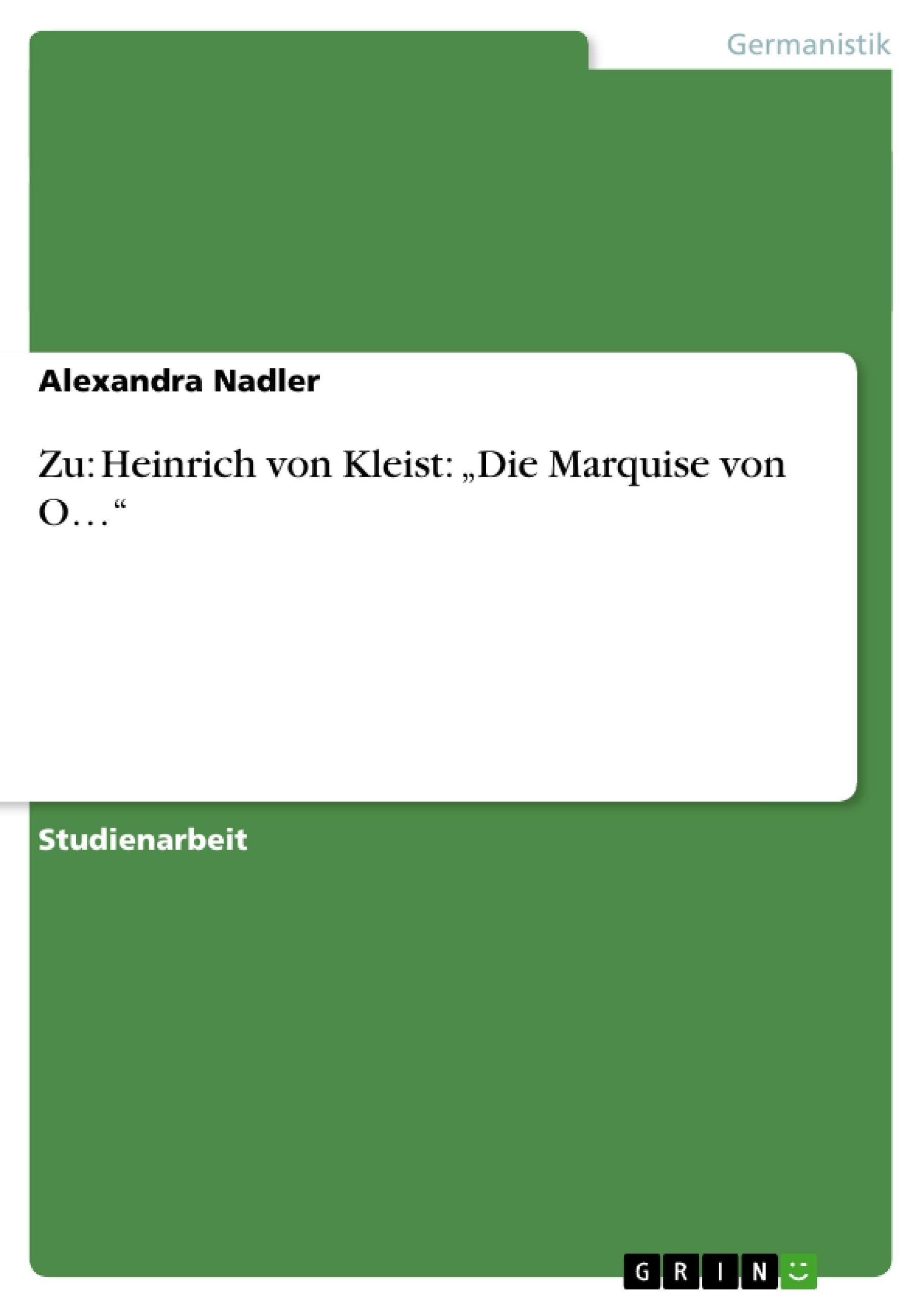1. Einleitung
Heinrich von Kleists Erzählung „Die Marquise von O…“ handelt von einem „ungeheuerlichen Ereignis“, der Vergewaltigung der Marquise ohne ihr Wissen in einem Zustand der Bewusstlosigkeit bzw. der Ohnmacht.
Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich den historischen Wandel des Begriffs der Vergewaltigung in Deutschland nachzeichnen und dabei den Schwerpunkt auf die Handhabung eines solchen Verbrechens in der Rechtspraxis legen. Dabei werde ich zunächst einen Überblick über die Geschichte der Vergewaltigung und das Verhältnis der Gesellschaft zu dieser Straftat geben.
Als nächstes werde ich näher auf die Constitutio Criminalis Carolina von 1532, Tit. X der Kurfürstlich Sächsischen Landesordnung vom 1. September 1666, das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 und das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 eingehen. Darauf folgt schließlich eine kurze Darstellung der Rechtslage in Deutschland in den Jahren 1973 bis 1981, sowie 1981 bis heute.
Im zweiten Teil der Arbeit analysiere ich das Motiv der Vergewaltigung in der „Marquise von O…“. Ich gehe dabei vor allem auf die Frage der Möglichkeit einer Vergewaltigung in einem Zustand der Bewusstlosigkeit ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rechtsgeschichte der Vergewaltigung in Deutschland
- Überblick
- Die Constitutio Criminalis Carolina von 1532
- Tit. X der Kurfürstlich Sächsischen Landesordnung vom 1. September 1666
- Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, 1794
- Das Reichsstrafgesetzbuch von 1871
- Die Jahre 1973 bis 1981
- Die Jahre von 1981 bis heute
- Interpretation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, den historischen Wandel des Begriffs der Vergewaltigung in Deutschland nachzuzeichnen und die Handhabung dieses Verbrechens in der Rechtspraxis zu beleuchten. Dabei soll die Entwicklung der Rechtsprechung von der Constitutio Criminalis Carolina bis zur heutigen Zeit aufgezeigt werden.
- Der historische Wandel der rechtlichen Definition und Bewertung von Vergewaltigung
- Die Rolle der Frau im Strafrecht im Kontext von Vergewaltigung
- Die Bedeutung der gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen für die Rechtsentwicklung
- Die Interpretation des Vergewaltigungsmotivs in Kleists "Die Marquise von O..."
- Die Frage der Möglichkeit einer Vergewaltigung im Zustand der Bewusstlosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt eine kurze Einführung in das Thema der Arbeit und stellt die Problematik der Vergewaltigung in Kleists "Die Marquise von O..." vor.
Das Kapitel "Die Rechtsgeschichte der Vergewaltigung in Deutschland" befasst sich mit der Entwicklung des deutschen Strafrechts in Bezug auf das Vergewaltigungsdelikt. Es wird ein Überblick über die rechtliche Handhabung der Vergewaltigung von der mittelalterlichen Zeit bis ins 20. Jahrhundert gegeben. Dabei werden verschiedene Rechtsquellen, wie die Constitutio Criminalis Carolina und das Allgemeine Landrecht, analysiert.
Der Abschnitt "Überblick" behandelt die allgemeine Entwicklung des Verständnisses von Vergewaltigung im deutschen Strafrecht. Das Kapitel "Die Constitutio Criminalis Carolina von 1532" beleuchtet die Bedeutung dieses Gesetzes für die Strafrechtsgeschichte in Deutschland.
Schlüsselwörter
Vergewaltigung, Rechtsgeschichte, Strafrecht, Geschlechterverhältnisse, Mediäval, Moderne, Constitutio Criminalis Carolina, Allgemeine Landrecht, Marquise von O..., Heinrich von Kleist, Bewusstlosigkeit, Schuld, Opfer, Täter.
- Citar trabajo
- Alexandra Nadler (Autor), 2006, Zu: Heinrich von Kleist: „Die Marquise von O…“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74838