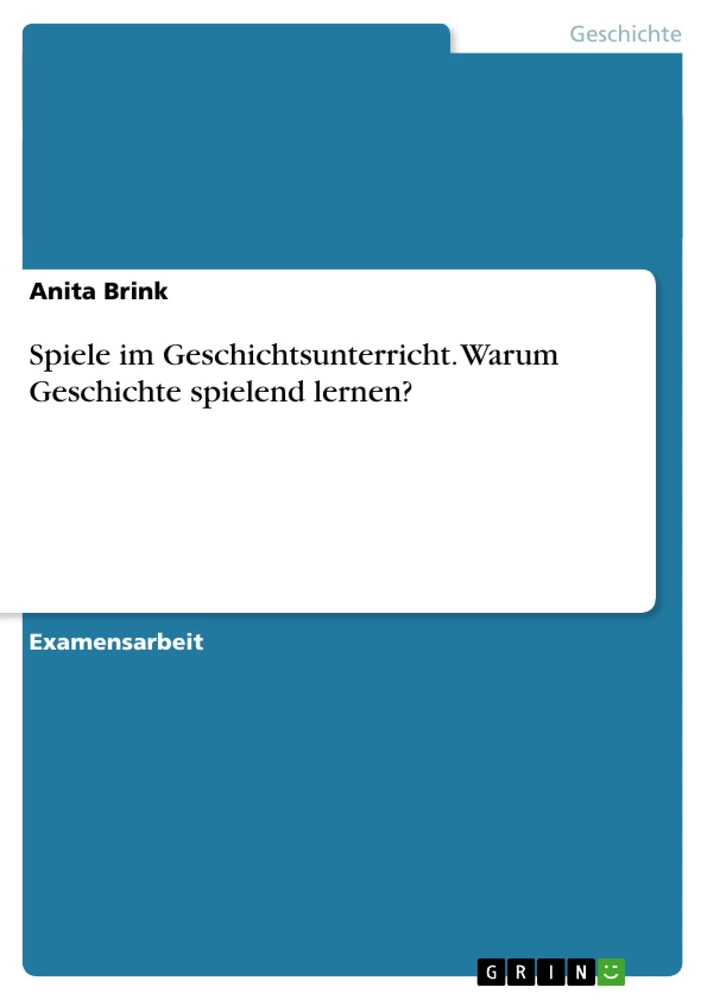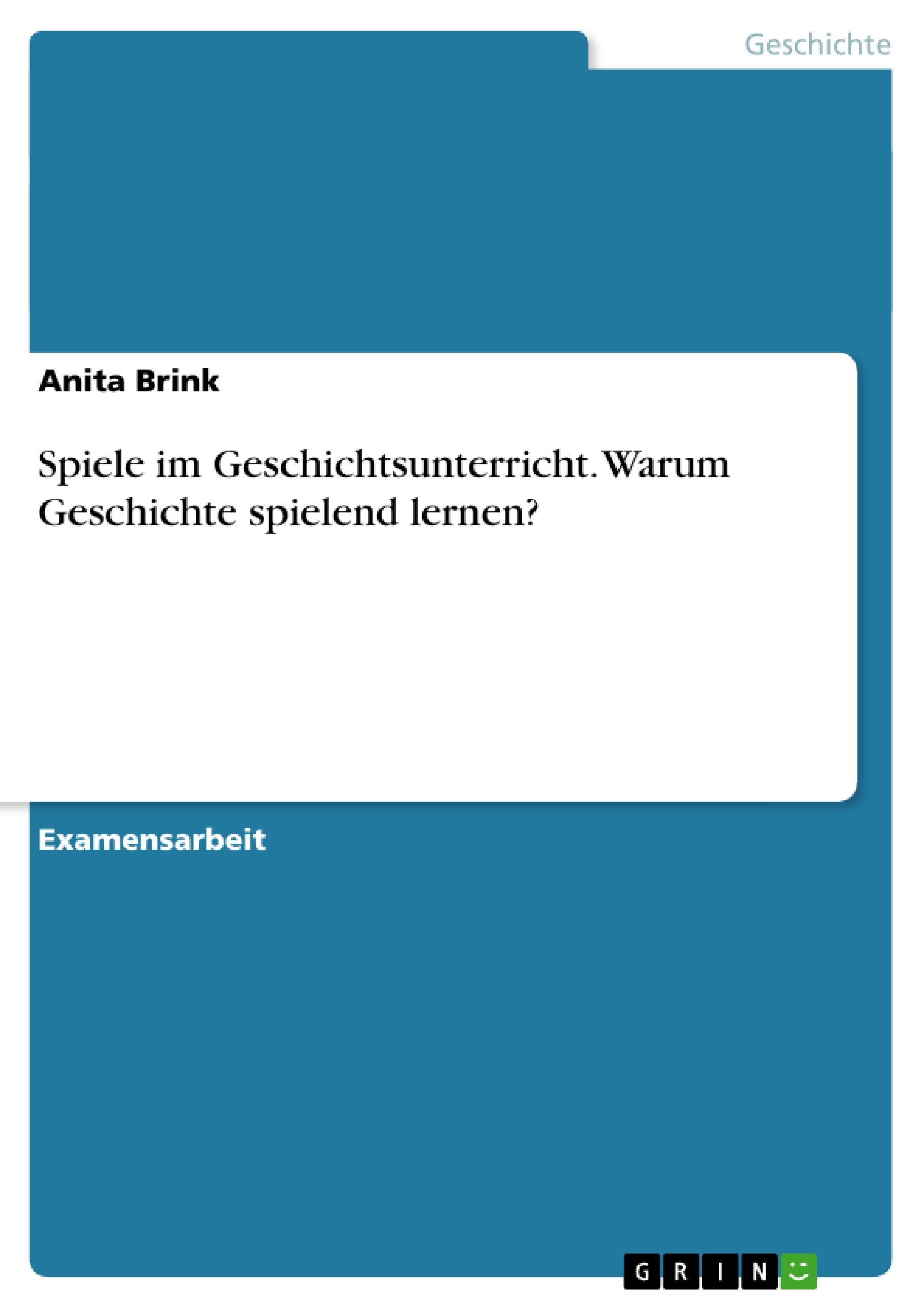Die vorliegende Hausarbeit behandelt das Spielen im Geschichtsunterricht.
Mich haben folgende Bilder und Eindrücke, die immer wieder zu beobachten sind zu der Beschäftigung mit Spielen im Geschichtsunterricht aufgefordert:
Zwei Kinder sehen sich beim freien Spielen in den Rollen eines Ritters und seines Knappen. Mit detaillierter Gewissenhaftigkeit wird die ihnen zur Verfügung stehende Umgebung den – aus der Sicht der Spielenden – vermeintlichen Charakteristika der damaligen Zeit angepasst. Sie bauen sich seine Burg mit Türmen, Tor und Graben; sie „verkleiden“ sich als Ritter und Knappe und fertigen ein „Ritterwappen“ an. Eine von ihnen ausgedachte Situation wird letztendlich nachgespielt.
Ein Kind stellt mit Hilfe seiner „Playmobil-Figuren“ den griechischen Stadtstaat Athen nach. Genauestens werden den einzelnen Figuren die verschiedenen Bevölkerungsschichten („das sind Sklaven, das sind hohe Herren, das sind Arbeiter“) angedacht. Nun beginnt ein Nachspielen eines imaginären Vorhabens.
Kinder spielen in ihrer Freizeit historische Figuren oder Ereignisse nach. Sie haben Spaß an der Bewegung, denken sich viele Details aus – aber versuchen auch, das Wissen aus dem Geschichtsunterricht in ihrem freien Spiel zu integrieren und zu verarbeiten.
Wieso wird diese Spieltätigkeit und –bereitschaft der Kinder nicht von der Schule und den Lehrkräften aufgegriffen und integriert?
Mit meiner Hausarbeit nun möchte ich verschiedenen Fragen zum Einsatz von Spielen nachgehen, mögliche Missverständnisse ausräumen um letztendlich meine eingangs gestellte Frage „Warum Geschichte spielend lernen?“ zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: „Warum Geschichte spielend lernen?”
- 2. Didaktische Positionen im Geschichtsunterricht
- 2.1 Lern- und unterrichtsbezogene Ansätze
- 2.2 Schüler-, erziehungs- und bildungsorientierte Ansätze
- 2.3 Fach- und wissenschaftsgeleitete Ansätze
- 2.4 Gegenwarts- und gesellschaftsbezogene Ansätze
- 3. Die „Spielarbeit”
- 3.1 Definitionen „Spiel”
- 3.2 Spieldidaktik
- 3.3 Spielformen im Überblick
- 3.3.1 Lernspiele
- 3.3.2 Szenische Darstellungen
- 3.3.3 Projektorientierte Aktivitäten
- 3.4 Das Spiel als Unterrichtseinstieg
- 3.5 Spielen im Sekundarbereich I und II
- 3.6 Methodik der „Spielarbeit” in der szenischen Darstellung
- 3.7 Motivation und Einführung in das szenische Spiel
- 4. Das Rollenspiel
- 4.1 Unterrichtsstunde: Die Stadt im Bauernkrieg
- 4.1.1 Beschreibung der Schule und der Klasse
- 4.1.2 Unterrichtsentwurf
- 4.1.3 Tatsächlicher Unterrichtsverlauf
- 4.1.4 Ergebnisse der Nachbesprechung
- 4.2 Persönlicher Kommentar zum Einsatz und Verlauf des Rollenspieles
- 4.1 Unterrichtsstunde: Die Stadt im Bauernkrieg
- 5. Fazit
- 5.1 Probleme und Kritiken
- 5.1.1 Interview mit zwei Geschichtslehrerinnen
- 5.2 Didaktisch-methodische Überlegungen zum Einsatz des Rollenspieles im Geschichtsunterricht
- 5.3 Voraussetzungen
- 5.3.1 Lehrkraft und Kollegium
- 5.3.2 Schüler und Schülerinnen
- 5.3.3 Klassenraum, Ausstattung und Sitzordnung
- 5.4 Zukunftsmöglichkeiten und Perspektiven
- 5.1 Probleme und Kritiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einsatz von Spielen im Geschichtsunterricht. Ziel ist es, die Frage „Warum Geschichte spielend lernen?” zu beantworten, indem verschiedene didaktische Positionen beleuchtet und die „Spielarbeit” mit ihren verschiedenen Spielformen und der Methodik der szenischen Darstellung erklärt werden. Ein selbst durchgeführtes Rollenspiel dient als Praxisbeispiel. Schließlich werden Probleme, Voraussetzungen und Zukunftsperspektiven des spielerischen Geschichtsunterrichts diskutiert.
- Didaktische Ansätze im Geschichtsunterricht
- Definition und Didaktik des Spiels
- Verschiedene Spielformen im Geschichtsunterricht
- Praxisbeispiel: Rollenspiel im Unterricht
- Voraussetzungen und Zukunftsperspektiven des spielerischen Geschichtsunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: „Warum Geschichte spielend lernen?”: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt Beobachtungen von Kindern, die historisches Wissen spielerisch verarbeiten. Die Arbeit stellt die zentrale Frage nach dem Nutzen des spielerischen Lernens im Geschichtsunterricht und skizziert den Aufbau der Hausarbeit. Sie hebt die Bedeutung des Geschichtsunterrichts für die Entwicklung von Problembewusstsein und historischer Kompetenz hervor und verweist auf die acht Einzelkompetenzen des historischen Lernens nach H. Raisch (z.B. emotive, ästhetische Kompetenz).
2. Didaktische Positionen im Geschichtsunterricht: Dieses Kapitel analysiert verschiedene didaktische Ansätze im Geschichtsunterricht. Es werden lern- und unterrichtsbezogene, schüler-, erziehungs- und bildungsorientierte, fach- und wissenschaftsgeleitete sowie gegenwarts- und gesellschaftsbezogene Ansätze betrachtet und deren Relevanz für den Einsatz von Spielen im Unterricht diskutiert. Die verschiedenen Perspektiven bilden den theoretischen Rahmen für die spätere Auseinandersetzung mit der „Spielarbeit”.
3. Die „Spielarbeit”: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Didaktik von Spiel im Unterricht. Es werden verschiedene Spielformen wie Lernspiele, szenische Darstellungen und projektorientierte Aktivitäten vorgestellt und im Kontext des Geschichtsunterrichts analysiert. Die Kapitelteile betonen die Bedeutung der Motivation und Einführung in das szenische Spiel, sowie die spezifischen methodischen Aspekte für den Einsatz im Sekundarbereich.
4. Das Rollenspiel: Dieses Kapitel beschreibt ein konkretes Rollenspiel zum Thema „Die Stadt im Bauernkrieg“, das von der Autorin in einer siebten Realschulklasse durchgeführt wurde. Es enthält eine detaillierte Beschreibung der Schule, der Klasse, des Unterrichtsentwurfs, des tatsächlichen Unterrichtsverlaufs und der Ergebnisse der Nachbesprechung. Der persönliche Kommentar der Autorin reflektiert den Einsatz und Verlauf des Rollenspiels.
Schlüsselwörter
Spiele im Geschichtsunterricht, Spieldidaktik, Rollenspiel, historische Kompetenz, Didaktische Ansätze, Lernmethoden, Szenische Darstellung, Motivation, Problembewusstsein, Schülerorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Geschichte spielend lernen?"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einsatz von Spielen, insbesondere Rollenspielen, im Geschichtsunterricht. Sie beleuchtet die didaktischen Grundlagen und methodischen Ansätze, um die Frage zu beantworten, warum Geschichte spielerisch gelernt werden sollte.
Welche didaktischen Ansätze werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene didaktische Ansätze im Geschichtsunterricht, darunter lern- und unterrichtsbezogene, schüler-, erziehungs- und bildungsorientierte, fach- und wissenschaftsgeleitete sowie gegenwarts- und gesellschaftsbezogene Ansätze. Diese bilden den theoretischen Rahmen für die Untersuchung der "Spielarbeit".
Was versteht die Arbeit unter "Spielarbeit"?
Die "Spielarbeit" umfasst verschiedene Spielformen wie Lernspiele, szenische Darstellungen und projektorientierte Aktivitäten im Geschichtsunterricht. Die Arbeit erklärt die Didaktik des Spiels und die Methodik der szenischen Darstellung, insbesondere für den Einsatz im Sekundarbereich.
Welches Praxisbeispiel wird vorgestellt?
Ein ausführliches Praxisbeispiel ist ein Rollenspiel zum Thema "Die Stadt im Bauernkrieg", das von der Autorin in einer siebten Realschulklasse durchgeführt wurde. Die Beschreibung umfasst den Unterrichtsentwurf, den tatsächlichen Ablauf und die Nachbesprechung mit einer Reflexion des Einsatzes und Verlaufs des Rollenspiels.
Welche Probleme und Kritiken werden angesprochen?
Die Arbeit diskutiert Probleme und Kritikpunkte zum Einsatz von Spielen im Geschichtsunterricht. Dazu gehören auch die Ergebnisse eines Interviews mit zwei Geschichtslehrerinnen.
Welche Voraussetzungen sind für den Einsatz von Spielen im Geschichtsunterricht notwendig?
Die Arbeit benennt die notwendigen Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von Spielen im Geschichtsunterricht. Dazu gehören Aspekte der Lehrkraft, des Kollegiums, der Schüler, des Klassenraums und der Ausstattung.
Welche Zukunftsperspektiven werden aufgezeigt?
Die Hausarbeit schließt mit einer Betrachtung der Zukunftsmöglichkeiten und Perspektiven des spielerischen Geschichtsunterrichts.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spiele im Geschichtsunterricht, Spieldidaktik, Rollenspiel, historische Kompetenz, Didaktische Ansätze, Lernmethoden, Szenische Darstellung, Motivation, Problembewusstsein, Schülerorientierung.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Didaktische Positionen im Geschichtsunterricht, Die "Spielarbeit", Das Rollenspiel und Fazit. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant beschreibt.
- Quote paper
- Anita Brink (Author), 2001, Spiele im Geschichtsunterricht. Warum Geschichte spielend lernen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7454