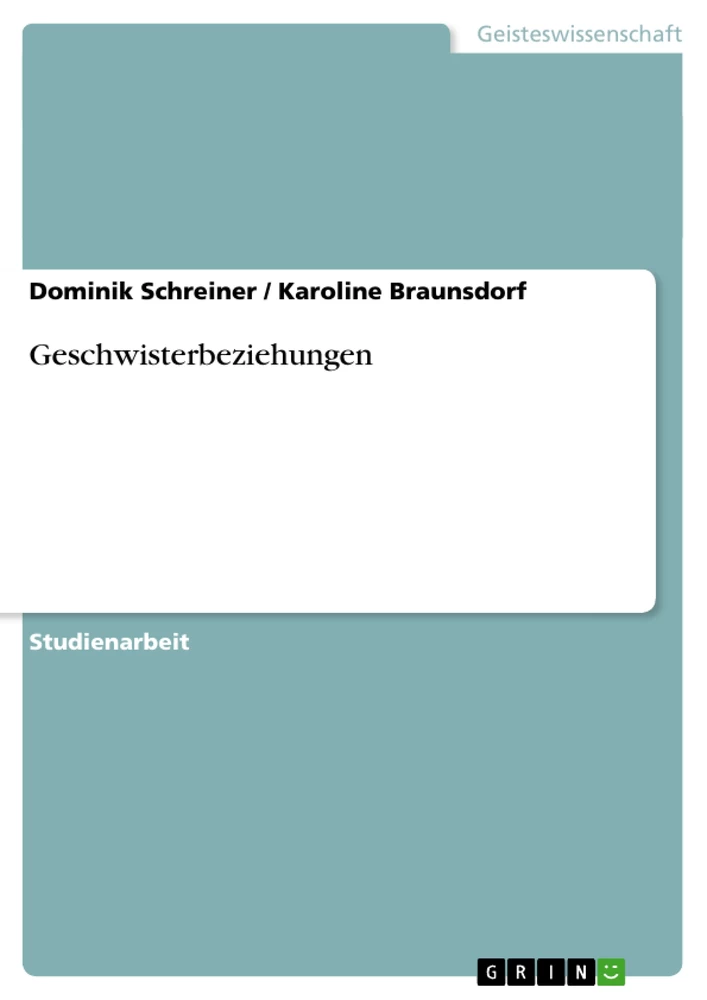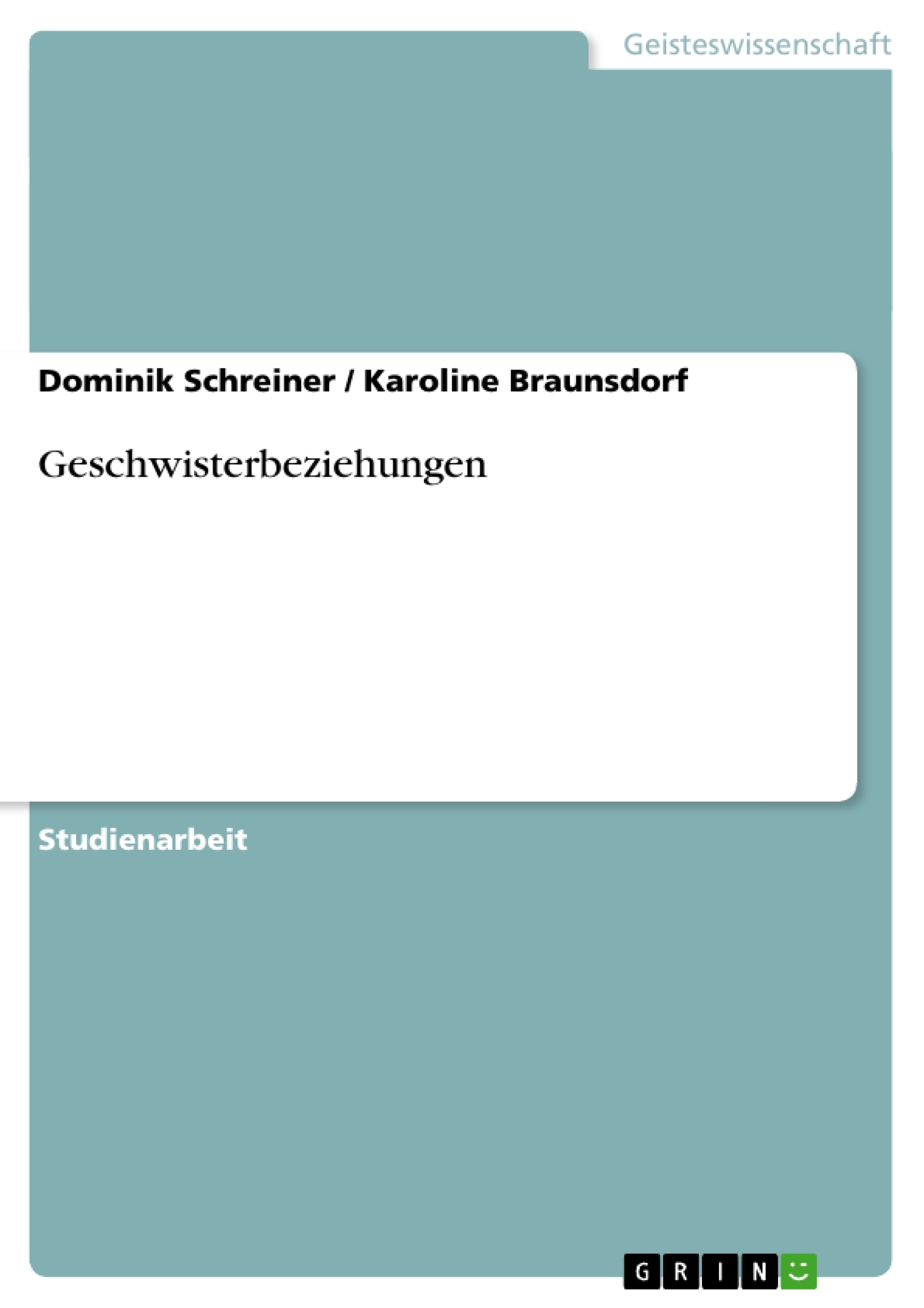Geschwisterbeziehungen sind eine besondere Art zwischenmenschlicher Beziehungen. Sie sind einzigartig in unserem Leben da sie mehrere besondere Merkmale aufweisen, die in anderen Beziehungen nicht vorkommen.
Zunächst kann man sich seine Geschwister nicht aussuchen. Diese Eigenschaft trifft nur auf solche Beziehungen zu, die in irgendeiner Art und Weise vorgegeben sind. Beispielsweise die Klassenkameraden in der Schule, die einfach zugeteilt werden oder die Eltern. Dies ist aber noch nicht so kennzeichnend wie die Tatsache, dass die Beziehung zwischen Geschwistern die längste Sozialbeziehung des Menschen ist. „Das Leben mit den Eltern kann vierzig und fünfzig, mit den Geschwistern aber 60 bis 70 Jahre dauern“. Das liegt natürlich hauptsächlich an der Tatsache dass der Altersabstand zwischen Geschwistern in den allermeisten Fällen geringer ist als der zwischen Eltern und Kindern.
1 Merkmale und Definition der Geschwisterbeziehung 3
2 Geschwisterbeziehungen im Lebenslauf 5
2.1 Geburt des zweiten Kindes und frühe Kindheit (ca. 0-6 Jahre) 5
2.2 Mittlere und Späte Kindheit (ca. 7 – 12 Jahre) 7
2.3 Symmetrisches und Asymmetrisches Verhalten in der Kindheit 8
2.4 Das Jugendalter (13 – 18 Jahre) 9
2.5 Die frühen und mittleren Erwachsenenjahre 10
2.6 Geschwister im späten Erwachsenenalter 11
2.7 Geschwister im höheren Alter 12
3 Einzelkinder 14
4 Literaturverzeichnis: 17
5 Anhang 18
Inhalt
1. Merkmale und Definition der Geschwisterbeziehung
2. Geschwisterbeziehungen im Lebenslauf
2.1 Geburt des zweiten Kindes und frühe Kindheit (ca. 0-6 Jahre)
2.2 Mittlere und späte Kindheit (ca. 7-12 Jahre)
2.3 Symmetrisches und Asymmetrisches Verhalten in der Kindheit
2.4 Das Jugendalter (13-18 Jahre)
2.5 Die frühen und mittleren Erwachsenenjahre
2.6 Geschwister im späten Erwachsenenalter
2.7 Geschwister im höheren Alter
3. Einzelkinder
4. Literaturverzeichnis
5. Anhang
1. Merkmale und Definition der Geschwisterbeziehung
Geschwisterbeziehungen sind eine besondere Art zwischenmenschlicher Beziehungen. Sie sind einzigartig in unserem Leben da sie mehrere besondere Merkmale aufweisen, die in anderen Beziehungen nicht vorkommen.
Zunächst kann man sich seine Geschwister nicht aussuchen. Diese Eigenschaft trifft nur auf solche Beziehungen zu, die in irgendeiner Art und Weise vorgegeben sind. Beispielsweise die Klassenkameraden in der Schule, die einfach zugeteilt werden oder die Eltern. Dies ist aber noch nicht so kennzeichnend wie die Tatsache, dass die Beziehung zwischen Geschwistern die längste Sozialbeziehung des Menschen ist. „Das Leben mit den Eltern kann vierzig und fünfzig, mit den Geschwistern aber 60 bis 70 Jahre dauern“ (Bank/Kahn 1991, S. 18). Das liegt natürlich hauptsächlich an der Tatsache dass der Altersabstand zwischen Geschwistern in den allermeisten Fällen geringer ist als der zwischen Eltern und Kindern.
Die Geschwisterbeziehung ist ausserdem eine Art von Beziehung, die nicht wie die meisten anderen typische Merkmale aufweist. Eine Liebesbeziehung hat Liebe als Merkmal, eine geschäftliche Beziehung das Geschäft als Ziel. Bei der Geschwisterbeziehung gibt es Merkmale solcher Art nicht, da die Beziehung ja nicht freiwilliger Natur ist. Typische Merkmale der Geschwisterbeziehung ist deshalb Ambivalenz, Uneinigkeit und Widersprüchlichkeit. Wie später noch gezeigt werden soll, können sich Zeiten der Eintracht mit Zeiten des Streits immer wieder im Laufe des Lebens abwechseln. Prägende ambivalente Merkmale die sich auf die Widersprüchlichkeit beziehen, können deshalb gleichzeitige Zuneigung und Abneigung, Verbundenheit und Abgrenzung, Hilfe und Rivalität, Unterstützung und Feindseligkeit, Nähe und Distanz, Liebe und Hass sein. Man kann auch noch sehen, dass die Geschwisterbeziehungen eine Art Aggressionskontrolle bieten. Geschwisterbeziehungen können auch dann nicht abgebrochen werden, wenn sich Aggression und Frustration anhäufen. Es muss also eine Lösung gefunden werden
All diese Merkmale jedoch geben noch keine richtige Definition der Geschwisterbeziehung wider, sondern umschreiben sie bestenfalls. Wie könnte man also in unserem Kulturkreis die Beziehung zwischen Geschwistern definieren und was sind überhaupt Geschwister? In unserem Kulturkreis werden Geschwister als Nachkommen derselben Eltern definiert. Geschwisterbeziehungen sind demnach Beziehungen zwischen Personen, die unter diese Kategorie fallen. Als Abweichungen dieses Standards werden andere Arten von Geschwistern gesehen wie etwa Halbgeschwister, Adoptivgeschwister, Quasi-Geschwister, Vettern oder Cousinen (vgl. Kasten 1998, S. 22). Für die vorliegende Arbeit wurde diese Definition als Hintergrund verwendet. In anderen Kulturkreisen jedoch gibt es weiter gefasste Verständnisse des Begriffes Geschwister. „So ist es beispielsweise bei den Fanti, einer westafrikanischen Stammesgesellschaft, üblich, dass sich die Frauen im Alltag als Geschwister bezeichnen. Schwester dürfen sie sich selbst nur dann nennen, wenn sie mit ihresgleichen, d.h. mit anderen weiblichen Stammesangehörigen, zusammen sind. Sie bringen damit zum Ausdruck, dass sie einen Fanti-Mann als Bruder haben. In Anwesenheit des leiblichen Bruders ist es ihnen dagegen verwehrt, die vertraute Bezeichnung Schwester zu verwenden“ (Kasten 1998, S. 23). Um jedoch das Thema etwas eingrenzen zu können, wird hier nur das Verständnis unseres Kulturkreises, d.h. der der westlichen Welt betrachtet.
2. Geschwisterbeziehungen im Lebenslauf
Betrachtet man Geschwisterbeziehungen im Kontext des Lebenslaufs, so erscheinen in verschiedenen Lebensabschnitten verschiedene Verhaltensweisen der Geschwister zueinander. Dies liegt natürlich daran, dass sich in verschiedenen Phasen des Lebens die Prioritäten verändern und verschieben. Die verschiedenen Phasen im Lebenslauf werden im folgenden kurz beschrieben und ihre Rolle für die Geschwisterbeziehung im Besonderen betrachtet.
2.1 Geburt des zweiten Kindes und frühe Kindheit (ca. 0-6 Jahre)
Aus Sicht der Eltern bringt die Geburt des zweiten Kindes weniger Komplikationen und Veränderungen mit sich als die des ersten Kindes. Sie haben bereits Erfahrung im Umgang mit Neugeborenen und sind meistens entspannter. Für das erste Kind jedoch kann die Geburt des Geschwisters durchaus mit traumatischen oder krisenhaften Erlebnissen verbunden sein. „Es sieht sich nämlich nach und nach mit der Aufgabe konfrontiert, nach und nach die Rolle des älteren Geschwisters zu übernehmen“ (Kasten 1998, S. 92). Auch die Verantwortung der Eltern ist hier gefordert, denn das ältere Geschwister macht eine sogenannte „Entthronung“ durch. Zuvor konnte es ungeteilt die Aufmerksamkeit seiner Eltern bekommen, während sich die Eltern jetzt verstärkt um das kleinere Geschwister kümmern müssen, besonders in den ersten Lebensmonaten. „Jede Entthronung ist ein schmerzlicher Prozess [für die älteren Geschwister]. So feinfühlig die Eltern damit umgehen – es bleibt ein Verlusterlebnis für die meisten Kinder“ (Wright 2001, S. 35).
Im Max-Planck-Institut Berlin wurde von Forschern ein Drei-Phasen-Modell erarbeitet, dass die familiären Veränderungen mit der Geburt des zweiten Kindes beschreibt. Die Erste Phase dauert von der Geburt des zweiten Kindes bis zu seinem achten Lebensmonat. Beide Kinder müssen in dieser Zeit von den Eltern versorgt werden und zueinander Kontakt aufnehmen. Das ältere Kind sehnt sich in dieser Phase zurück an die Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit der Eltern, die hiermit vor einem Problem der gerechten Vermittlung und Verteilung stehen. Gelöst werden kann es meistens dadurch, dass ein Elternteil sich eher dem älteren Geschwister und ein Elternteil dem jüngeren Geschwister widmet.
Die zweite Phase vom 8. bis 16. Lebensmonat wird durch einen zunehmenden Aktionsradius des jüngeren Kindes charakterisiert. Beispielsweise lernt es in dieser Zeit meistens das Laufen und es häufen sich konflikthafte Auseinandersetzungen mit dem älteren Geschwister. Vor allem Anzeichen von Rivalität und Eifersucht sind in dieser Zeit deutlich zu erkennen. Eltern verhalten sich demgegenüber unterschiedlich: sie können vom älteren Kind Rücksicht verlangen, sich aus den Konflikten ganz heraushalten, oder aber auch vorbeugend aktiv werden.
Die Zeit zwischen dem 17. und dem 24. Lebensmonat wird als die dritte Phase der familiären Veränderungen gesehen. In dieser Phase nehmen die Rivalitätskonflikte zwischen den Geschwistern ab und es bildet sich eine Beziehung zwischen den Geschwistern, die von den Eltern unabhängiger ist. Das Ende dieser Phase ist gekennzeichnet durch die Bildung von zwei Untergruppen in der Familie, die Eltern-Untergruppe und die Kinder-Untergruppe (vgl. Kasten 1998, S. 92-95).
Über ein Viertel des Verhaltens des jüngeren Geschwisters gegenüber dem ältern Geschwister ist Nachahmungsverhalten (bis etwa zum 6. Lebensjahr bleibt dies auch stabil). Das ältere Geschwister hat also eine ausgeprägte Vorbild- und Modellrolle. Es kann als Lehrender und die jüngeren Geschwister als Lernende empfunden werden. Im Alter von zwei Jahren initiieren die jüngeren auch häufiger positives bzw. negatives Sozialverhalten, auf das die älteren Geschwister natürlich entsprechend reagieren.
Eine wesentliche Rolle bei der Geschwisterbeziehung in dieser frühen Phase spielt auch die Beziehung zur Mutter. Ist diese sicher und positiv, gehen Geschwister normalerweise freundlicher miteinander um. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Unwichtigkeit der Geschlechterunterschiede in der geschwisterlichen Beziehung in der Kindheit. Geschlechtsunterschiede manifestieren sich in der geschwisterlichen Beziehung nicht so deutlich wie bei Freundschaften. Im Verlauf der Kindergartenjahre verschwinden die Geschlechtsunterschiede im aggressiven und prosozialen Verhalten zwischen Geschwistern fast vollständig. Dies ist unter Nicht-Geschwistern nicht der Fall. Verschwistertsein hat also eine andere Funktion als Befreundetsein (vgl. Kastner 1998, S. 95-102).
[...]
- Quote paper
- Dominik Schreiner (Author), Karoline Braunsdorf (Author), 2004, Geschwisterbeziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74451