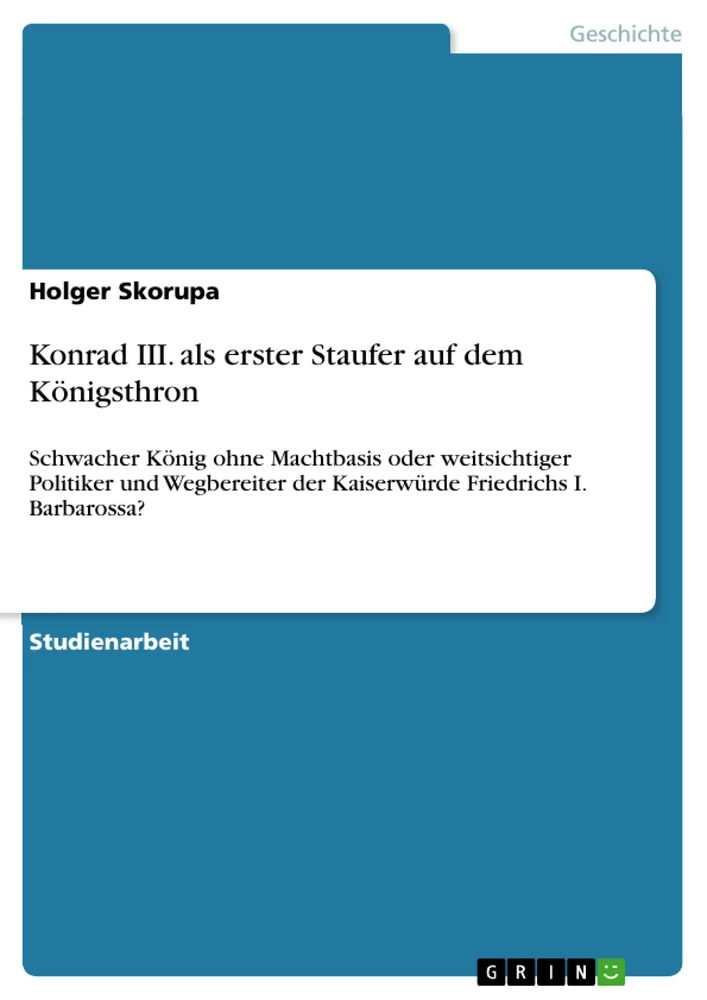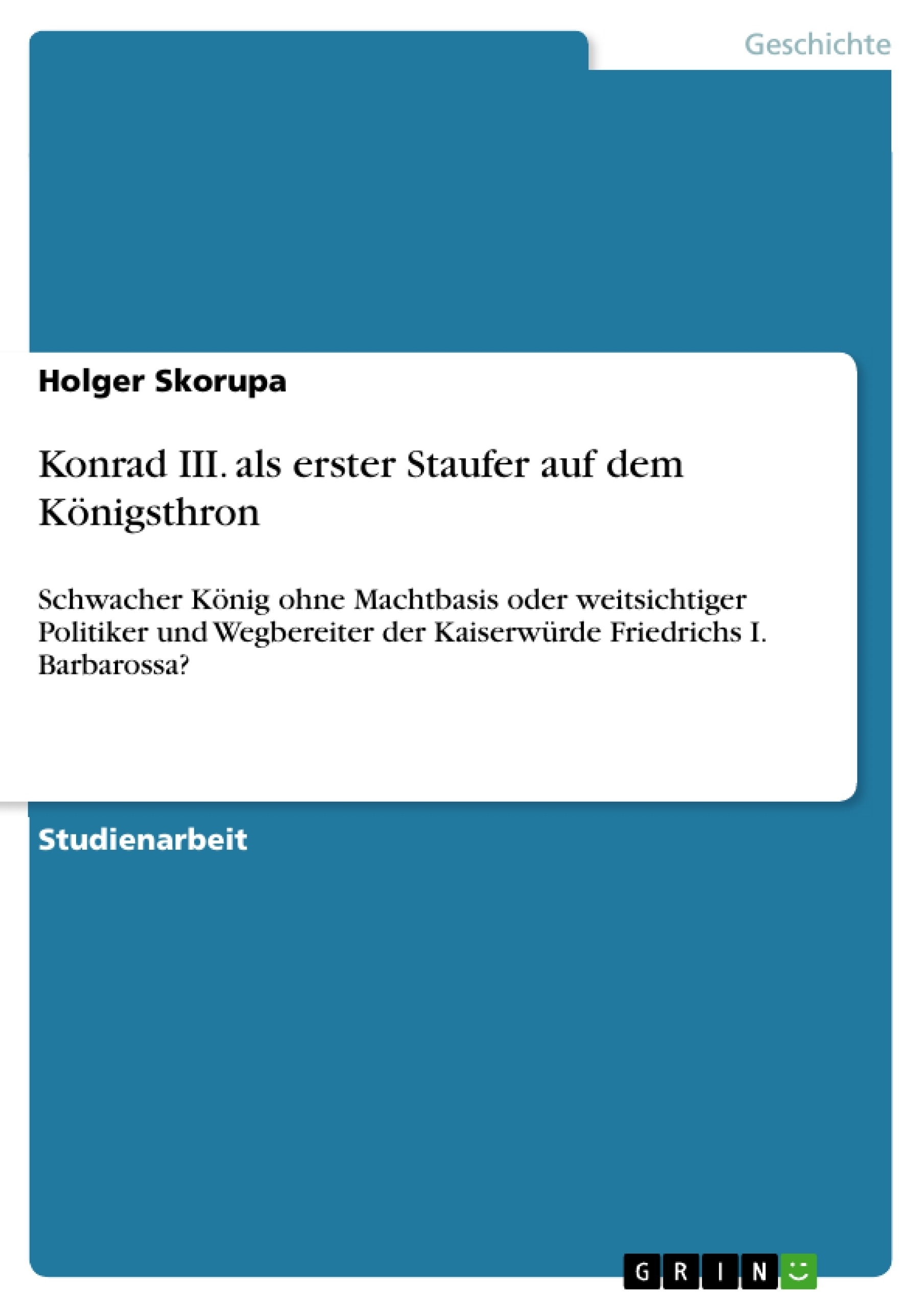Friedrich I. von Schwaben gilt in der historischen Forschung als Begründer des Aufstieges des Geschlechtes der Staufer. Der Erbauer des Hohenstaufen wurde zu Ostern 1079 von König Heinrich IV. in die herzogliche Würde zu Schwaben benannt. Bis zu seinem Tode 1105 kämpfte der Staufer um Herrschaftslegitimation des eigenen Hauses und um Anerkennung der Herzogswürde durch seine territorialen Kontrahenten, den Welfen und Zähringern. Es gelang Friedrich I. von Schwaben jedoch nicht, sich vollends gegen die antistaufischen Parteigänger im Süden des Heiligen Römischen Reiches durchzusetzen.
Um so größer war das Konfliktpotential im Reich, als mit Konrad III. im März 1138 der erste Staufer den Königsthron besetzte. Dem König drohten nicht nur innenpolitische Fehden mit den Welfen, da die südlichen Territorialherren die Hausmachtorientierung noch immer nicht anerkennen wollten, sondern auch außenpolitische Auseinandersetzungen. Die Slawen an der Ostelbe fielen seit der Regentschaft Lothars III. von Supplinburg (1105 – 1138) wieder verstärkt im Osten des Reiches ein. König Roger II. von Sizilien (1130 – 1154) bedrohte die Stellung des Papstes Innozenz II. (1130 – 1143) und später auch die kirchlichen Güter von Papst Eugen III. (1145 – 1153) in Süditalien. Das Herzogtum Polen strebte zu einer eigenen Königskrone und Kaiser Manuel von Byzanz (1143 – 1180) führte eine aggressive Angriffspolitik gegen das Königreich Ungarn.
Konrad III. gelangte in einer von Intrigen, Machtansprüchen und territorialen Auseinandersetzungen geprägten Zeit zu der Königswürde des Heiligen Römischen Reiches. Das Handeln des ersten Staufers auf dem Königsthron wurde in der historischen Analyse seiner Regentschaft häufig als Ergebnis von eigener Schwäche, Selbstüberschätzung und Tatenlosigkeit gewertet. Vor allem durch die Zusammenstellung zeitgenössischer Quellen durch den Historiker Friedrich Hausmann entwickelte sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ein neues Bild von Konrad III. Dabei sind sich nahezu alle Historiker, die sich über längere Zeit mit dem staufischen Geschlecht im Hochmittelalter beschäftigten, einig, dass der König des Heiligen Römischen Reiches von 1138 bis 1152 zwar nicht der größte Realpolitiker seiner Zeit war, gleichwohl aber den Aufstieg der Familie der Staufer mit Eifer, hohem politischen Verständnis und Weitsicht fortsetzte und aufgrund dieser Wertung durchaus als Wegbereiter der Kaiserkrönung Friedrichs I. Barbarossa 1155 gelten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der erste staufische König
- Die Königswahl Konrads III
- Konflikt mit den Welfen und Landesausbau - Kampf um Anerkennung
- Die Überwindung der schwachen Basis
- Die umfassende Heiratspolitik des Staufers
- Konrad III. und das Papsttum
- Zusammenfassung und Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herrschaft Konrads III., des ersten Stauferkönigs, und analysiert die Faktoren, die zu seiner anfänglichen Wahrnehmung als schwacher König führten und wie er letztendlich den Aufstieg der Staufer zum Kaiserreich förderte. Die Arbeit hinterfragt die traditionellen Ansichten und beleuchtet Konrads politische Strategien und deren Auswirkungen.
- Konrads III. Königswahl und der Konflikt mit den Welfen
- Die Heiratspolitik Konrads III. als Instrument der Machtstärkung
- Das Verhältnis Konrads III. zum Papsttum
- Die Stärkung der staufischen Machtposition während Konrads Herrschaft
- Konrad III. als Wegbereiter für Friedrich Barbarossa
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bewertung Konrads III. als König. Sie skizziert die bisherige Forschung und die methodischen Ansätze der Arbeit. Die Einleitung benennt die zentralen Forschungsfragen: Warum wurde Konrad III. zunächst als schwacher König angesehen? Welche Faktoren beeinflussten seine Machtposition? Kann er als Wegbereiter für Friedrich Barbarossa betrachtet werden? Die Einleitung umreißt die Bereiche königlicher Macht, die im weiteren Verlauf analysiert werden, um diese Fragen zu beantworten: die Königswahl, den Konflikt mit den Welfen, die Heiratspolitik, die Stärkung der staufischen Verteidigungsfähigkeit, und das Verhältnis zum Papsttum.
Der erste staufische König: Dieses Kapitel befasst sich mit der Königswahl Konrads III. und dem daraus resultierenden Konflikt mit den Welfen. Es analysiert den Kampf um Anerkennung der staufischen Herrschaft und die Schwierigkeiten, die Konrad III. im Reich antraf. Die detaillierte Untersuchung dieser Konflikte beleuchtet die Herausforderungen, denen sich der erste Stauferkönig gegenüber sah, und verdeutlicht die innenpolitischen Schwierigkeiten beim Aufbau seiner Machtbasis. Besonders hervorgehoben wird die andauernde Herausforderung durch die Welfen und deren Widerstand gegen die staufische Herrschaft.
Die Überwindung der schwachen Basis: Dieses Kapitel untersucht die Strategien Konrads III., seine anfänglich schwache Machtbasis zu festigen. Es analysiert vor allem seine umfassende Heiratspolitik und deren Rolle bei der Konsolidierung seiner Macht. Darüber hinaus wird das komplexe Verhältnis Konrads III. zum Papsttum beleuchtet, welches für die Stabilität des Reiches essentiell war. Die Kapitel erläutert wie Konrad III., trotz der schwierigen innen- und außenpolitischen Lage, die Verteidigungsfähigkeit des staufischen Geschlechtes deutlich verbessert hat. Der Einfluss der Fehde mit den Welfen auf diesen Prozess wird ebenfalls analysiert.
Schlüsselwörter
Konrad III., Staufer, Welfen, Königswahl, Hochmittelalter, Heiliges Römisches Reich, Papsttum, Heiratspolitik, Machtpolitik, Landesausbau, Friedrich Barbarossa.
Häufig gestellte Fragen zu: Herrschaft Konrads III.
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Herrschaft Konrads III., des ersten Stauferkönigs, und untersucht die Faktoren, die zu seiner anfänglichen Wahrnehmung als schwacher König führten und wie er letztendlich den Aufstieg der Staufer zum Kaiserreich förderte. Sie hinterfragt traditionelle Ansichten und beleuchtet Konrads politische Strategien und deren Auswirkungen. Der Fokus liegt auf seiner Königswahl, dem Konflikt mit den Welfen, seiner Heiratspolitik, seinem Verhältnis zum Papsttum und seiner Rolle als Wegbereiter für Friedrich Barbarossa.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Konrads Königswahl und den Konflikt mit den Welfen; seine Heiratspolitik als Instrument der Machtstärkung; sein Verhältnis zum Papsttum; die Stärkung der staufischen Machtposition während seiner Herrschaft; und seine Bedeutung als Wegbereiter für Friedrich Barbarossa. Die Analyse umfasst die innen- und außenpolitischen Herausforderungen, denen sich Konrad III. gegenüber sah, und wie er diese zu meistern versuchte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Königswahl Konrads III. und den Konflikt mit den Welfen ("Der erste staufische König"), ein Kapitel über die Überwindung seiner anfänglich schwachen Machtbasis durch Heiratspolitik und die Beziehung zum Papsttum ("Die Überwindung der schwachen Basis") und eine Zusammenfassung/ein Ergebnis.
Wie wird die Königswahl Konrads III. behandelt?
Das Kapitel "Der erste staufische König" analysiert die Königswahl Konrads III. und den daraus resultierenden Konflikt mit den Welfen. Es untersucht den Kampf um die Anerkennung der staufischen Herrschaft und die Schwierigkeiten, die Konrad III. im Reich antraf. Die andauernde Herausforderung durch die Welfen und deren Widerstand gegen die staufische Herrschaft werden besonders hervorgehoben.
Welche Rolle spielte die Heiratspolitik Konrads III.?
Das Kapitel "Die Überwindung der schwachen Basis" analysiert die umfassende Heiratspolitik Konrads III. als ein zentrales Instrument zur Konsolidierung seiner Macht. Es wird untersucht, wie diese Politik zur Stärkung seiner Position beitrug und die staufische Verteidigungsfähigkeit verbesserte. Der Einfluss der Fehde mit den Welfen auf diesen Prozess wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird das Verhältnis Konrads III. zum Papsttum dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet das komplexe Verhältnis Konrads III. zum Papsttum, welches für die Stabilität des Reiches essentiell war. Es wird analysiert, wie Konrad III. trotz schwieriger innen- und außenpolitischer Lage dieses Verhältnis für seine Zwecke nutzte und wie es seine Machtposition beeinflusste.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konrad III., Staufer, Welfen, Königswahl, Hochmittelalter, Heiliges Römisches Reich, Papsttum, Heiratspolitik, Machtpolitik, Landesausbau, Friedrich Barbarossa.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Zentrale Forschungsfragen sind: Warum wurde Konrad III. zunächst als schwacher König angesehen? Welche Faktoren beeinflussten seine Machtposition? Kann er als Wegbereiter für Friedrich Barbarossa betrachtet werden?
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und richtet sich an Wissenschaftler und Studierende, die sich mit dem Hochmittelalter, der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches und der Geschichte der Staufer befassen.
- Quote paper
- Holger Skorupa (Author), 2007, Konrad III. als erster Staufer auf dem Königsthron, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74409