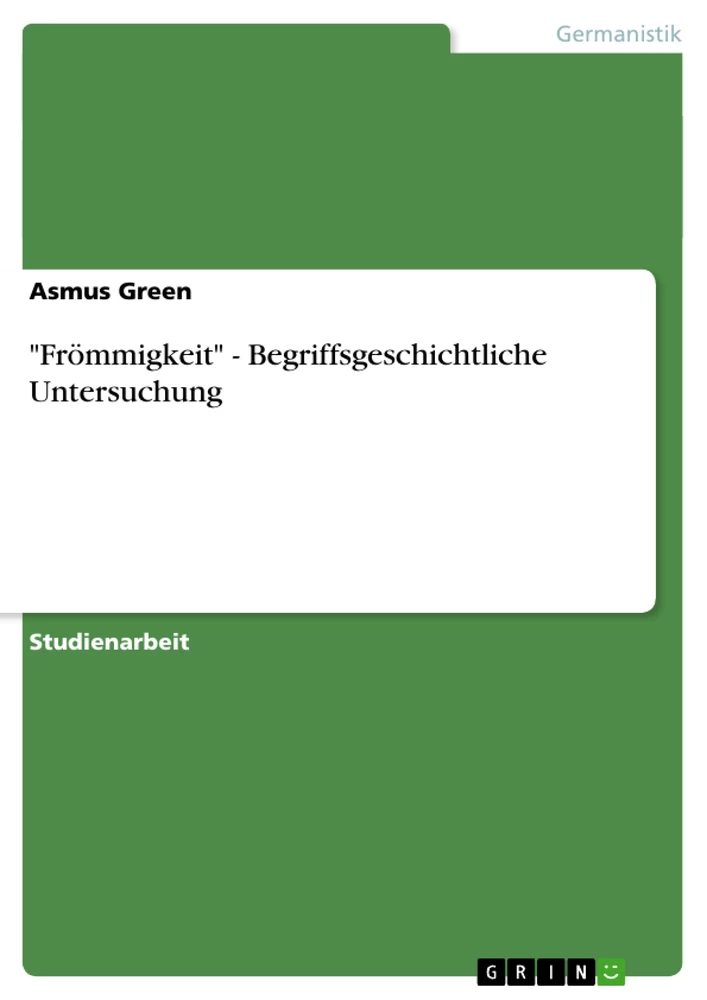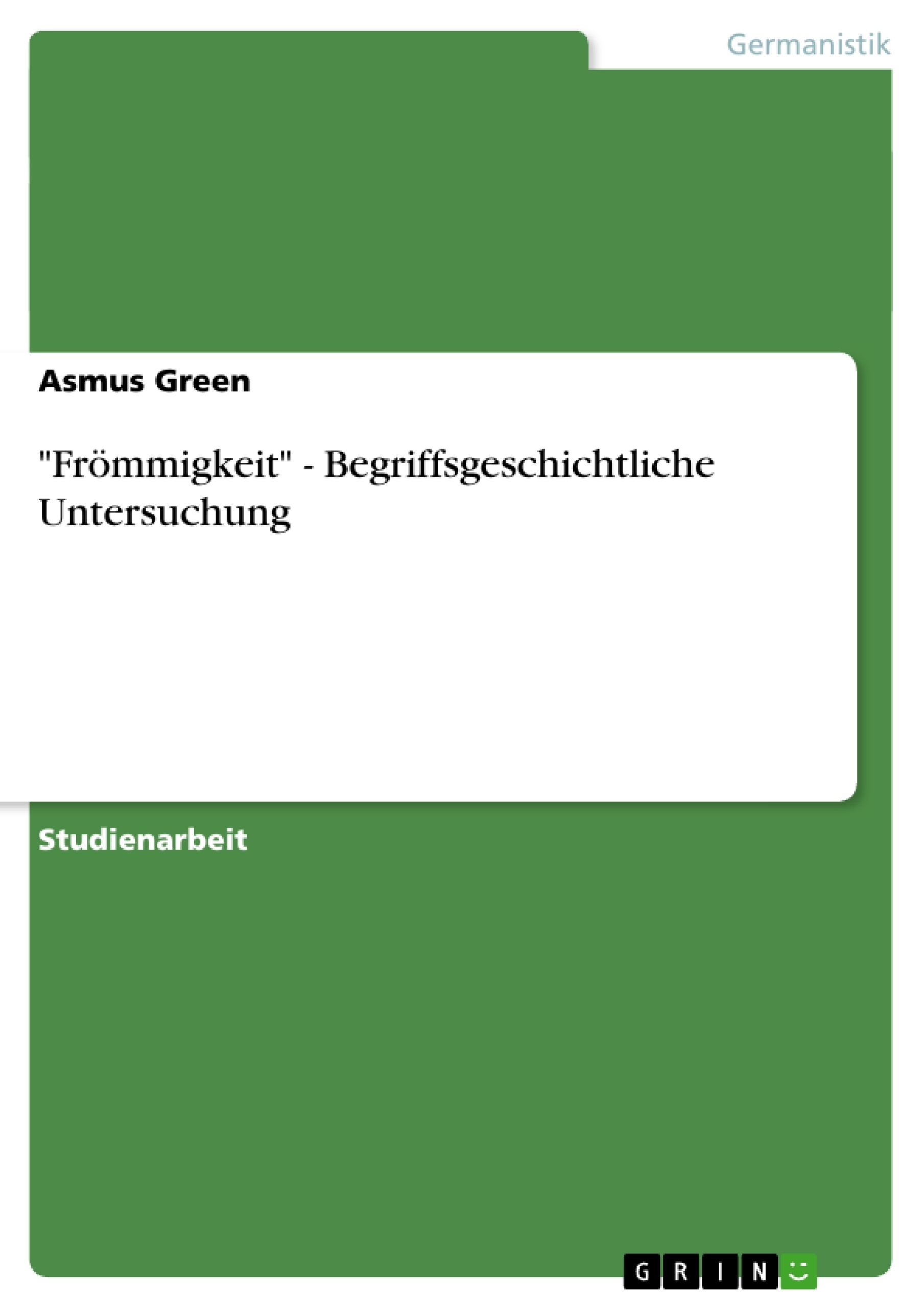Die Begriffsgeschichte stellt einen Zweig der Kultur- und Geschichtswissenschaften dar, der sich mit der Geschichte der Sprache, genauer mit der historischen Semantik von Begriffen und Wörtern auseinandersetzt.
Sie versucht, durch die Beschreibung von sich verändernden Begriffsinhalten den Wandel von Wirklichkeitsauffassungen zu verfolgen und zu erklären.
Die daraus entspringende Erkenntnis ist nicht nur eine Erkenntnis des sich ändernden Begriffsgebrauchs und ein Wissen um alte Bedeutungen von Wörtern, sondern sie kann auch gesellschaftliche Zusammenhänge erhellen, die auf den untersuchten Begriffen basieren. Sofern man Sprache als konstituierendes Element für gesellschaftliche Erfahrungen ansieht, fungiert eine Begriffsgeschichte auch als Geschichte des gesellschaftlichen Bewusstseins.
Da Sprache nicht nur neutrales “Kommunikationsmedium” ist, sondern wesentlich zur Formung gesellschaftlicher Wirklichkeit beiträgt, verspricht die Untersuchung des sprachlichen Niederschlags bestimmter gesellschaftlicher Ereignisse Aufschluss über die Ereignisse selbst und das gesellschaftliche Bewusstsein hinter ihnen. Den engen Zusammenhang zwischen Sprache und Erkenntnis bezeichnet sehr treffend Friedrich Hölderlin: “So wie die Erkenntnis die Sprache ahndet, so erinnert sich die Sprache der Erkenntnis.”
Der Blick auf die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Begriffe “Frömmigkeit” und “fromm” zeigt ihre semantische Überfrachtung im heutigen Sprachgebrauch und dass die Verwendung dieser Begriffe Unklarheiten unterliegen muss.
Diese Arbeit soll den Bedeutungswandel des Begriffes “Frömmigkeit” (bzw. als Adjektiv “fromm”) nachzeichnen und erklären. Dabei soll zunächst bei den rekonstruierbaren Wurzeln des Wortes begonnen werden. Ist dieses Fundament umrissen, soll im Verlauf der Arbeit der diachrone Wandel des Begriffs verfolgt und kommentiert werden. Dazu werden zuerst einige biblische Textstellen auf den semantischen Gehalt des Begriffes “fromm” untersucht. Im Anschluss daran sollen außerbiblische und schließlich auch außerchristliche Texte auf dieses Thema hin befragt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung des Begriffes
- 3. "Frömmigkeit" im biblischen Gebrauch
- 4. “Frömmigkeit" in Schriftgut außerhalb der Bibel
- 5. "Frömmigkeit" in außerchristlicher Literatur
- 6. Säkularisierung als Grund für die Bedeutungsverschiebung von “Frömmigkeit”
- 7. “Frömmigkeit" in der systematischen Theologie
- 8. "Frömmigkeit" als negativ aufgeladener Begriff
- 9. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt die Zielsetzung, den Bedeutungswandel des Begriffs "Frömmigkeit" diachronisch zu untersuchen und zu erklären. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der semantischen Aufladung des Begriffs, insbesondere im Kontext der Säkularisierung. Die Arbeit beleuchtet die historischen Bedeutungsnuancen und verfolgt deren Veränderung über verschiedene Epochen und literarische Quellen.
- Historische Semantik des Begriffs "Frömmigkeit"
- Bedeutungsentwicklung von "Frömmigkeit" in religiösen Texten
- Einfluss der Säkularisierung auf den Bedeutungsgehalt
- "Frömmigkeit" in außerbiblischer und außerchristlicher Literatur
- Positive und negative Konnotationen des Begriffs im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Feld der Begriffsgeschichte ein und begründet die Relevanz der Untersuchung des Bedeutungswandels von "Frömmigkeit". Sie hebt den engen Zusammenhang zwischen Sprache, gesellschaftlichem Bewusstsein und der Interpretation historischer Texte hervor. Der Bedeutungswandel von "Frömmigkeit" wird als Ausgangspunkt für die Analyse des gesellschaftlichen Wandels und der sich verändernden Wirklichkeitsauffassungen identifiziert. Die Arbeit wird als eine diachrone Annäherung an den Begriff angekündigt, der im heutigen Sprachgebrauch vielschichtig und semantisch aufgeladen ist.
2. Entstehung des Begriffes: Dieses Kapitel erforscht die etymologische Entwicklung des Begriffs "fromm". Es wird die mittelhochdeutsche Entstehung aus dem althochdeutschen "fruma" ("Nutzen", "Wohl") nachvollzogen. Die ursprüngliche Bedeutung von "rechtschaffen", "tüchtig" und "tapfer" wird herausgestellt, im Gegensatz zu der heutigen, oft religiös konnotierten Verwendung. Der Übergang von der ursprünglichen Bedeutung zur religiösen Konnotation wird als Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung der Begriffsgeschichte festgelegt. Die verwandten Begriffe in anderen germanischen Sprachen werden ebenfalls erwähnt, um die sprachliche Verwandtschaft zu beleuchten.
3. "Frömmigkeit" im biblischen Gebrauch: Dieses Kapitel analysiert Luthers Bibelübersetzung, um den Gebrauch des Begriffs "fromm" im biblischen Kontext zu verstehen. Anhand des Beispiels aus 1. Mose wird die Bedeutung von "fromm" als Rechtschaffenheit im Bezug auf Gottes Gesetz interpretiert. Die eingeforderte Frömmigkeit wird als Bedingung für den Bund mit Gott und gleichzeitig als dessen Regel dargestellt. Die Kapitel diskutiert den Gottesbegriff im Alten Testament und dessen Einfluss auf das Verständnis von "Frömmigkeit" in diesem Kontext. Es wird herausgestellt, dass "fromm" hier nicht einfach nur Glauben und Gottvertrauen bedeutet, sondern ein Leben nach Gottes Gesetz impliziert.
Schlüsselwörter
Frömmigkeit, Begriffsgeschichte, Semantik, Bedeutungswandel, Säkularisierung, Bibel, Religionsgeschichte, Sprachgeschichte, Etymologische Entwicklung, mittelhochdeutsch, Althochdeutsch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bedeutungsentwicklung des Begriffs "Frömmigkeit"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht diachronisch den Bedeutungswandel des Begriffs "Frömmigkeit" und erklärt dessen Entwicklung, insbesondere im Kontext der Säkularisierung. Der Fokus liegt auf der semantischen Aufladung des Begriffs über verschiedene Epochen und literarische Quellen hinweg.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Semantik von "Frömmigkeit", die Bedeutungsentwicklung in religiösen Texten (insbesondere der Bibel), den Einfluss der Säkularisierung auf den Bedeutungsgehalt, die Verwendung des Begriffs in außerbiblischer und außerchristlicher Literatur sowie die positiven und negativen Konnotationen des Begriffs im Laufe der Zeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Eine Einleitung, die die Relevanz der Untersuchung begründet; ein Kapitel zur Entstehung des Begriffs "fromm" und seiner etymologischen Entwicklung; ein Kapitel über den biblischen Gebrauch des Begriffs "Frömmigkeit"; ein Kapitel über den Gebrauch in außerbiblischen Schriften; ein Kapitel über den Gebrauch in außerchristlicher Literatur; ein Kapitel über die Säkularisierung als Grund für Bedeutungsverschiebungen; ein Kapitel über "Frömmigkeit" in der systematischen Theologie; ein Kapitel über die negative Aufladung des Begriffs und eine Schlussbetrachtung.
Wie wird die Bedeutung von "Frömmigkeit" in der Bibel untersucht?
Die Arbeit analysiert Luthers Bibelübersetzung, um den Gebrauch von "fromm" im biblischen Kontext zu verstehen. Am Beispiel von 1. Mose wird "fromm" als Rechtschaffenheit im Bezug auf Gottes Gesetz interpretiert. Der Gottesbegriff des Alten Testaments und dessen Einfluss auf das Verständnis von "Frömmigkeit" wird diskutiert.
Welche Rolle spielt die Säkularisierung in der Arbeit?
Die Säkularisierung wird als zentraler Faktor für den Bedeutungswandel von "Frömmigkeit" betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie die Säkularisierung den Bedeutungsgehalt des Begriffs beeinflusst und zu seinen heutigen, vielschichtigen und semantisch aufgeladenen Bedeutungen geführt hat.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frömmigkeit, Begriffsgeschichte, Semantik, Bedeutungswandel, Säkularisierung, Bibel, Religionsgeschichte, Sprachgeschichte, Etymologische Entwicklung, mittelhochdeutsch, Althochdeutsch.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Bedeutungswandel des Begriffs "Frömmigkeit" zu untersuchen und zu erklären. Sie möchte die historische Entwicklung der semantischen Aufladung des Begriffs aufzeigen und den Zusammenhang zwischen Sprache, gesellschaftlichem Bewusstsein und der Interpretation historischer Texte beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Asmus Green (Autor:in), 2007, "Frömmigkeit" - Begriffsgeschichtliche Untersuchung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74392