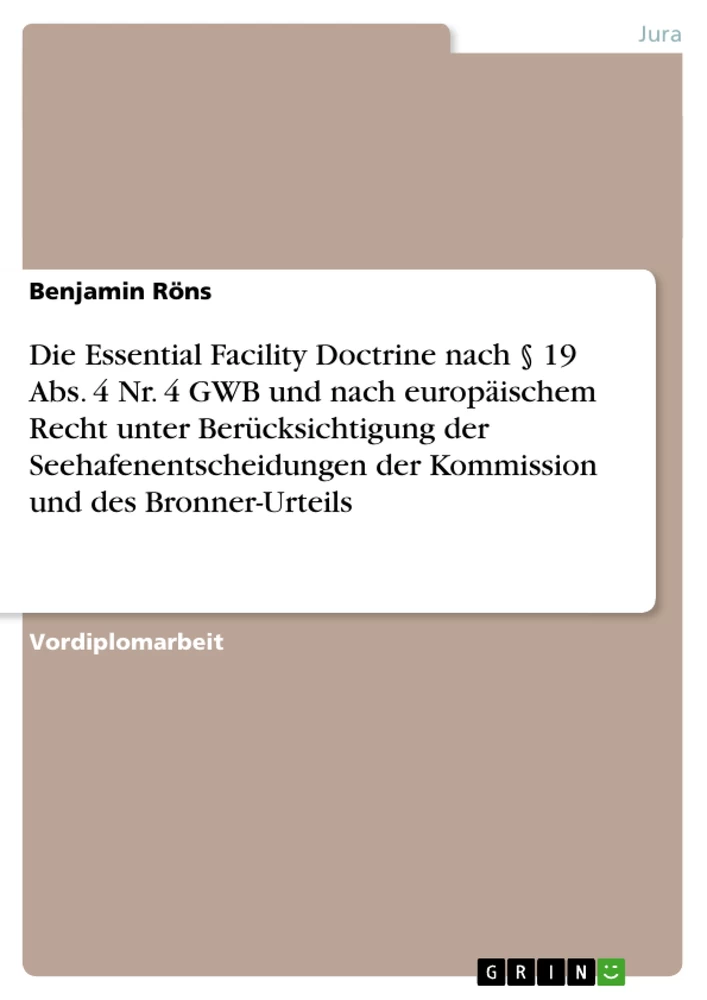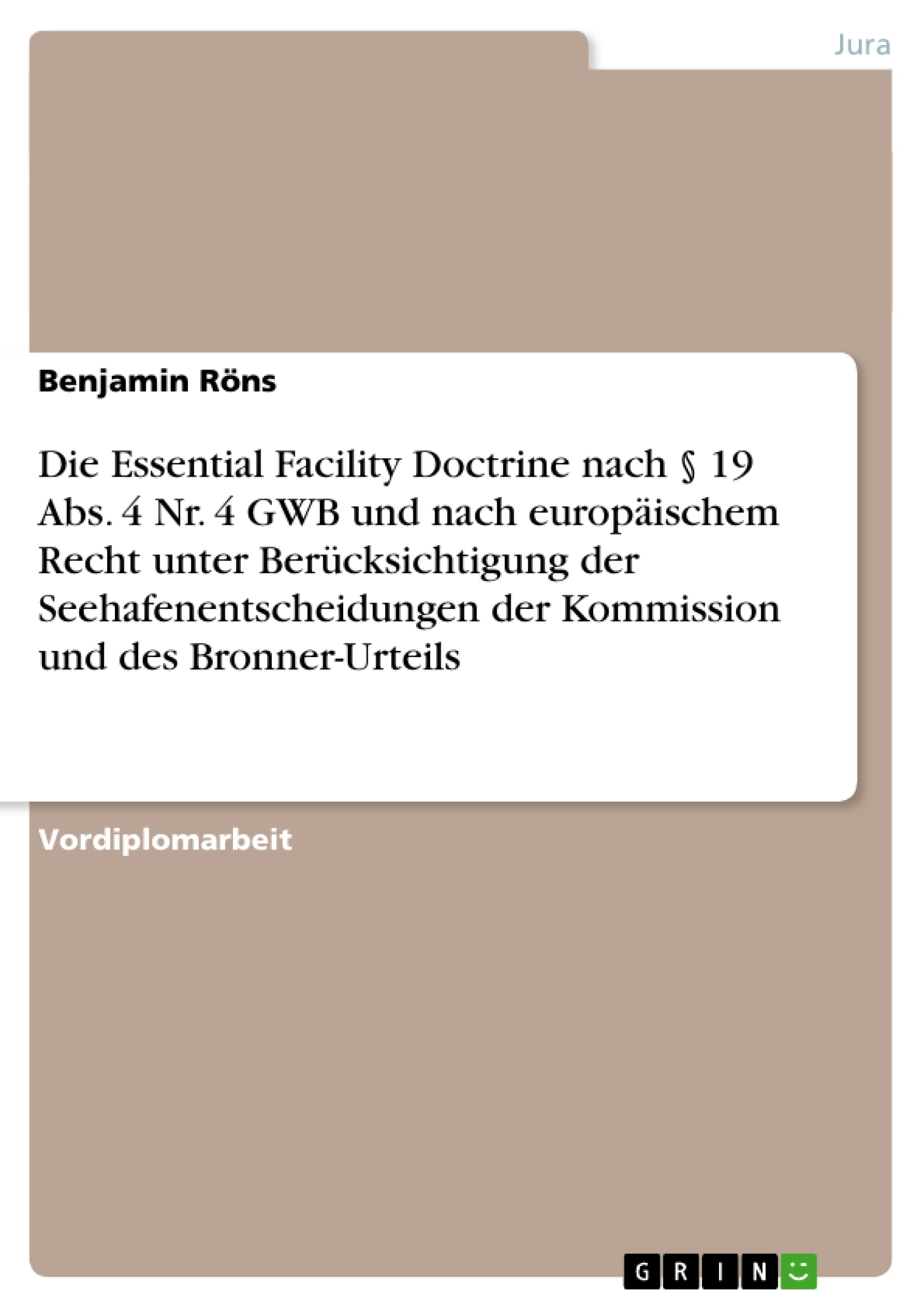Das europäische und deutsche Recht ist vom Grundsatz geprägt, dass ein Unternehmen frei darüber entscheiden kann, mit wem und zu welchen Bedingungen es einen Vertrag schließen möchte. Dies gilt selbstverständlich auch für die Nutzung von Einrichtungen eines Unternehmens, auf die ein anderes zurückgreifen muss, um selber wirtschaftlich tätig werden zu können. Nimmt das erstgenannte Unternehmen jedoch eine derart beherrschende Stellung ein, dass das zugangsbegehrende Unternehmen nicht an ihm vorbeikommt, ist es im Besitz einer sogenannten Engpasseinrichtung. Dieser Umstand ist unproblematisch, solange das beherrschende Unternehmen den Zugang zu der Engpasseinrichtung zu angemessen Bedingungen gewährt. Verweigert es ihn jedoch, liegt der Tatbestand vor, mit welchen sich die essential facility doctrine beschäftigt.
Entwickelt wurde die Doktrin während den Anfängen des letzten Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung ist sie als Beispieltatbestand der allgemeinen Missbrauchskontrolle in das europäische und deutsche Kartellrecht übernommen worden. Im deutschen Rechtskreis fand sie in Form des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB sogar eine legalgesetzliche Form.
Der Gang der vorliegenden Untersuchung wird zunächst die Entwicklung der essential facility doctrine in den verschieden Rechtskreisen beleuchten. Im Anschluss daran werden die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen nach europäischem Recht und nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB dargelegt. Abschließend werden die für diesen Themenkomplex besonders bedeutsamen Seehafenentscheidungen der Europäischen Kommission und das Urteil Bronner des Gerichtshofs dargestellt und einer Bewertung des Autors unterzogen.
Im Ergebnis möchte diese Arbeit die wesentlichen Unterschiede zwischen der essential facility doctrine europäischer und deutscher Prägung herausarbeiten und einen Ausblick wagen, welche wettbewerbspolitische Bedeutung ihr zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Entwicklung der essential facility doctrine
- I. Im amerikanischen Recht
- II. Im europäischen Recht
- III. Im deutschen Recht
- C. Tatbestandsmerkmale
- I. Der relevante Markt
- 1. Sachlich
- 2. Räumlich
- 3. Zeitlich
- II. Die Marktbeherrschung
- 1. Marktstruktur
- 2. Marktverhalten
- III. Der Missbrauch
- 1. Zugangsobjekt
- a) Wesentliche Einrichtungen nach europäischem Recht
- b) Einrichtungen nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB
- aa) Netze
- bb) Andere Infrastruktureinrichtungen
- 2. Wesentlichkeit des Zugangs
- a) Duplizierbarkeit
- b) Substituierbarkeit
- 3. Gewährung des Zugangs
- a) Mitbenutzung gegen angemessenes Entgelt
- b) Unzumutbarkeit der Mitbenutzung
- aa) Betriebsbedingte Gründe
- bb) Sonstige Gründe
- D. Seehafenentscheidungen der Europäischen Kommission
- I. Sealink I
- 1. Sachverhalt
- 2. Entscheidung
- II. Sealink II
- 1. Sachverhalt
- 2. Entscheidung
- III. Hafen von Rødby
- 1. Sachverhalt
- 2. Entscheidung
- E. Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Bronner
- I. Sachverhalt
- II. Entscheidung
- F. Eigene Bewertung
- I. Seehafenentscheidungen der Europäischen Kommission
- II. Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Bronner
- G. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der essential facility doctrine, einem wichtigen Instrument des Kartellrechts. Ziel ist es, die Entwicklung dieser Doktrin im amerikanischen, europäischen und deutschen Recht zu beleuchten, ihre Tatbestandsmerkmale zu analysieren und ihre Anwendung in den Seehafenentscheidungen der Europäischen Kommission sowie im Urteil Bronner des Europäischen Gerichtshofs zu untersuchen.
- Entwicklung der essential facility doctrine in verschiedenen Rechtsordnungen
- Analyse der Tatbestandsmerkmale der essential facility doctrine
- Anwendung der essential facility doctrine in konkreten Fallkonstellationen
- Relevanz der Seehafenentscheidungen der Europäischen Kommission
- Bedeutung des Urteils Bronner des Europäischen Gerichtshofs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der essential facility doctrine ein und erläutert die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel verfolgt die Entwicklung der Doktrin im amerikanischen, europäischen und deutschen Recht, wobei der Fokus auf den jeweiligen Rechtsrahmen und die entscheidenden Präzedenzfälle liegt.
Im dritten Kapitel werden die Tatbestandsmerkmale der essential facility doctrine im Detail untersucht. Dabei werden der relevante Markt, die Marktbeherrschung und der Missbrauch sowie die spezifischen Anforderungen an den Zugang zu wesentlichen Einrichtungen analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Entscheidungen der Europäischen Kommission in den Seehafenfällen Sealink I, Sealink II und Rødby. Die Entscheidungen werden unter Einbezug des jeweiligen Sachverhalts und der Argumentation der Kommission dargestellt und analysiert.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Bronner. Zuerst wird der Sachverhalt des Falles geschildert und im Anschluss die Entscheidung des Gerichtshofs ausführlich dargestellt und analysiert.
Das sechste Kapitel beinhaltet eine eigene Bewertung der Seehafenentscheidungen der Europäischen Kommission und des Urteils Bronner. Die Bewertung setzt sich mit den jeweiligen Entscheidungen kritisch auseinander und befasst sich mit ihren Implikationen für die Anwendung der essential facility doctrine.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der essential facility doctrine, einem wichtigen Instrument des Kartellrechts. Zu den zentralen Themen gehören die Entwicklung der Doktrin in verschiedenen Rechtsordnungen, die Analyse ihrer Tatbestandsmerkmale, die Anwendung in konkreten Fällen und die Bedeutung der Seehafenentscheidungen der Europäischen Kommission sowie des Urteils Bronner des Europäischen Gerichtshofs.
- Quote paper
- Benjamin Röns (Author), 2007, Die Essential Facility Doctrine nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB und nach europäischem Recht unter Berücksichtigung der Seehafenentscheidungen der Kommission und des Bronner-Urteils, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74334