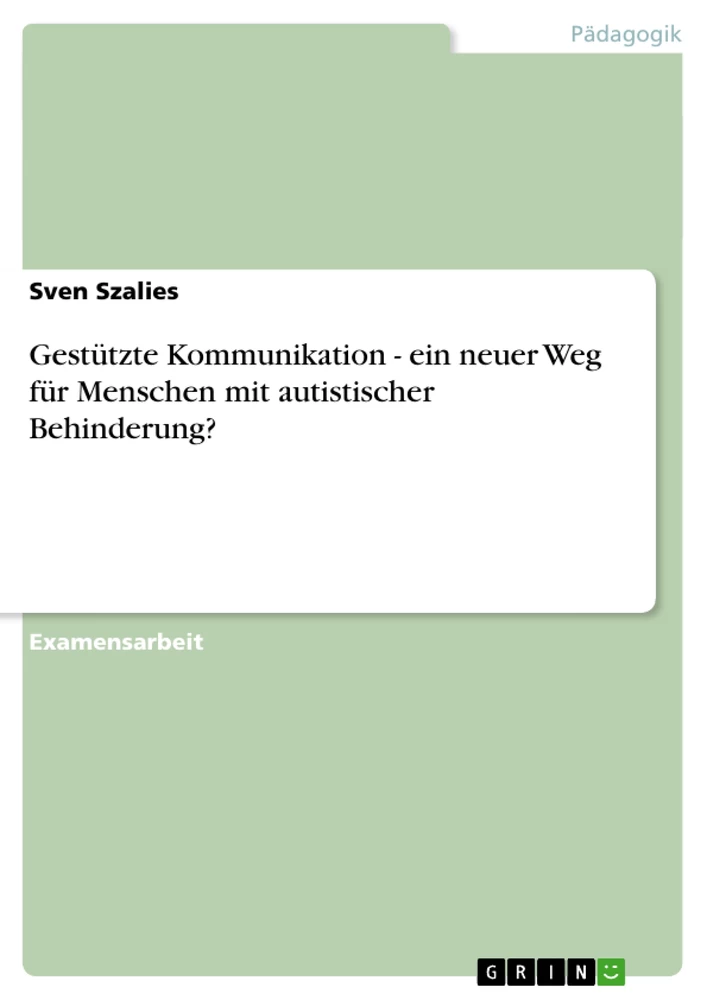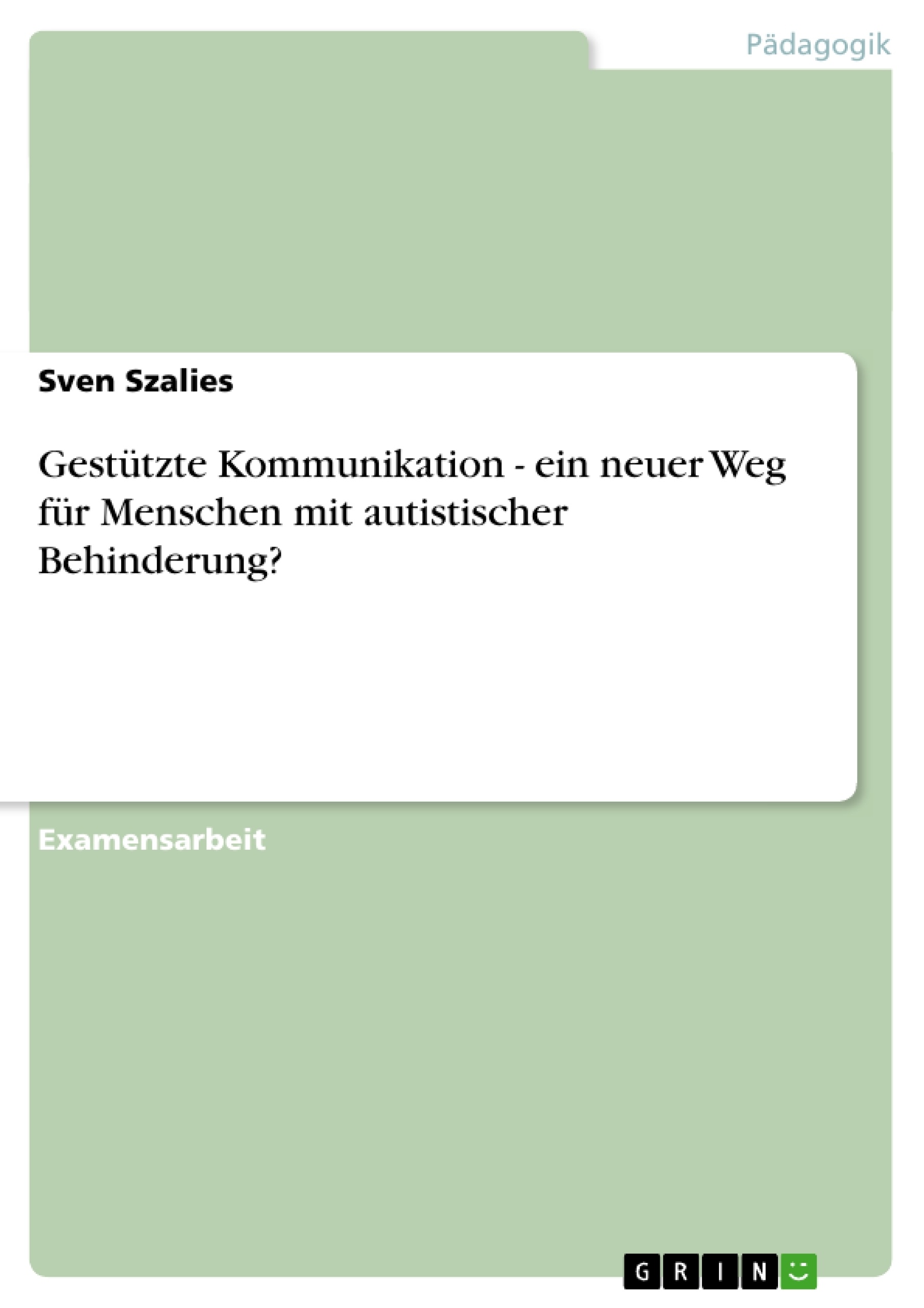Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
Kommunikation ist lebensnotwendig. Viele Menschen mit autistischer Störung verfügen jedoch nicht über ausreichende kommunikative Kompetenzen, um ihre Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche zum Ausdruck bringen zu können.
Die von einer Kommunikationsstörung betroffenen Menschen werden nicht selten in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten unterschätzt und von der Gesellschaft diskriminiert. Als Konsequenz können Ängste, Trauer und ein vermindertes Selbstbewußtsein bei den autistischen Menschen aufkommen. Es ist somit dringend nötig, dieser Klientel geeignete kommunikationsfördernde Angebote zu offerieren.
Die vorliegende Examensarbeit befaßt sich schwerpunktmäßig mit der Methode der Gestützten Kommunikation, die ein solches Angebot darstellt. Diese lautsprachersetzende Kommunikationsmethode, die besonders bei autistischen Menschen erfolgreich zu sein scheint, sorgt in Fachkreisen immer wieder für Diskussionsstoff. In der Sonder- und Heilpädagogik wird heftig debattiert, ob es legitim ist, eine Methode zur Kommunikationsförderung einzusetzen, die wissenschaftlich nicht eindeutig abgesichert ist.
In dieser Arbeit möchte ich die Methode der Gestützten Kommunikation detaillierter betrachten und ihre Funktion und Wirkung verdeutlichen, um möglichst folgende Frage beantworten zu können:
Gestützte Kommunikation - Ein neuer Weg zur Öffnung der Welt für Menschen mit autistischer Behinderung?
Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, ob die Gestützte Kommunikation für nichtsprechende autistische Menschen eine adäquate Kommunikationsmöglichkeit darstellt. Um hierauf eine entsprechende Antwort geben zu können, bedarf es zunächst einer ausführlichen Auseinandersetzung mit dem Autismussyndrom.
Kapitel 2 stellt daher zunächst Phänomenologie und Ätiologie dieser Behinderung vor, da es meiner Meinung nach unumgänglich ist, die signifikanten Merkmale der Behinderung zu kennen, um die Notwendigkeit einer Kommunikationshilfe nachvollziehen zu können.
In Kapitel 3 werden dann ansatzweise die Grundlagen der Kommunikation erörtert, verschiedene Kommunikationsformen und -ebenen aufgezeigt und der Wert von Kommunikation für das Individuum verdeutlicht.
n Kapitel 4 werde ich eingehend das Verfahren der Gestützten Kommunikation sowie die Probleme, die auftreten können, vorstellen, eine Abgrenzung zur Unterstützen Kommunikation ziehen und persönliche Erfahrungsberichte von Autisten berücksichtigen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Das Autismussyndrom in seiner historischen Entstehung - zur Phänomenologie und Ätiologie
- 2.1. Begriffliche Erklärung
- 2.2. Der frühkindliche Autismus nach Kanner
- 2.3. Die autistische Psychopathie nach Asperger
- 2.4. Abgrenzung von Kanner zu Asperger
- 2.5. Das Autismussyndrom nach der ICD
- 2.5.1. Der frühkindliche Autismus nach der ICD-10
- 2.5.2 Die autistische Psychopathie nach der ICD-10
- 2.6. Hypothesen zur Ätiologie des Autismussyndroms
- 2.6.1. Genetische Ursachen
- 2.6.2. Hirnorganische Erklärungsansätze
- 2.6.3. Biochemische Indikatoren
- 2.6.4. Soziale Einflußfaktoren
- 2.6.5 Störungen im affektiven Kontakt
- 3. Kommunikation als Ausgestaltungsfaktor zwischenmenschlicher Begegnungsqualität
- 3.1. Zum Begriff Kommunikation
- 3.2. Die Bedeutung der Kommunikation für die Persönlichkeitsentfaltung des Individuums
- 3.3. Formen der Kommunikation
- 3.3.1. Verbale Kommunikation
- 3.3.2 Nonverbale Kommunikation
- 3.4 Die Kommunikationsebenen
- 4. Gestützte Kommunikation - Ein kommunikativ-innovatorischer Weg für Menschen mit autistischen Lebenserschwernissen in zwischenmenschlichen Begegnungsfeldern
- 4.1. Autismus als eine schwere Kommunikationsbehinderung
- 4.2. Gestützte Kommunikation – Ein innovatorischer Weg?
- 4.3. Abgrenzung zur Unterstützten Kommunikation
- 4.4. Klientel der Gestützten Kommunikation
- 4.5. Zielsetzung der Gestützten Kommunikation
- 4.6. Problembereiche bei der Anwendung von Gestützter Kommunikation
- 4.6.1. Mißverständnisse, Fehl- und Überinterpretationen
- 4.6.2. Wortfindungsprobleme
- 4.6.3. Zeitaufwand
- 4.6.4 Sonstige Problembereiche
- 4.7 Erfahrungsberichte der Klientel im Bezug auf den Umgang mit der Gestützten Kommunikation
- 5. Kontroverse Diskussion um Gestützte Kommunikation
- 5.1. Stützereinfluß bei Gestützter Kommunikation
- 5.2. Quantitativ-experimentelle Studien
- 5.3. Qualitative Studien
- 5.4. Versuch einer eigenen kritischen Stellungnahme zur Gestützten Kommunikation
- 5.5 Vorschläge und Forderungen zur verbesserten Ausgestaltung von Kommunikationsprozessen mit autistischen Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich - thesenhaft formuliert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gestützte Kommunikation als Methode zur Verbesserung der Kommunikation bei Menschen mit autistischer Behinderung. Das Hauptziel ist die Beantwortung der Frage, ob diese Methode einen adäquaten Kommunikationsweg für nichtsprechende autistische Personen darstellt.
- Das Autismus-Spektrum und seine verschiedenen Ausprägungen
- Kommunikation als grundlegender Aspekt der menschlichen Entwicklung und ihre Bedeutung für Menschen mit Autismus
- Die Methode der Gestützten Kommunikation: Funktionsweise, Anwendung und mögliche Probleme
- Wissenschaftliche Kontroversen und Forschungsstand zur Wirksamkeit der Gestützten Kommunikation
- Vorschläge zur Verbesserung der Kommunikation mit autistischen Kindern und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit: Die Arbeit untersucht die Eignung der Gestützten Kommunikation als Kommunikationsmethode für autistische Menschen, die nicht sprechen können. Sie analysiert, ob diese Methode einen neuen Weg zur Verbesserung der Lebensqualität dieser Personengruppe darstellt und widmet sich der kontroversen Diskussion um ihre wissenschaftliche Fundiertheit.
2. Das Autismussyndrom in seiner historischen Entstehung - zur Phänomenologie und Ätiologie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Autismus-Spektrum, beginnend mit den historischen Definitionen durch Kanner und Asperger. Es differenziert zwischen den verschiedenen Ausprägungen des Autismus und beleuchtet die aktuelle Definition gemäß ICD-10. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Hypothesen zur Entstehung von Autismus, inklusive genetischer, hirnorganischer, biochemischer und sozialer Faktoren, sowie Störungen im affektiven Kontakt. Das Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der Kommunikationsbedürfnisse autistischer Menschen.
3. Kommunikation als Ausgestaltungsfaktor zwischenmenschlicher Begegnungsqualität: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Kommunikation für die Persönlichkeitsentwicklung und differenziert zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation sowie den verschiedenen Kommunikationsebenen. Es dient als theoretischer Rahmen für die spätere Diskussion der Gestützten Kommunikation und ihrer Bedeutung im Kontext der zwischenmenschlichen Beziehungen.
4. Gestützte Kommunikation - Ein kommunikativ-innovatorischer Weg für Menschen mit autistischen Lebenserschwernissen in zwischenmenschlichen Begegnungsfeldern: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Gestützte Kommunikation als Methode der lautsprachersetzenden Kommunikation für autistische Menschen. Es beschreibt die Zielsetzung der Methode, ihre Anwendung und potentielle Probleme wie Missverständnisse, Wortfindungsschwierigkeiten und den hohen Zeitaufwand. Erfahrungsberichte betroffener Personen werden ebenfalls berücksichtigt.
5. Kontroverse Diskussion um Gestützte Kommunikation: Dieses Kapitel analysiert die wissenschaftliche Diskussion um die Gestützte Kommunikation. Es beleuchtet kontroverse Punkte wie den Einfluss des Unterstützers und bewertet quantitative und qualitative Studien zur Wirksamkeit der Methode. Es schließt mit einer kritischen Stellungnahme und Vorschlägen zur Verbesserung der Kommunikation mit autistischen Kindern und Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Autismus, Autismus-Spektrum-Störung, Gestützte Kommunikation, Kommunikation, Kommunikationsförderung, Heilpädagogik, Sonderpädagogik, wissenschaftliche Kontroverse, sprachliche Entwicklung, nonverbale Kommunikation, soziale Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gestützte Kommunikation bei Autismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Wirksamkeit der Gestützten Kommunikation als Kommunikationsmethode für Menschen mit Autismus, die nicht sprechen können. Sie analysiert die Methode, ihre Vor- und Nachteile und beleuchtet die wissenschaftliche Kontroverse um ihre Effektivität.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: das Autismus-Spektrum und seine verschiedenen Ausprägungen; Kommunikation als grundlegender Aspekt der menschlichen Entwicklung und ihre Bedeutung für Menschen mit Autismus; die Methode der Gestützten Kommunikation: Funktionsweise, Anwendung und mögliche Probleme; wissenschaftliche Kontroversen und Forschungsstand zur Wirksamkeit der Gestützten Kommunikation; Vorschläge zur Verbesserung der Kommunikation mit autistischen Kindern und Jugendlichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Fragestellung und Zielsetzung. Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über das Autismus-Spektrum, seine historische Entwicklung und Ätiologie. Kapitel 3 beleuchtet die Bedeutung von Kommunikation für die Persönlichkeitsentwicklung. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Gestützte Kommunikation, ihre Anwendung und Herausforderungen. Kapitel 5 analysiert die wissenschaftliche Diskussion und Kontroversen um die Gestützte Kommunikation und gibt abschließende Vorschläge.
Welche Methoden der Kommunikation werden betrachtet?
Die Arbeit differenziert zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation und betrachtet die Gestützte Kommunikation als eine lautsprachersetzende Methode. Sie analysiert die verschiedenen Kommunikationsebenen und deren Bedeutung für Menschen mit Autismus.
Welche Kritikpunkte an der Gestützten Kommunikation werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert kritische Punkte wie den Einfluss des Unterstützers auf die Kommunikation, Missverständnisse und Fehlinterpretationen, Wortfindungsprobleme, den hohen Zeitaufwand und bewertet quantitative und qualitative Studien zur Wirksamkeit der Methode. Mögliche Probleme und Herausforderungen bei der Anwendung werden ausführlich diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Stellungnahme zur Gestützten Kommunikation und bietet thesenhaft formulierte Vorschläge und Forderungen zur verbesserten Ausgestaltung von Kommunikationsprozessen mit autistischen Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich. Sie zielt darauf ab, die Kommunikation für diese Personengruppe zu verbessern und ihre Lebensqualität zu steigern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Autismus, Autismus-Spektrum-Störung, Gestützte Kommunikation, Kommunikation, Kommunikationsförderung, Heilpädagogik, Sonderpädagogik, wissenschaftliche Kontroverse, sprachliche Entwicklung, nonverbale Kommunikation, soziale Interaktion.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Bereich der Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Logopädie und für alle, die sich mit der Kommunikation und den Bedürfnissen von Menschen mit Autismus auseinandersetzen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand und wichtige methodische Überlegungen.
- Citar trabajo
- Sven Szalies (Autor), 2002, Gestützte Kommunikation - ein neuer Weg für Menschen mit autistischer Behinderung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7430