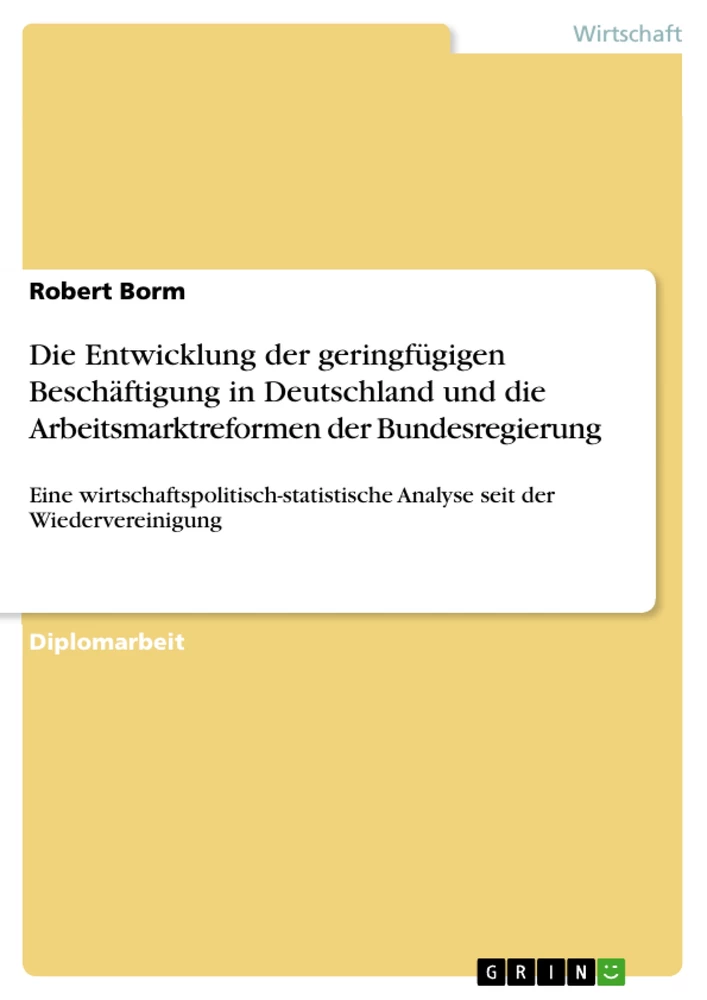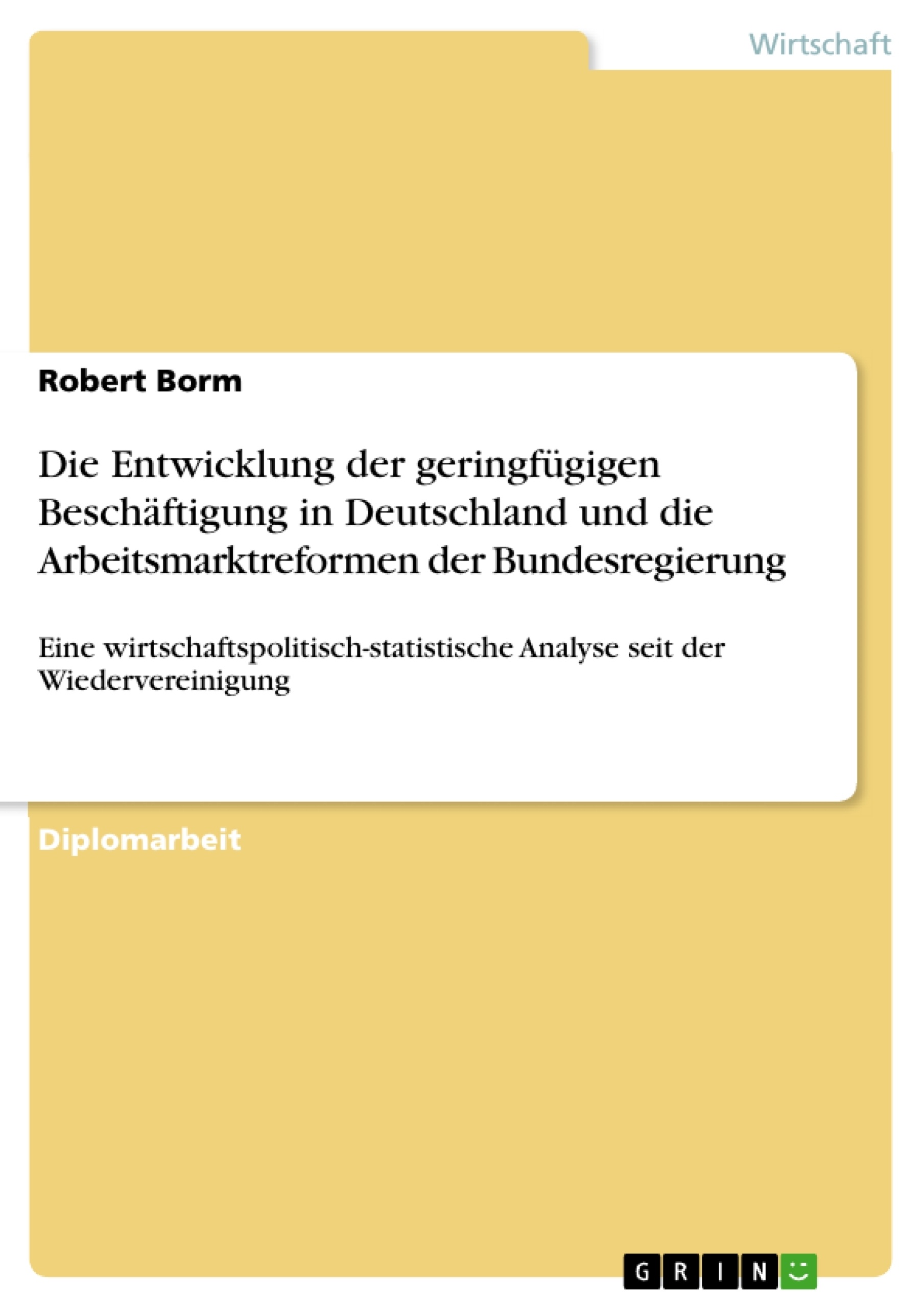Der deutsche Arbeitsmarkt ist mit seinen grundlegenden Problemen seit Jahren ein Dauerthema in der öffentlichen Diskussion. Starre Strukturen, bürokratische Gesetzgebung und ein mangelnder politischer Wille lassen den deutschen Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen Ländern unflexibel und nicht wettbewerbsfähig erscheinen.
Mit der nachfolgenden Arbeit wird ein Segment des Arbeitsmarktes beleuchtet, dass in den letzten Jahren durch steigende Beschäftigtenzahlen für Gesprächsstoff sorgte. Die geringfügige Beschäftigung hat sich während der 1990er Jahre zu einem stillen
Riesen entwickelt und ist heute ein unverzichtbares Instrument des deutschen Arbeitsmarktes.
Im Juni 2006 befanden sich 6,7 Mio. Personen bzw. 17,2% aller Erwerbstätigen in einer geringfügigen Beschäftigung.1 1992 waren es dagegen nur rund 3,2 Mio. bzw. 8,7% aller Erwerbstätigen. Dieser, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gegenläufige Trend, führte zu einer stärkeren Beachtung in der Politik. Mit zwei Reformen versuchte der Gesetzgeber, maßgeblich Einfluss auf Entwicklung und Struktur der geringfügigen Beschäftigung zu nehmen. Diese beiden Reformen, das „630-DM-Gesetz“ vom 24.03.1993 und die „Minijob-Reform“ vom 14.11.2002, hatten allerdings gegensätzliche Charaktere. Die erste Reformmaßnahme war ein Versuch, die geringfügige Beschäftigung einzudämmen, mit der zweiten Reform versuchte man sie auszuweiten.
Ein zentraler Punkt dieser Arbeit wird es sein, in einer empirischen Analyse zu untersuchen, wie sich diese Kehrtwende in der Politik auf die geringfügige Beschäftigung ausgewirkt hat. Als Datengrundlage für die Analyse dient das vergleichsweise neue Beschäftigtenpanel der Bundesagentur für Arbeit (BA), das im Gegensatz zu den
etablierten Datenquellen auf prozessbasierten Daten der Beschäftigtenstatistik der BA zurückgreift. Durch den verhältnismäßig großen Stichprobenumfang und die gute Datenqualität lassen sich somit seriöse empirische Untersuchungen durchführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des Arbeitsmarktes
- Entwicklung und Diskussion der rechtlichen Grundlagen
- Vorbemerkung und Geschichte
- Einteilung der geringfügigen Beschäftigung
- Rechtliche Grundlagen bis 31.03.1999 und deren Effekte
- Das 630-DM-Gesetz zum 01.04.1999
- Die "Minijob-Reform" - Neuregelung zum 01.04.2003
- Datengrundlage geringfügiger Beschäftigung
- Datenerfassung vor 1999
- Angebotsorientierte Messkonzepte
- Nachfrageorientierte Messkonzepte
- Statistische Erfassung nach 1999
- Schwierigkeiten bei der Datenerfassung
- Datenerfassung vor 1999
- Umfang und Struktur der geringfügig Beschäftigten
- Umfang der geringfügig Beschäftigten vor 1999
- Beschäftigungsumfang nach dem 01.04.1999
- Kurzfristige Effekte des "630-DM-Gesetzes"
- Schwierigkeiten in der amtlichen Statistik
- Beschäftigungsumfang bis 2003
- Beschäftigungsumfang nach der Minijob-Reform
- Struktur der geringfügig entlohnten Beschäftigten
- Geringfügig Alleinbeschäftigte
- Geringfügig Nebenbeschäftigte
- Einsatz in den Wirtschaftsbereichen
- Das BA-Beschäftigtenpanel
- Statistik und Forschung
- Aufbau und Methodik
- Hochrechnungsgüte des BA-Beschäftigtenpanels
- Vergleich zu anderen Datenquellen
- Empirische Analysen mit dem BA-Beschäftigtenpanel
- Zielstellung
- Analyse der geringfügig entlohnten Beschäftigung
- Beschäftigungsaussichten
- Geringfügige Beschäftigung als Weg aus der Arbeitslosigkeit
- Aufteilung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
- Analyse der Beschäftigung in der Gleitzone
- Soziale Absicherung durch die Rentenversicherung
- Schlussfolgerung und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung in Deutschland seit der Wiedervereinigung, insbesondere unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktreformen der Bundesregierung.
- Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung und Diskussion der rechtlichen Grundlagen geringfügiger Beschäftigung.
- Sie untersucht den Umfang und die Struktur der geringfügig Beschäftigten anhand verschiedener Datenquellen.
- Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der „Minijob-Reform“ auf die geringfügige Beschäftigung anhand des BA-Beschäftigtenpanels.
- Sie betrachtet die Beschäftigungsaussichten geringfügig entlohnter Beschäftigter und die Rolle der geringfügigen Beschäftigung als Weg aus der Arbeitslosigkeit.
- Die Arbeit geht auf die Frage der sozialen Absicherung geringfügig entlohnter Beschäftigter ein.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung gibt einen Überblick über den deutschen Arbeitsmarkt und die Bedeutung der geringfügigen Beschäftigung.
- Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes und die Gründe für den Vormarsch von geringfügiger Beschäftigung.
- Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung und Diskussion der rechtlichen Grundlagen für die geringfügige Beschäftigung in Deutschland, einschließlich der Reformmaßnahmen „630-DM-Gesetz“ und „Minijob-Reform“.
- Kapitel 4 und 5 analysieren die Datengrundlage geringfügiger Beschäftigung, wobei verschiedene Datenquellen vorgestellt und miteinander verglichen werden.
- Kapitel 6 widmet sich dem BA-Beschäftigtenpanel, seinen Vor- und Nachteilen und dessen Bedeutung für die Analyse der geringfügigen Beschäftigung.
- Kapitel 7 präsentiert empirische Analysen mit dem BA-Beschäftigtenpanel, die sich auf die Beschäftigungsaussichten geringfügig entlohnter Beschäftigter, die Rolle der geringfügigen Beschäftigung als Weg aus der Arbeitslosigkeit und die soziale Absicherung der Beschäftigtengruppe konzentrieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung in Deutschland, die Arbeitsmarktreformen, die rechtlichen Grundlagen, die Datengrundlage, die Analyse des BA-Beschäftigtenpanels, die Beschäftigungsaussichten, den Weg aus der Arbeitslosigkeit und die soziale Absicherung geringfügig entlohnter Beschäftigter.
- Quote paper
- Robert Borm (Author), 2006, Die Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung in Deutschland und die Arbeitsmarktreformen der Bundesregierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73320