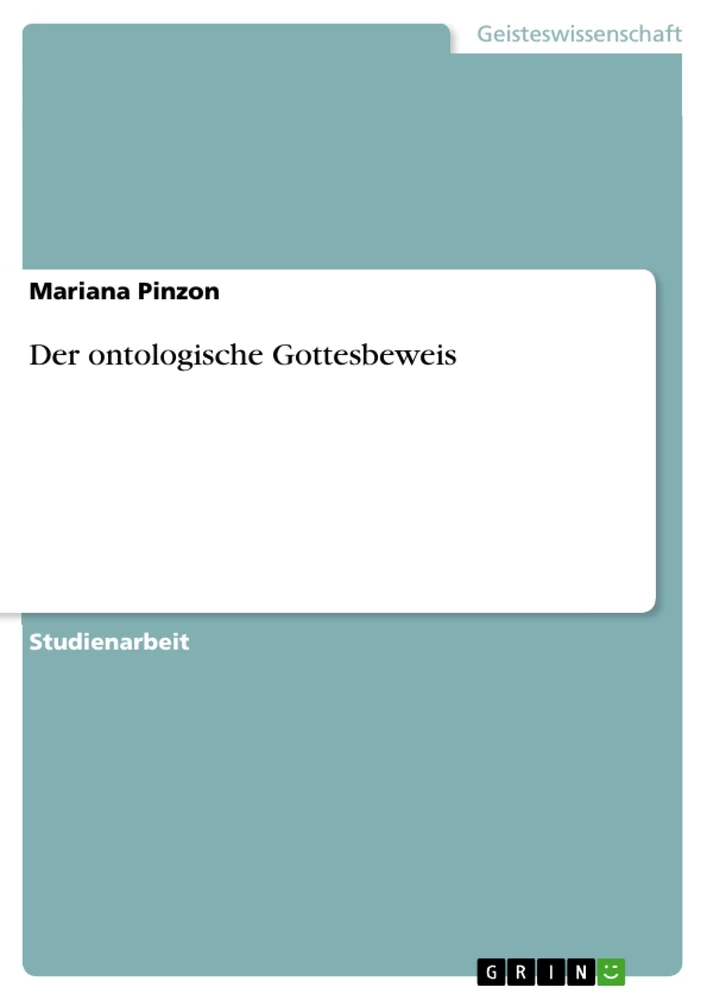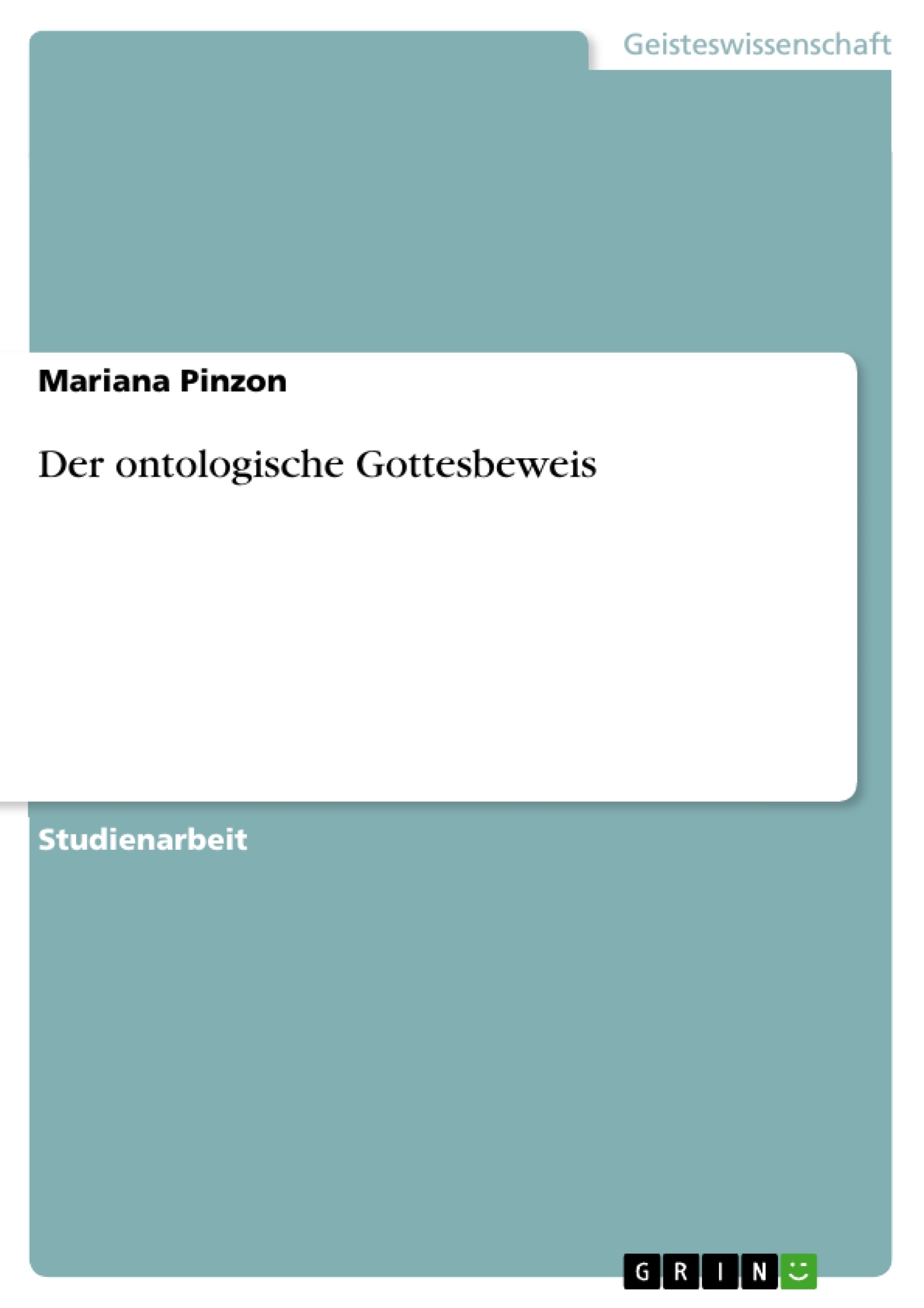Nachdem Descartes die verschiedenen Vorstellungen nach ihrem Sachgehalt und ihren Ursachen überprüft hat, widmet er sich der Vorstellung Gottes „ bei der es zu erwägen ist, ob sie etwas ist, das nicht aus mir selbst hervorgehen konnte“. Aus der Definition des Begriffes Gott als „ eine Substanz, die unendlich, unabhängig, allwissend und allmächtig ist und von der ich selbst geschaffen bin ebenso wie alles andere Existierende, falls es solches gibt“, schließt er dass Gott notwendig existiert, da es ihm unmöglich erscheint, dass eine solch vorzügliche Vorstellung aus ihm entstammt.
Inhalt:
I. Der Gottesbeweis der III. und V. Meditation
II. Der ontologische Gottesbeweis bei Anselm von Canterbury
III. Die Kantische Kritik
IV. Exkurs: Die Gemeinschaft freier Wesen
I. Der Gottesbeweis der III. und V. Meditation
Nachdem Descartes die verschiedenen Vorstellungen nach ihrem Sachgehalt und ihren Ursachen überprüft hat, widmet er sich der Vorstellung Gottes „ bei der es zu erwägen ist, ob sie etwas ist, das nicht aus mir selbst hervorgehen konnte“[1]. Aus der Definition des Begriffes Gott als „ eine Substanz, die unendlich, unabhängig, allwissend und allmächtig ist und von der ich selbst geschaffen bin ebenso wie alles andere Existierende, falls es solches gibt“[2], schließt er dass Gott notwendig existiert, da es ihm unmöglich erscheint, dass eine solch vorzügliche Vorstellung aus ihm entstammt.
Er meint die Idee einer unendlichen Substanz müsse als Ursache eine in Wahrheit unendliche Substanz haben, da er ja selber endlich sei und die Vorstellung des Unendlichen mehr Sachgehalt besitze als die des Endlichen, also nicht von ihm verursacht werden kann. Da die Substanz des Unendlichen mehr Sachegehalt beinhaltet als die des Endlichen, kann der Begriff des Unendlichen nicht als „Verneinung des Endlichen“[3] begriffen werden, weil das Unendliche dem Endlichen vorhergeht. „Erst durch den Vergleich mit dem Vollkommenen kann das Unvollkommene bestimmt werden“[4] ; Descartes geht davon aus, dass wenn es ein Begriff des endlichen Wesen gibt, muss auch eins des unendlichen notwendigerweise vorausgesetzt werden und da die Existenz des denkenden Ich nicht bezweifelt werden kann, kann man auch nicht an der Idee des Unendlichen zweifeln.
Wolfgang Röd fasst die cartesianische Argumentation folgendermaßen zusammen:
„ Ich denke, also bin ich, und zwar als denkende Substanz; ich könnte mich als eine solche Substanz nicht erkennen, wenn ich nicht über die Idee des Unendlichen verfügte; da die Idee des Unendlichen Bedingung der Idee des Ich ist und da ich in unbezweifelbarer Weise existiere, existiert auch das Unendliche.“[5]
Der Gottesbeweis der III. Meditation beruht auf dem Kausalitätsprinzip, demzufolge „ die einer Idee eigene objektive Realität nur von etwas verursacht sein kann, das mindestens ebensoviel aktuale Realität besitzt, wie in der Idee an objektiver Realität enthalten ist“[6].
Der Beweis der V. Meditation dagegen wird vollständig a priori geführt und stützt sich nur auf die Definition von „Gott“ und auf Grundsätze der Ontologie so wie auf die herkömmliche Logik.
Der Satz „Gott existiert“ wird als analytisch wahrer Satz dargestellt, was heißt, dass „Existenz“ im Begriff „Gott“ enthalten sein muss und somit Gott nicht ohne Existenz gedacht werden kann. Da Gott das vollkommenste Wesen ist und Existenz eine Vollkommenheit ist, kann ihm diese Vollkommenheit nicht fehlen. „ Es wiederspricht sich daher ebenso sehr, sich einen Gott, d.h. ein höchst vollkommenes Wesen zu denken, dem das Dasein fehlte, d.h. dem eine gewisse Vollkommenheit mangelte, als einen Berg zu denken ohne Tal.“[7]
In ähnlicher Weise wurde der Gottesbeweis schon im 11. Jh. von Anselm von Canterbury in seinem Werk „Proslogion“ geführt. Anselm ist der erste der den ontologischen Gottesbeweis ( wie er erst später von Kant genant wurde) verwendet.
II. Der ontologische Gottesbeweis bei Anselm von Canterbury
Der ontologische Beweis im „ Proslogion“ stützt sich auf die schon früher geführten Beweise im „Monologion“ , in der er „ aber in den Bahnen der herkömmlichen Platonischen bzw. Aristotelischen Beweisversuche“[8] geblieben ist. In seinem ersten Argument schließt er von der Tatsache aus, dass es Schönes, Gutes und Wahres gibt und deren Teilhabe am Schönen, Guten und Wahren, auf das Gute, Schöne und Wahre an sich. „ Das Gute an sich ... identifizierte Anselm in fragwürdiger Weise mit dem höchsten Guten (summum bonum), also einem Seienden, dem das unüberbietbare Maximum an Güte zukommt.“[9] Daraus konnte er dann folgern das es etwas gibt das den höchsten Grad nimmt und es nichts gibt das es überragen kann, zugleich, dass das höchst Gute auch das höchst Große ist.
Im „Proslogion“ wird dann „Gott als etwas gekennzeichnet, über das hinaus ein größeres gar nicht mehr gedacht werden kann“[10]. Anselm geht davon aus, dass wenn man Gott (das, worüber hinaus nichts größeres gedacht werden kann) leugnet, dann versteht man die Definition von Gott und was man versteht, ist im Verstand. Der nächste Schritt ist zu beweisen, dass Gott nicht nur im Verstand, sondern auch in der Wirklichkeit ist, weil es größer sei sich etwas zu denken, das auch in der Wirklichkeit ist, als etwas das nur im Verstand ist und somit kann Gott nicht nur im Verstand sein, sonst wäre er nicht das worüber hinaus nichts größeres gedacht werden kann. Auch setzt er voraus, dass die notwendige Existenz größer als die bloße Existenz sei und setzt das Denken dessen, als das worüber hinaus nichts größeres gedacht werden kann, ohne Sein als Wiederspruch.
Die Eigenart des Proslogion-Arguments ist, dass es ein indirektes Argument ist, „d.h. von der Negation des zu beweisenden Satzes wird gezeigt, dass sie widerspruchsvoll ist, und daher gefolgert, das die Negation der Negation wahr ist. Wenn der Satz Gott existiert in Wirklichkeit indirekt zu beweisen ist, hat das durch Wiederlegung des Satzes Gott existiert nicht in Wirklichkeit zu geschehen.“[11]
Trotz der ganzen Axiomen und Theoremen die Anselm aufstellte, fand der ontologische Gottesbeweis nur zögernd Anerkennung. Erst in der Metaphysik des 17. und 18. Jh. wurde das Argument wieder belebt.
III. Die Kantische Kritik
Die kantische Kritik richtet sich gegen den Anspruch, den die Vertreter des ontologischen Gottesbeweises machten, den Satz „Gott existiert“ als analytisch wahren Satz erweisen zu können.
Kant vertritt die Meinung, dass jeder Existentialsatz ein synthetischer Satz sei: „Gesteht ihr dagegen, wie es billigermaßen jeder Vernünftige gestehen muß, daß ein jeder Existenzialsatz synthetisch sei, wie wollet ihr denn behaupten, daß das Prädikat der Existenz sich ohne Widerspruch nicht aufheben lasse ? da dieser Vorzug nur den analytischen, als deren Charakter eben darauf beruht, eigentümlich zukommt.“[12] Wenn „Gott existiert“ als analytisch wahr gelten sollte, dann müsste „Gott existiert nicht“ wiederspruchsvoll sein, doch Wiederspruch liegt nur da vor, „wo von einem Subjekt-Begriff eine Bestimmung prädiziert wird, durch die eine Bestimmung des Subjekts negiert wird.“[13] Bei negativen Existentialsätzen aber, wird das Subjekt samt der Prädikate aufgehoben und es kann kein Widerspruch entstehen, „denn es ist nichts mehr, welchem widersprochen werden könnte. [...] Gerade eben so ist es mit dem Begriffe eines absolutnotwendigen Wesens bewandt. Wenn ihr das Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Prädikaten auf; wo soll alsdenn der Widerspruch herkommen?“[14]
[...]
[1] Med. III. § 22. S.83 – Zitate und Seitenzahlen beziehen sich auf die Ausgabe: Descartes, René, Meditationes de prima philosphia, lateinisch-deutsch, Hamburg: Meiner, 1992
[2] ebda
[3] ebda §24
[4] Röd, Wolfgang, „Der Gott der Reinen Vernunft“, München: Beck 1992 , S. 72
[5] Röd, Wolfgang ebda S.73
[6] Röd, Wolfgang ebda S.64
[7] Med. V. §8 S. 121
[8] Röd, Wolfgang ebda. S. 23
[9] Röd, Wolfgang ebda. S.24
[10] ebda.
[11] Röd, Wolfgang S.33
[12] [Kant: Kritik der reinen Vernunft, S. 698. Die digitale Bibliothek der Philosophie, S. 27765 (vgl. Kant-W Bd. 4, S. 533)]
[13] Röd, Wolfgang ebda. S.154
[14] [Kant: Kritik der reinen Vernunft, S. 695. Die digitale Bibliothek der Philosophie, S. 27762 (vgl. Kant-W Bd. 4, S. 531)]
- Quote paper
- Mariana Pinzon (Author), 2003, Der ontologische Gottesbeweis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73319