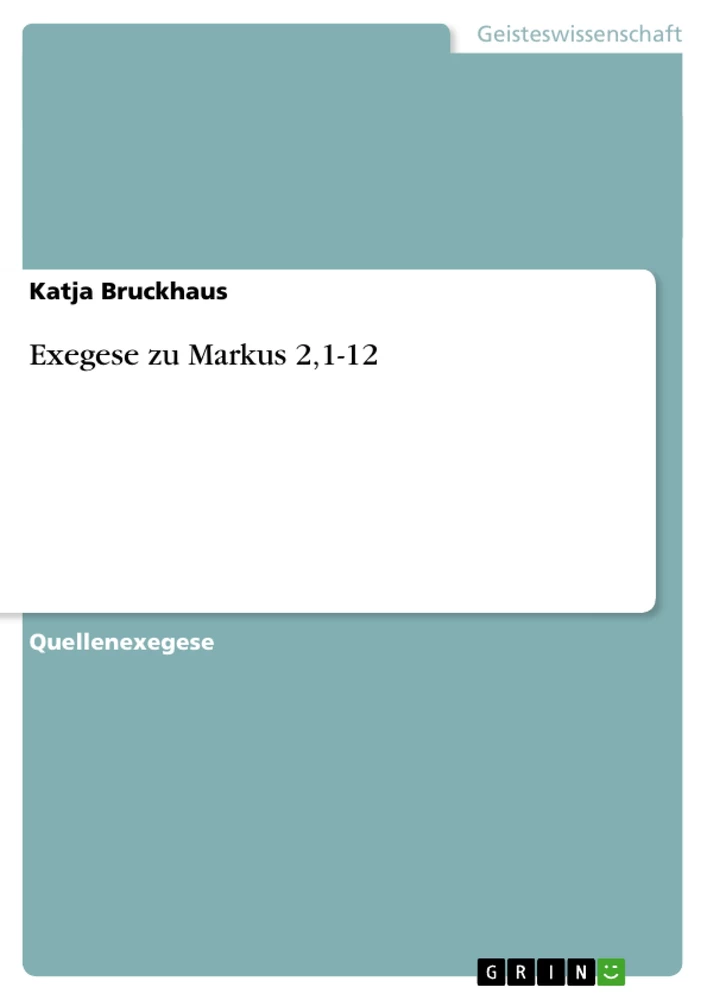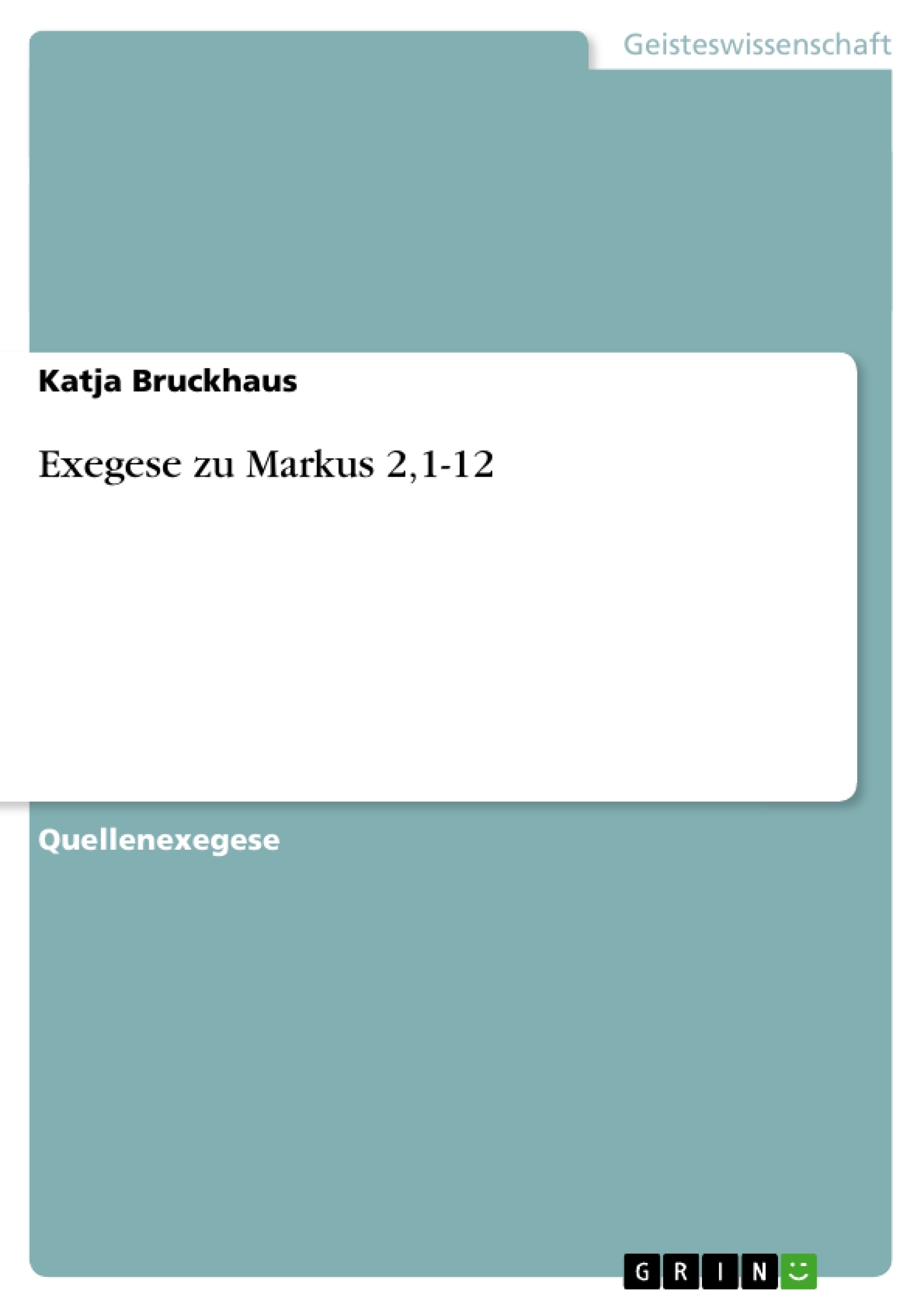In diesem Schritt vergleiche ich verschiedene Übersetzungen derselben Perikope und stelle die wichtigsten Unterschiede dar.
Zusätzlich zum Text der Zürcher Bibel habe ich sechs weitere Übersetzungen betrachtet: das Münchner Neue Testament, die Einheitsübersetzung, das Neue Testament nach Ulrich Wilckens, die Übersetzung Martin Luthers, die Bibel in heutigem Deutsch (Gute Nachricht) und das Neue Testament übertragen von J. Zink.
Zu Beginn möchte ich die verschiedenen Übersetzungen in zwei Gruppen aufteilen.
Zum einen gibt es die Gruppe der formalen Übersetzungen, wozu die Bibel nach der Übersetzung Luthers, die Zürcher Bibel und das Münchner Neue Testament zählen. Die formale Übersetzung zeichnet sich dadurch aus, dass sie in ihrem Wortlaut relativ (Luther und Zürcher Bibel) bzw. exakt (Münchner Neues Testament) dem griechischen Ursprungstext entsprechen.
Zum anderen gibt es die Gruppe der dynamisch-gleichwertigen Übersetzungen, wozu die Einheitsübersetzung, das Neue Testament nach Ulrich Wilckens, das Neue Testament nach J. Zink und die Gute Nachricht zählen. Die dynamisch gleichwertige Übersetzung verfolgt die Absicht, auf den Leser die gleiche Wirkung zu erzielen, wie es der Urtext auf die damaligen Leser getan hat.
Für den Übersetzungsvergleich ist diese Einteilung nicht ganz uninteressant, denn die Unterschiede lassen sich meist auch nach Art der Übersetzung gruppieren.
Im Folgenden werde ich mir die zwei gravierendsten Unterschiede der verschiedenen Übersetzungen unserer Perikope herausnehmen und näher beleuchten.
Der erste Unterschied wird im ersten Vers sichtbar.
Inhaltsverzeichnis
- Übersetzungsvergleich
- Textabgrenzung
- Kontextanalyse
- Strukturanalyse
- Synoptischer Vergleich
- Vergleich Markus - Matthäus
- Vergleich Markus – Lukas
- Literarkritik
- Formgeschichte
- Dekomposition
- Gattungszuordnung
- Sitz im Leben
- Redaktionsgeschichte/Kompositionskritik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Perikope Markus 2,1-12 anhand verschiedener exegetischer Methoden. Ziel ist es, die verschiedenen Interpretationen und Übersetzungen des Textes zu vergleichen und zu analysieren, um ein tieferes Verständnis des ursprünglichen Sinns und der theologischen Bedeutung zu erlangen.
- Übersetzungsvergleich verschiedener Bibelübersetzungen
- Analyse der literarischen Struktur des Textes
- Anwendung formgeschichtlicher Methoden
- Untersuchung der redaktionsgeschichtlichen Aspekte
- Vergleich mit parallelen Stellen in Matthäus und Lukas
Zusammenfassung der Kapitel
Übersetzungsvergleich: Dieser Abschnitt vergleicht verschiedene deutsche Bibelübersetzungen von Markus 2,1-12, unterscheidet zwischen formalen und dynamisch-gleichwertigen Übersetzungen und analysiert die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Herangehensweisen auf die Bedeutung des Textes. Besonders hervorgehoben werden die Unterschiede in der Formulierung der Lokalisierung Jesu ("im Haus" vs. "zu Hause") und in der Betonung der Macht Jesu, Sünden zu vergeben. Die Analyse zeigt, wie unterschiedliche Übersetzungsprinzipien zu verschiedenen Lesarten und Interpretationen führen können, was für das Verständnis des Textes von Bedeutung ist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Exegese von Markus 2,1-12
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Perikope Markus 2,1-12 unter Anwendung verschiedener exegetischer Methoden. Ziel ist ein tieferes Verständnis des ursprünglichen Sinns und der theologischen Bedeutung des Textes.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen breiten Ansatz, der Übersetzungsvergleich, Textabgrenzung, Kontextanalyse, Strukturanalyse, synoptischen Vergleich (Markus mit Matthäus und Lukas), Literarkritik, Formgeschichte (Dekomposition, Gattungszuordnung, Sitz im Leben) und Redaktionsgeschichte/Kompositionskritik umfasst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Übersetzungsvergleich, Textabgrenzung, Kontextanalyse, Strukturanalyse, synoptischem Vergleich (Markus-Matthäus und Markus-Lukas), Literarkritik, Formgeschichte (mit Unterkapiteln zu Dekomposition, Gattungszuordnung und Sitz im Leben), Redaktionsgeschichte/Kompositionskritik und einem Literaturverzeichnis.
Was wird im Kapitel "Übersetzungsvergleich" behandelt?
Der Übersetzungsvergleich analysiert verschiedene deutsche Bibelübersetzungen von Markus 2,1-12, differenziert zwischen formalen und dynamisch-gleichwertigen Übersetzungen und untersucht die Auswirkungen auf die Textbedeutung. Besonders im Fokus stehen Unterschiede in der Lokalisierung Jesu ("im Haus" vs. "zu Hause") und der Betonung der Macht Jesu, Sünden zu vergeben. Die Analyse zeigt, wie unterschiedliche Übersetzungsprinzipien zu verschiedenen Lesarten und Interpretationen führen.
Welche weiteren Themen werden behandelt?
Neben dem Übersetzungsvergleich werden die literarische Struktur des Textes analysiert, formgeschichtliche Methoden angewendet, redaktionsgeschichtliche Aspekte untersucht und Vergleiche mit parallelen Stellen in Matthäus und Lukas gezogen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, durch den Vergleich und die Analyse verschiedener Interpretationen und Übersetzungen von Markus 2,1-12 ein tieferes Verständnis des ursprünglichen Sinns und der theologischen Bedeutung des Textes zu erlangen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe umfassen (aber sind nicht beschränkt auf): Exegese, Markus 2,1-12, Übersetzungsvergleich, Formgeschichte, Redaktionsgeschichte, Synoptische Evangelien, Kontextanalyse, Literarkritik, Textkritik.
- Quote paper
- Katja Bruckhaus (Author), 2005, Exegese zu Markus 2,1-12, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73259