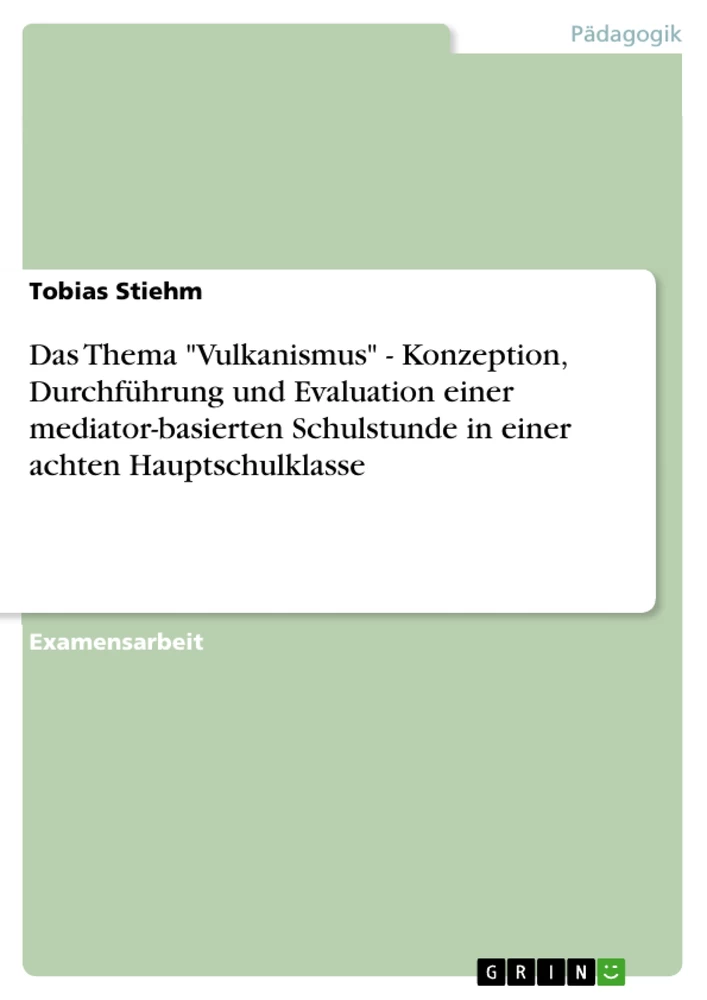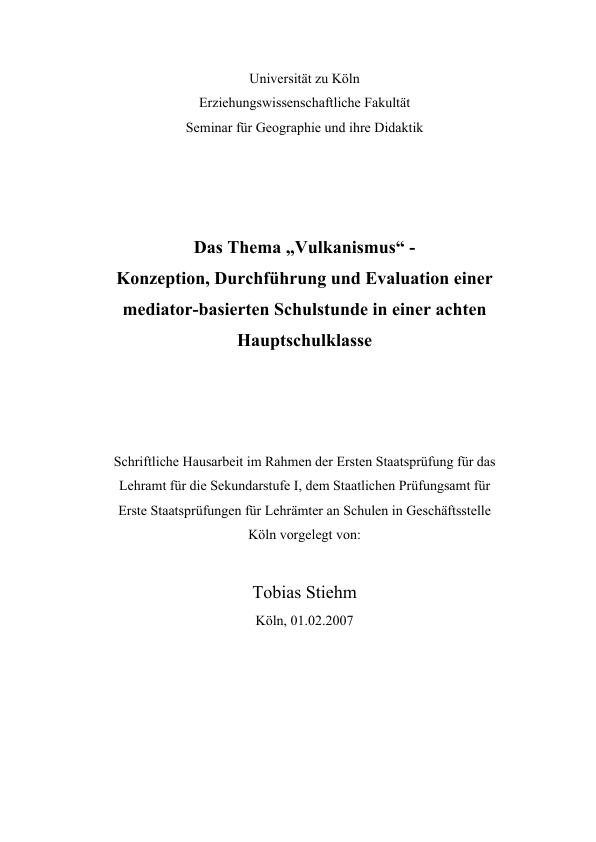Der Blick in ein Kinderzimmer lässt es heute erahnen. Ob Radio, Fernseher, Handy oder Computer, Neue Medien prägen die Lebenswelt sowohl von Kindern als auch Erwachsenen und bestimmen unser Leben in sämtlichen Bereichen. Sie sind eine notwendige Voraussetzung für viele Berufe, dienen als Kommunikationsmedium in Form von Internet und Email, rufen Angstgefühl beim Milleniumsjahreswechsel hervor und existieren sowohl als Informations- als auch Unterhaltungsmedium. Die Begegnungspunkte zwischen Mensch und Medium sind so allgegenwärtig und vielfältig, dass es zu konträren Einschätzungen wie auf der einen Seite „Medien als Segen“ sowie auf der anderen Seite „Medien als Fluch“ kommt. Hierüber kann ein mündiger Mensch nur urteilen, wenn er mit ihnen umzugehen versteht, entziehen kann er sich ihnen nicht.
Als roten Faden für meine Arbeit habe ich folgenden Aufbau gewählt:
Ich habe meine Arbeit in einen theoretischen und praktischen Teil getrennt. Zu Beginn sollen im theoretischen Teil unter Punkt II-1 die fachwissenschaftlichen Aspekte von Vulkanismus dargestellt werden, die die Grundlage für die Umsetzung in ein Lernprogramm und daher die Basis der Informationen bilden. Anschließend gehe ich in Punkt II-2 näher auf die Methodik meiner Unterrichtsstunde ein, nämlich die Umsetzung in eine Computereinheit. Dazu beschäftige ich mich zunächst mit den Neuen Medien, die dann allerdings im weiteren Verlauf der Analyse auf Lernsoftwaretypen eingegrenzt werden. Im Anschluss daran behandle ich mit der Untersuchung der Medienkompetenz in Punkt II-3 die didaktische Dimension Neuer Medien, die überhaupt erst den Einsatz im Unterricht rechtfertigt. Im abschließenden Punkt II-4 des theoretischen Teils stelle ich grundsätzliche Vorüberlegungen an, die der Konzeption eines Lernprogrammes vorausgehen.
Mit Punkt III-1 wende ich mich dann dem praktischen Teil meiner Arbeit zu. Hier greife ich das Autorensystem Mediator auf und stelle es kurz vor. Den größten Teil der Arbeit nimmt Punkt III-2 ein. Hier begründe ich konkret die Konzeption meines Lernprogrammes anhand einzelner Beispiele und lasse dessen Bewertung durch die SchülerInnen aus der Evaluation mit einfließen. Hierbei beziehe ich mich auf die im theoretischen Teil gewonnen Erkenntnisse. Der praktische Teil meiner Arbeit schließt mit Punkt III-3, worin die Ergebnisse der auf die Schulstunde folgenden Lernstandserhebung ausgewertet werden und untersucht wird, ob die angestrebten Lernziele von den SchülerInnen erreicht wurden.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Allgemeine theoretische Grundlagen
- 1 Vulkanismus
- 1.1 Plattentektonik
- 1.2 Definition
- 1.3 Magma
- 1.4 Lava
- 1.4.1 Basaltische Laven
- 1.4.2 Rhyolithische Laven
- 1.4.3 Andesitische Laven
- 1.5 Vulkantypen
- 1.5.1 Schichtvulkane
- 1.5.2 Schildvulkan
- 1.5.3 Calderen
- 1.5.4 Plateaubasalte
- 1.5.5 Schlackenkegel
- 1.6 Vorkommen an aktiven Vulkanzonen
- 1.6.1 Vulkanismus an divergenten Plattengrenzen
- 1.6.2 Vulkanismus an konvergenten Plattengrenzen
- 1.6.3 Intraplatten-Vulkanismus
- 2 Neue Medien
- 2.1 Definition des Medienbegriffs
- 2.2 Kennzeichen Neuer Medien
- 2.2.1 Computerunterstützung
- 2.2.2 Multimedialität
- 2.2.3 Multicodalität
- 2.2.4 Multimodalität
- 2.2.5 Hypermedialität (Vernetzung)
- 2.2.6 Interaktivität
- 2.2.7 Offenheit
- 2.3 (Lern-) Software als ein Teil Neuer Medien
- 2.3.1 Sonderform Autorensysteme
- 2.3.2 Kontextfreie Anwendungsprogramme
- 2.3.3 Inhaltsgebundene Multimediaprogramme
- 2.3.4 Klassifizierung von Erdkundesoftware
- 2.4 Sind Neue Medien gleich Neue Medien?
- 3 Medienkompetenz
- 3.1 Medienkunde
- 3.2 Medienumgang
- 3.3 Medienkritik
- 3.4 Medienselbstbestimmung
- 3.5 Mediengestaltung
- 3.6 Medienkommunikation
- 4 Die Zielgruppenanalyse als Vorüberlegung zur Konzeption eines Lernprogramms
- 4.1 Soziodemographische Merkmale
- 4.2 Vorwissen
- 4.3 Lernmotivation
- 4.4 Lerndauer
- 4.5 Einstellungen und Erfahrungen
- III Praxis
- 1 Mediator: Vorstellung und Klassifizierung
- 2 Didaktische Begründung der Konzeption und Evaluation
- 2.1 Zielgruppenanalyse
- 2.1.1 Soziodemographische Merkmale
- 2.1.2 Vorwissen
- 2.1.3 Lernmotivation
- 2.1.4 Lerndauer
- 2.1.5 Einstellungen und Erfahrungen
- 2.2 Definition der Lernziele
- 2.3 Umsetzung der Merkmale Neuer Medien in meinem Lehrprogramm
- 2.3.1 Computerunterstützung
- 2.3.2 Multimedialität
- 2.3.3 Multimodalität
- 2.3.4 Multicodalität
- 2.3.5 Hypermedialität und Offenheit
- 2.3.6 Interaktivität
- 2.4 Weitere visuelle und akustische Elemente
- 2.4.1 Texte
- 2.4.2 Bilder
- 2.4.3 Tondokumente bzw. Klänge
- 2.4.4 Videos
- 2.5 Zusammenfassung und Klassifizierung
- 3 Ergebnisse der Lernstandserhebung
- 3.1 Auswertung des Tests im Hinblick auf die Lernziele
- 3.2 Auswertung des Tests im Hinblick auf Geschlecht und Migrationsstatus
- IV Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption, Durchführung und Evaluation einer mediator-basierten Schulstunde zum Thema Vulkanismus in einer achten Hauptschulklasse. Die Hauptziele sind die Untersuchung der Lernmotivation durch computergestützten Unterricht, die Erreichung vorgegebener Lernziele und die Bewertung des computergestützten Unterrichts im Vergleich zu konventionellen Methoden.
- Vulkanismus und Plattentektonik
- Neue Medien im Unterricht und Medienkompetenz
- Didaktische Konzeption und Gestaltung von Lernsoftware
- Evaluation des Lernprogramms und Lernerfolgs
- Vergleich konventioneller und computergestützter Unterrichtsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Neuen Medien und deren Bedeutung im Bildungskontext ein. Sie beschreibt den Hintergrund der Arbeit, die positive Erwartungshaltung an computergestützten Unterricht und formuliert die zentralen Forschungsfragen. Der Aufbau der Arbeit mit einem theoretischen und einem praktischen Teil wird skizziert.
II Allgemeine theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die fachwissenschaftlichen Grundlagen für die Erstellung des Lernprogramms. Es behandelt ausführlich den Vulkanismus, beginnend mit der Plattentektonik, der Definition von Vulkanen, Magma und Lava, verschiedenen Vulkantypen und deren geographischer Verteilung. Anschließend wird der Begriff der Neuen Medien definiert und deren charakteristische Merkmale (Multimedialität, Interaktivität, Hypermedialität etc.) werden analysiert. Der Abschnitt zur Medienkompetenz beleuchtet die Bedeutung von Medienkunde, Medienumgang, Medienkritik, Medienselbstbestimmung, Mediengestaltung und Medienkommunikation im Bildungsbereich. Abschließend widmet sich das Kapitel der Zielgruppenanalyse als Vorüberlegung für die Konzeption eines Lernprogramms.
III Praxis: Der Praxis-Teil präsentiert die didaktische Begründung der Konzeption und Evaluation des Lernprogramms. Es wird das Autorensystem Mediator vorgestellt und seine Eignung für die Erstellung des Lernprogramms erläutert. Die Zielgruppenanalyse wird auf die konkrete Untersuchungsgruppe angewandt, die Lernziele werden definiert und die Umsetzung der Merkmale Neuer Medien im Lernprogramm wird detailliert beschrieben. Die Auswertung der Lernstandserhebung bezüglich der Lernziele, sowie im Hinblick auf Geschlecht und Migrationsstatus wird präsentiert.
Schlüsselwörter
Vulkanismus, Plattentektonik, Neue Medien, Medienkompetenz, Lernsoftware, Mediator, Didaktik, Evaluation, Lernmotivation, Zielgruppenanalyse, Hauptschule, computergestützter Unterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konzeption, Durchführung und Evaluation einer mediator-basierten Schulstunde zum Thema Vulkanismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konzeption, Durchführung und Evaluation einer mediator-basierten Schulstunde zum Thema Vulkanismus in einer achten Hauptschulklasse. Es wird die Lernmotivation durch computergestützten Unterricht, die Erreichung vorgegebener Lernziele und der Vergleich zu konventionellen Methoden bewertet.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil behandelt ausführlich den Vulkanismus (Plattentektonik, Magma, Lava, Vulkantypen, Vorkommen), Neue Medien (Definition, Merkmale wie Multimedialität, Interaktivität, Hypermedialität), Medienkompetenz (Medienkunde, -umgang, -kritik, -selbstbestimmung, -gestaltung, -kommunikation) und die Zielgruppenanalyse für die Lernprogramm-Konzeption.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in Einleitung, Allgemeine theoretische Grundlagen (Vulkanismus, Neue Medien, Medienkompetenz, Zielgruppenanalyse), Praxis (Mediator, Didaktische Begründung, Ergebnisse der Lernstandserhebung) und Resümee. Die Kapitel sind weiter untergliedert in Abschnitte und Unterabschnitte mit detaillierten Beschreibungen der einzelnen Themenbereiche.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Hauptziele sind die Untersuchung der Lernmotivation durch computergestützten Unterricht, die Erreichung vorgegebener Lernziele und die Bewertung des computergestützten Unterrichts im Vergleich zu konventionellen Methoden. Es geht um die didaktische Konzeption und Gestaltung von Lernsoftware mit dem Autorensystem Mediator.
Welche Methoden werden angewendet?
Es wird eine mediator-basierte Schulstunde zum Thema Vulkanismus durchgeführt und evaluiert. Die Evaluation umfasst die Auswertung eines Tests im Hinblick auf die Lernziele, sowie im Hinblick auf Geschlecht und Migrationsstatus der Schüler. Die Ergebnisse werden zur Bewertung des computergestützten Unterrichts im Vergleich zu konventionellen Methoden herangezogen.
Welche Software wird verwendet?
Das Autorensystem Mediator wird zur Erstellung des Lernprogramms verwendet. Die Arbeit beschreibt detailliert die Umsetzung der Merkmale Neuer Medien (Computerunterstützung, Multimedialität, Multimodalität, Multicodalität, Hypermedialität, Interaktivität und Offenheit) innerhalb dieses Programms.
Welche Zielgruppe wird untersucht?
Die Zielgruppe ist eine achte Hauptschulklasse. Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Zielgruppenanalyse, die soziodemografische Merkmale, Vorwissen, Lernmotivation, Lerndauer und Einstellungen der Schüler berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Vulkanismus, Plattentektonik, Neue Medien, Medienkompetenz, Lernsoftware, Mediator, Didaktik, Evaluation, Lernmotivation, Zielgruppenanalyse, Hauptschule und computergestützter Unterricht.
Wie wird der Praxis-Teil strukturiert?
Der Praxis-Teil beschreibt die didaktische Begründung der Konzeption und Evaluation des Lernprogramms. Er beinhaltet die Vorstellung von Mediator, die Anwendung der Zielgruppenanalyse, die Definition der Lernziele, die Umsetzung der Merkmale Neuer Medien im Lernprogramm und die Auswertung der Lernstandserhebung.
Was sind die Ergebnisse der Lernstandserhebung?
Die Ergebnisse der Lernstandserhebung werden im Hinblick auf die Lernziele sowie im Hinblick auf Geschlecht und Migrationsstatus ausgewertet und interpretiert. Diese Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse zur Effektivität des computergestützten Unterrichts.
- Quote paper
- Tobias Stiehm (Author), 2007, Das Thema "Vulkanismus" - Konzeption, Durchführung und Evaluation einer mediator-basierten Schulstunde in einer achten Hauptschulklasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73241