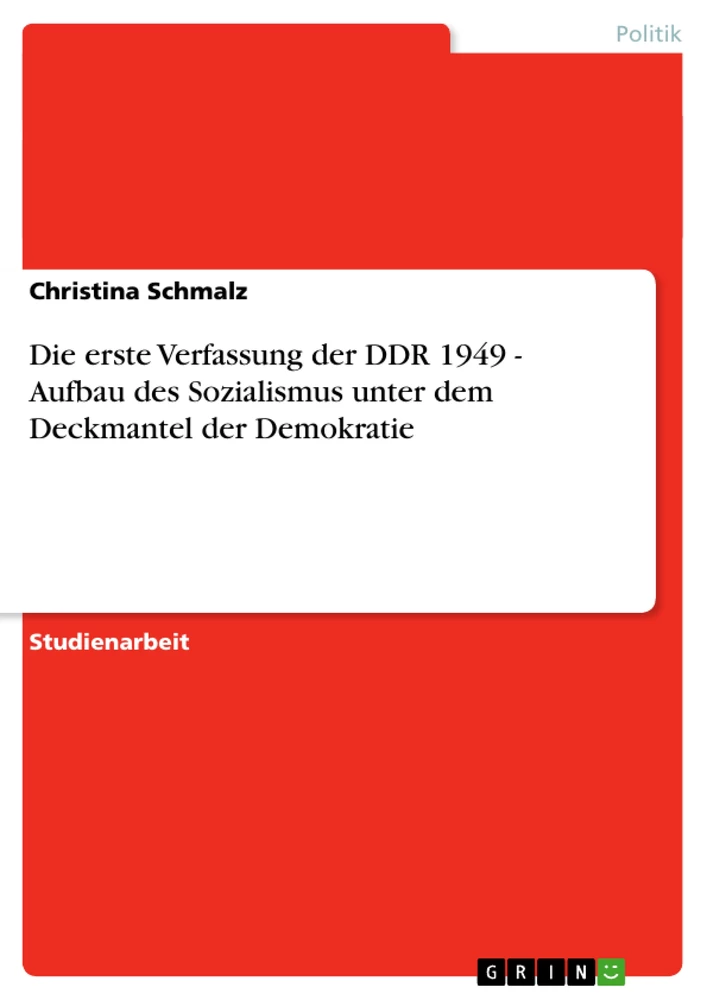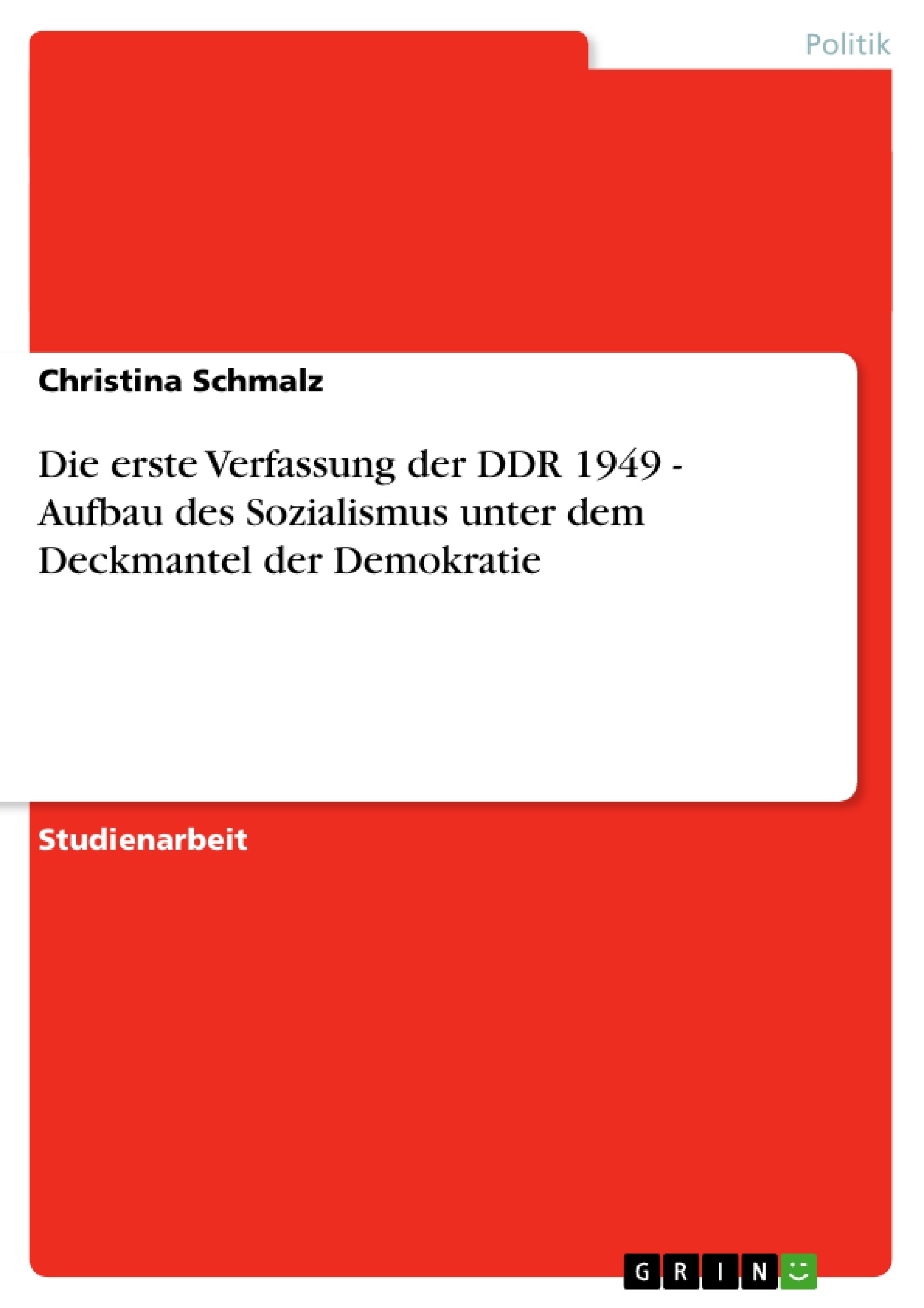In meiner Arbeit habe ich mir drei für mich wichtige Kriterien eines demokratischen Systems herausgezogen: Wahlen, Presse und Justiz. Ausgegangen bin ich von den „westlichen“ Kriterien einer demokratischen Umsetzung dieser drei Komponenten und habe im folgenden den Wortlaut bzw. die Aussagen des entsprechenden Verfassungsauszuges auf seine praktische Umsetzung unter Führung der SED hin analysiert.
Orientiert habe ich mich bei dieser Aufteilung vor allem an der Publikation von Katja Schweizer mit dem Thema „Täter und Opfer in der DDR“. Schweizer ging bei ihrer Analyse der SED- Diktatur nach einem ähnlichen Schema vor. Sie bezeichnet die Elemente Journalismus, Justiz und Ministerium für Staatssicherheit als Stützpfeiler der SED- Herrschaftsausübung und -sicherung. Ich hingegen habe mich für die Teilgebiete Wahlen, Presse und Justiz entschieden, da sich anhand deren Umsetzung sehr deutlich die Gewährleistung der in der Verfassung verbürgten Grundrechte überprüfen lässt. Ausgegangen bin ich dabei von den „westlichen“ Kriterien eines demokratischen Systems. „Westlich“ aus dem Grunde, dass es beispielsweise auch im Sozialismus den Begriff der Demokratie gab, welcher allerdings mit anderen Inhalten besetzt war. Mit dem Westen verbindet man heute im allgemeinen demokratische Systeme, die sich zwar verfassungsrechtlich unterscheiden können (siehe parlamentarisches und präsidentielles System), in ihren Grundzügen jedoch übereinstimmen bezüglich der Auffassung von Demokratie. Da die erste DDR- Verfassung klar darauf ausgerichtet war, dem Westen eben dieses Bild des Aufbaus eines demokratischen Systems in ihrem Sinne zu vermitteln, entschied ich mich für diese Kategorisierung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Historischer Hintergrund 1945-49
- III. Wahlen
- III.1 Verfassungsauszug
- III.2 „Westliche“ Kriterien einer demokratischen Wahl
- III.3 Wahlgrundsätze der DDR-Wahlen
- III.4 Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der DDR-Wahlen
- III.5 Wahlsystem in der Praxis
- III.6 Fazit
- IV. Presse
- IV.1 Verfassungsauszug
- IV.2 „Westliche“ Kriterien der Presse- und Meinungsfreiheit
- IV.3 Presse in der DDR - vorauseilender Gehorsam und indirekte Zensur
- IV.4 Fazit
- V. Justiz
- V.1 Verfassungsauszug
- V.2 „Westliche“ Kriterien einer unabhängigen und gerechten Justiz
- V.3 Aufbau und Wirkungsweise der DDR-Justiz
- V.4 Unrecht durch die DDR-Justiz
- V.4.1 Die Waldheim-Prozesse
- V.4.2 Der Fall Fricke
- V.5 Fazit
- VI. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwieweit die DDR-Führung bis 1968 dem in der Verfassung formulierten demokratischen Anspruch gerecht wurde und die Grund- und Menschenrechte gewährleistete. Hierzu werden die Bereiche Wahlen, Presse und Justiz anhand „westlicher“ Kriterien analysiert und mit den entsprechenden Verfassungsauszügen verglichen.
- Analyse der DDR-Wahlen im Kontext westlicher Demokratieverständnisse
- Untersuchung der Pressefreiheit und Meinungsäußerung in der DDR
- Bewertung der Unabhängigkeit und Gerechtigkeit der DDR-Justiz
- Vergleich der Verfassungsaussagen mit der tatsächlichen Praxis
- Einordnung der DDR-Verfassung im Kontext der Nachkriegsordnung Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Ausmaß der Einhaltung demokratischer Prinzipien in der DDR bis 1968. Sie begründet die Auswahl der Kriterien Wahlen, Presse und Justiz und erläutert die Methodik, die auf einem Vergleich mit „westlichen“ Demokratiestandards basiert. Die Auswahl der Kriterien wird mit der Arbeit von Katja Schweizer verbunden, welche Journalismus, Justiz und Ministerium für Staatssicherheit als Stützpfeiler der SED-Herrschaft identifiziert. Der Text problematisiert die unterschiedlichen Demokratieverständnisse und die Herausforderungen der Quellenanalyse, insbesondere im Hinblick auf die Propaganda der DDR und die Schwierigkeiten der Forschung vor der Wiedervereinigung.
II. Historischer Hintergrund 1945-49: Dieses Kapitel beschreibt die unmittelbare Nachkriegszeit in der SBZ und den Aufbau der DDR. Es beleuchtet die Rolle der SMAD, die Gründung von Parteien (SED, CDUD, LDP, etc.) und die Entwicklung des „Antifa-Blocks“. Die Bedeutung der Blocklistenwahl und die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen der Alliierten werden hervorgehoben, die letztendlich zur Teilung Deutschlands führten. Die Gründung des Deutschen Volksrates und die Entwicklung zur Verfassung der DDR werden detailliert dargestellt. Die Herausbildung des SED-Regimes und seiner Machtsicherung mittels der Kontrolle von Parteien und Organisationen wird als wichtiger Kontext für die folgenden Kapitel dargestellt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse der DDR-Demokratie bis 1968
Was ist der Gegenstand der Analyse in diesem Text?
Der Text analysiert, inwieweit die DDR-Führung bis 1968 dem in der Verfassung formulierten demokratischen Anspruch gerecht wurde und die Grund- und Menschenrechte gewährleistete. Die Analyse konzentriert sich auf die Bereiche Wahlen, Presse und Justiz.
Welche Methodik wird in der Analyse verwendet?
Die Analyse vergleicht die Praxis in der DDR mit „westlichen“ Kriterien und Standards für Demokratie, Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz. Verfassungsauszüge der DDR werden mit der tatsächlichen politischen Praxis verglichen.
Welche Bereiche werden im Detail untersucht?
Der Text untersucht detailliert die DDR-Wahlen (inkl. Wahlsystem, Verfassungsgrundlagen und Vergleich mit westlichen Wahlkriterien), die Pressefreiheit (inkl. Zensur, Verfassungsgrundlagen und Vergleich mit westlichen Kriterien) und die Funktionsweise der DDR-Justiz (inkl. Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Vergleich mit westlichen Kriterien und Beispielen von Unrecht wie den Waldheim-Prozessen und dem Fall Fricke).
Welche Quellen werden verwendet?
Der Text bezieht sich auf die DDR-Verfassung und vergleicht diese mit westlichen Demokratie-Standards. Er bezieht sich auch auf die Arbeit von Katja Schweizer, welche Journalismus, Justiz und Ministerium für Staatssicherheit als Stützpfeiler der SED-Herrschaft identifiziert. Die Herausforderungen der Quellenanalyse, insbesondere im Hinblick auf die DDR-Propaganda und die Schwierigkeiten der Forschung vor der Wiedervereinigung, werden thematisiert.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Historischer Hintergrund (1945-1949), Wahlen, Presse, Justiz und Zusammenfassung. Jedes Kapitel zu Wahlen, Presse und Justiz beinhaltet einen Verfassungsauszug, einen Vergleich mit westlichen Kriterien und eine Analyse der Praxis in der DDR.
Was ist die zentrale Forschungsfrage des Textes?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Inwieweit hat die DDR-Führung bis 1968 die in der Verfassung verankerten demokratischen Prinzipien und Grundrechte eingehalten?
Welche Rolle spielt der historische Kontext von 1945-1949?
Das Kapitel zum historischen Hintergrund beschreibt die unmittelbare Nachkriegszeit in der SBZ, den Aufbau der DDR, die Rolle der SMAD, die Gründung der Parteien und die Entwicklung des „Antifa-Blocks“. Es legt den Kontext für die spätere Entwicklung des SED-Regimes und seiner Machtsicherung dar.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden in der Zusammenfassung des Textes präsentiert und basieren auf dem Vergleich der Verfassungsaussagen mit der tatsächlichen politischen Praxis in den Bereichen Wahlen, Presse und Justiz.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: DDR, Demokratie, Wahlen, Pressefreiheit, Justiz, Verfassung, SED, „westliche“ Kriterien, Grundrechte, Menschenrechte, Propaganda, Zensur, Waldheim-Prozesse, Fall Fricke, Antifa-Block, Blocklistenwahl.
- Quote paper
- Christina Schmalz (Author), 2002, Die erste Verfassung der DDR 1949 - Aufbau des Sozialismus unter dem Deckmantel der Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73202