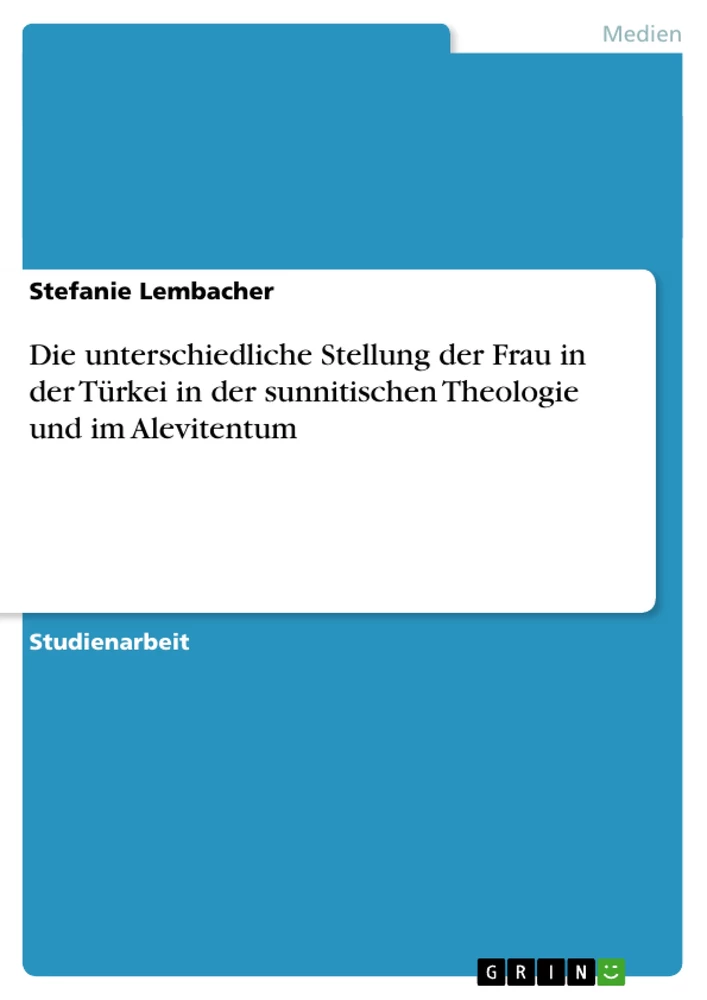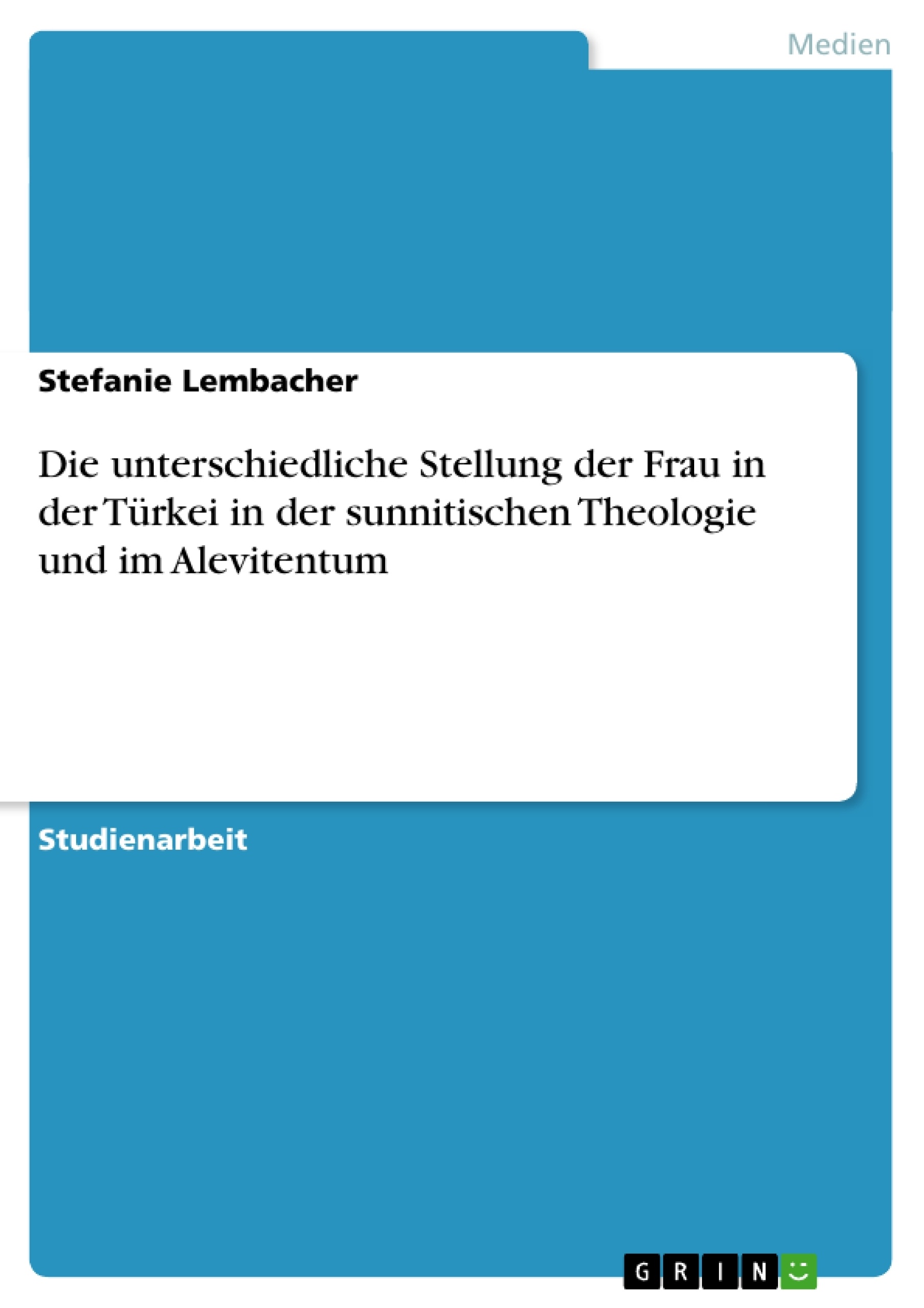Die Stellung der Frau differiert nicht nur von Land zu Land beträchtlich, sondern es gibt sogar innerhalb der Türkei unterschiedlichste Standpunkte. Es ist zu bedenken, dass der Islam trotz einer allumfassenden Ideologie verschiedene kulturelle Traditionen und ethische Elemente umfasst und die islamischen Konfessionen den Koran unterschiedlich auslegen. Diese Arbeit befasst sich mit den beiden größten konfessionellen Gruppe in der Türkei, den Sunniten sowie mit der Glaubensgemeinschaft der Aleviten, die sich in ihrer Theorie und teilweise Praxis extrem unterscheiden.
70-80 % der muslimischen Türken bekennen sich zum sunnitischen Islam, der Rest ist dem Alevitentum zugehörig, wobei unterstrichen werden muss, dass es sich mangels offizieller Statistiken, und aufgrund der Tatsache, dass die Aleviten in ihrer Heimat nicht als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt werden, hierbei um Schätzungen handelt. Der traditionelle Erbfolgekonflikt zwischen sunnitischem und schiitischem Islam sorgt seit jeher auch für Spannungen zwischen Sunniten und Aleviten in der Türkei. Hierbei ging es um die Frage, wer nach dem Tod des Propheten Mohammed im Jahre 632 n. Chr. die legitime Nachfolge als Oberhaupt aller Muslime antreten sollte. Die späteren Sunniten favorisierten Kandidaten aus dem Kreis der Weggefährten des Propheten, die Schiiten hingegen wollten, dass ein Mitglied der Prophetenfamilie - sein Schwiegersohn und Vetter Ali Ibn Talib das Erbe als Kalif antritt. Das Wort “Shia” bedeutet im Übrigen “Familie”. Der Begriff “Aleviten” leitet sich vom Namen “Ali” ab, womit auch deutlich gemacht werden soll, dass die türkischen Aleviten historisch, wie auch theologisch enge Bindungen zum Schiitentum aufweisen. Das Alevitentum ist jedoch eine anatolische Interpretation der schiitischen Konfession. Sie zeichnet sich durch eine Synthese aus schiitischer Theologie und dem kulturellen und spirituellen Erbe der nomadisch-türkischen Kultur Zentralasiens aus. Der schiitische Geistliche und Gründer des Bektashiordens Haci Bektas Veli verbreitete im 13. Jh. im ländlichen Zentral- und Ostanatolien diese “unorthodoxeste Deutung des Islam”.
Im Fokus dieser Arbeit steht jedoch die Frage welche Rolle der islamischen Frau dem Koran nach zukommt, und welche Unterschiede diesbezüglich zwischen den bereits genannten Glaubensgemeinschaften bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Die unterschiedliche Stellung der Frau in der Türkei in der sunnitischen Theologie und im Alevitentum
- Einleitung - Sunniten und Aleviten
- Die Stellung der Frau in der sunnitischen Theologie
- Das islamische Recht
- Die Gleichheit von Mann und Frau vor Gott
- Die Überlegenheit des Mannes
- Der Koran und das Eherecht
- Die Eheschließung und die Scheidung
- Die Mehrehe
- Die Frau im gesellschaftlichem Leben
- Die Verschleierung
- Die Absonderung im Haus
- Die Ausbildung und die Berufstätigkeit
- Die Frau im religiösen Leben
- Der Ehrbegriff
- Die Stellung der Frau in der heutigen Türkei
- Die Stellung der Frau im Alevitentum
- Die alevitische Theologie
- Die Ehe und die Scheidung
- Die Erziehung und die Bildung
- Die Verschleierung
- Die Frau im religiösen Leben
- Historische Vorbilder
- Der Ehrbegriff
- Schluss - Die türkische Frau gibt es nicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die unterschiedliche Stellung der Frau in der Türkei, im Vergleich der sunnitischen Theologie und des Alevitentums. Sie beleuchtet die rechtlichen, gesellschaftlichen und religiösen Aspekte dieser Frage und stellt die unterschiedlichen Interpretationen des Islams in beiden Konfessionen dar.
- Der Einfluss des islamischen Rechts auf die Rolle der Frau in der sunnitischen Tradition
- Die Gleichheit und Ungleichheit von Mann und Frau im Koran und in der sunnitischen Theologie
- Die Bedeutung der Traditionen und kulturellen Einflüsse auf die Stellung der Frau in der Türkei
- Die Unterschiede im Verständnis der Frauenrolle zwischen Sunniten und Aleviten
- Die Rolle von historischen Vorbildern und der Ehrbegriff in beiden Konfessionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die beiden wichtigsten Konfessionen in der Türkei - Sunniten und Aleviten - vorstellt und ihre Unterschiede im Kontext der islamischen Geschichte beleuchtet.
Im zweiten Kapitel wird die Stellung der Frau in der sunnitischen Theologie untersucht. Dabei wird zunächst das islamische Recht und seine Bedeutung für die Rolle der Frau dargestellt. Anschließend werden die Koranauslegungen zur Gleichheit von Mann und Frau sowie zur Überlegenheit des Mannes analysiert. Die Kapitel befasst sich mit dem Eherecht, der Verschleierung, der Absonderung der Frau im Haus und ihrer Rolle im religiösen Leben.
Das dritte Kapitel widmet sich der Stellung der Frau in der heutigen Türkei. Es zeigt die vielfältigen sozialen und kulturellen Einflüsse auf die Lebensrealität der türkischen Frauen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Stellung der Frau im Alevitentum. Es geht auf die alevitische Theologie, die Ehe und Scheidung, Erziehung und Bildung, die Verschleierung, die Rolle der Frau im religiösen Leben, historische Vorbilder und den Ehrbegriff ein.
Schlüsselwörter
Sunnitischer Islam, Alevitentum, Türkei, Frau, Rolle, Stellung, Koran, Sharia, islamisches Recht, Eherecht, Verschleierung, Absonderung, Bildung, Gesellschaft, Religion, Ehrbegriff, Tradition, Kultur, Vergleich, Unterschiede.
- Quote paper
- Stefanie Lembacher (Author), 2006, Die unterschiedliche Stellung der Frau in der Türkei in der sunnitischen Theologie und im Alevitentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73082