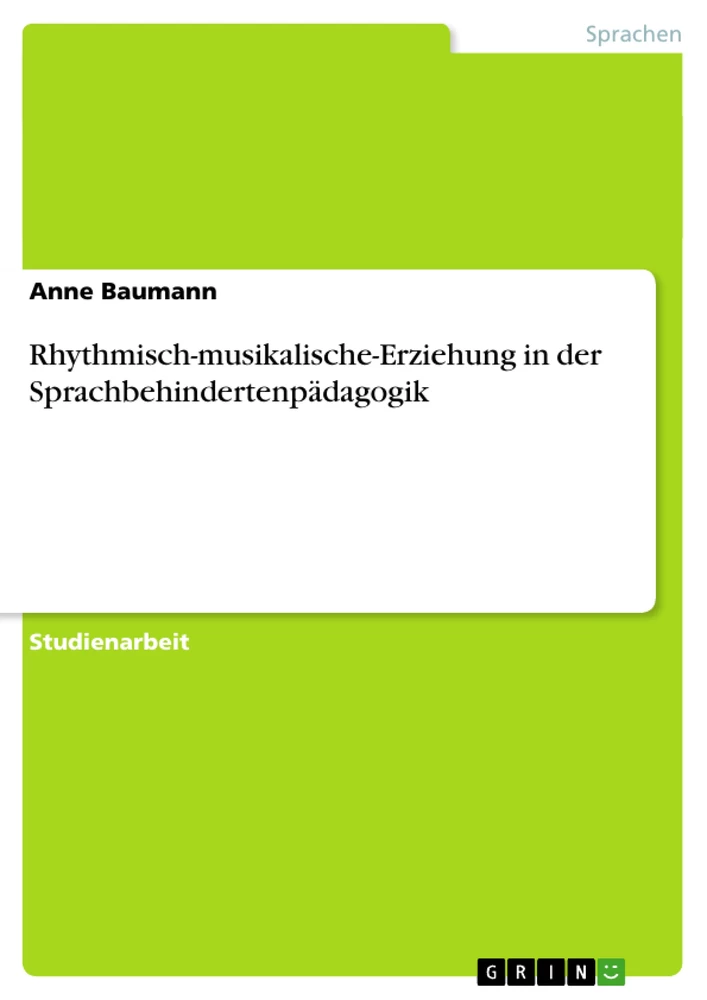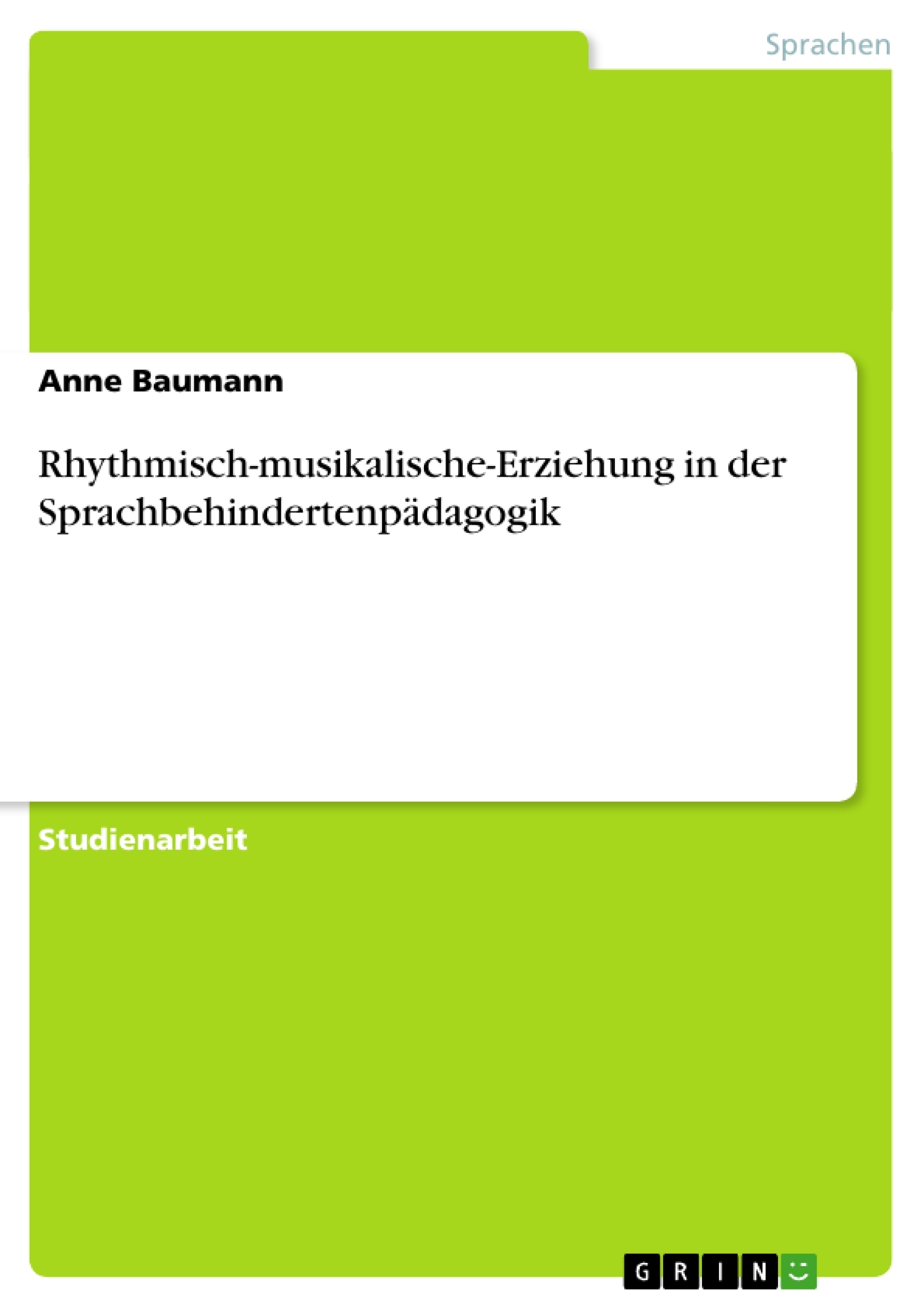Zum Thema der Rhythmisch-musikalischen Erziehung finden sich viele Beiträge in der Literatur. Auch zur Anwendung bei sprachauffälligen Kindern gibt es eine Vielzahl an Literaturhinweisen. Deshalb werden im Folgenden nur Beiträge ausgewählter Autoren verwendet. Der Einsatz von Rhythmisch-musikalischer Erziehung (RME) an der Sonderschule ist ein spannendes Thema, lädt zum Selbststudium und eigenem Probieren ein.
Was spricht für den Einsatz von RME bei sprachbehinderten Kindern?
Kinder mit „Beeinträchtigungen verschiedener Art“ (vgl. Bauer, 1986, 15) profitieren in hohem Maße vom Einsatz der Rhythmik und der Musik. Neben der körperlichen und seelischen Entspannung werden geistige Fähigkeiten wie Gedächtnis und Aufmerksamkeit gestärkt, der Gemeinschaftssinn gefördert und die sprachliche Ausdrucksfähigkeit beeinflusst. Musik wird somit zu einem Ausdruckmittel, mit dem sich Kinder Mitschülern gegenüber auf einer persönlichen Kommunikationsebene mitteilen können. Rhythmisch-musikalische Spiele eignen sich demnach zur Unterstützung stimmlicher wie sprachlicher Entwicklungsprozesse.
Dagegen behandelten seit den 30er Jahren Wlassowa und Griner in Moskau stotternde Kinder im Vorschulalter mit einem System, das sie „Logopädische Rhythmik“ oder „Logorhythmik“ nannten. Im Vordergrund standen Lehreinheiten nach einem bestimmten Aufbau: Begonnen wird mit Gesang, der die Atmung regelt. Es folgen Übungen zur Gliederung des Raumes und zur Regulierung des Muskeltonus. Danach schließen sich Sprech- und Aufmerksamkeitsübungen an. Den Abschluss bilden Übungen zur Beruhigung und zur Hörerziehung.
In der DDR wurde diese „Logopädische Rhythmik“ in den 60er Jahren von Gerger aufgenommen, weiterentwickelt und in das Konzept „Rehabilitative Bewegungserziehung“ integriert.
Nach diesem geschichtlichen Abriss wird nun auf den Begriff der Rhythmisch-musikalischen Erziehung eingegangen und anschließend für die Sprachheilpädagogik konkretisiert. Es folgt eine Darstellung der Grundelemente der RME und eine Systematisierung geeigneter Übungen. Ausführlich schließt sich ein Vorschlag einer Therapieeinheit im Bereich der Dyslalien an. Abschließen werde ich mit einem persönlichen Wort.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff Rhythmisch-musikalische Erziehung
- 2.1 Musik als Mittel zur Lebensbewältigung
- 2.2 Förderung der Wahrnehmung
- 2.3 Dem Bewegungsbedürfnis des Kindes entgegenkommen
- 2.4 Erwerb der kommunikativen Kompetenz
- 2.5 Aufbau von positivem Selbstwerterleben
- 3. Rhythmisch-musikalische Erziehung in der Sprachheilpädagogik
- 3.1 Rhythmisch-musikalische Erziehung als Unterrichtsfach
- 3.2 Rhythmisch-musikalische Erziehung als Unterrichtsprinzip
- 4. Grundelemente der rhythmisch-musikalischen Erziehung
- 4.1 Zeit
- 4.2 Raum
- 4.3 Kraft
- 4.4 Form
- 5. Systematisierung der rhythmisch-musikalischen Übungen
- 5.1 Ordnungsübungen
- 5.2 Sozialübungen
- 5.3 Konzentrationsübungen
- 5.4 Phantasieübungen
- 5.5 Begriffsbildungsübungen
- 6. Therapieansätze von sprachheilpädagogischer Rhythmik
- 6.1 Sprachheilpädagogische Rhythmik bei der Behandlung von Dyslalien
- 6.2 Sprachheilpädagogische Rhythmik speziell bei Schetismus
- 7. Persönliche Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einsatz rhythmisch-musikalischer Erziehung (RME) in der Sprachbehindertenpädagogik. Ziel ist es, die Bedeutung von RME für die ganzheitliche Entwicklung sprachbehinderter Kinder aufzuzeigen und konkrete Therapieansätze zu beleuchten.
- Rhythmisch-musikalische Erziehung als ganzheitliches Förderkonzept
- Der Einfluss von Musik und Bewegung auf die Sprachentwicklung
- Konkrete Übungen und Therapiemethoden in der sprachheilpädagogischen Rhythmik
- Historische Entwicklung der rhythmisch-musikalischen Erziehung
- Der Beitrag von RME zur Persönlichkeitsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema rhythmisch-musikalischer Erziehung (RME) in der Sprachbehindertenpädagogik ein und nennt ausgewählte Autoren, deren Beiträge im Folgenden berücksichtigt werden. Sie hebt die Bedeutung von RME für die Gesamtpersönlichkeit des Kindes hervor und benennt die positiven Auswirkungen auf sprachbehinderte Kinder, wie z.B. Stärkung des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und des Gemeinschaftssinns. Der einführende Abschnitt verspricht einen geschichtlichen Rückblick und eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der RME, ihrer Grundelemente und geeigneter Übungen, sowie eine detaillierte Betrachtung von Therapieansätzen bei Dyslalien und ein persönliches Schlusswort.
2. Zum Begriff Rhythmisch-musikalische Erziehung: Dieses Kapitel klärt den Begriff der rhythmisch-musikalischen Erziehung und definiert ihn als ein ganzheitliches Erziehungsprinzip zur Entwicklung des Kindes. Es wird auf die Bedeutung des Rhythmus als verbindendes Element zwischen Musik, Sprache und Bewegung eingegangen, wobei verschiedene Definitionen von Rhythmus und seine Verbindung zur Sprache diskutiert werden. Die Kapitel verdeutlicht das Ziel der RME, das Kind zu einem selbständigen und verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen und hebt den Unterschied zur Bewegungserziehung hervor. Verschiedene Ansätze und die Gemeinsamkeiten der RME-Methoden werden vorgestellt, sowie das pädagogische Vorgehen "Erfahren/Erleben - Erkennen - Benennen" erläutert. Der Abschnitt endet mit der Bedeutung von Musik als Mittel zur Lebensbewältigung und ihrer tiefgreifenden emotionalen Wirkung auf Kinder.
Schlüsselwörter
Rhythmisch-musikalische Erziehung, Sprachbehinderung, Sprachheilpädagogik, Musiktherapie, Bewegung, Rhythmus, Ganzheitliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Therapieansätze, Dyslalien, Schetismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Rhythmisch-musikalische Erziehung in der Sprachheilpädagogik"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einsatz rhythmisch-musikalischer Erziehung (RME) in der Sprachbehindertenpädagogik. Sie untersucht die Bedeutung von RME für die ganzheitliche Entwicklung sprachbehinderter Kinder und beleuchtet konkrete Therapieansätze.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die rhythmisch-musikalische Erziehung als ganzheitliches Förderkonzept, den Einfluss von Musik und Bewegung auf die Sprachentwicklung, konkrete Übungen und Therapiemethoden in der sprachheilpädagogischen Rhythmik, die historische Entwicklung der rhythmisch-musikalischen Erziehung und den Beitrag von RME zur Persönlichkeitsentwicklung. Sie umfasst zudem eine Klärung des Begriffs der RME, eine Erläuterung der Grundelemente (Zeit, Raum, Kraft, Form) und eine Systematisierung rhythmisch-musikalischer Übungen (Ordnungs-, Sozial-, Konzentrations-, Phantasie- und Begriffsbildungsübungen). Spezifische Therapieansätze bei Dyslalien und Schetismus werden ebenfalls detailliert betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Zum Begriff Rhythmisch-musikalische Erziehung, Rhythmisch-musikalische Erziehung in der Sprachheilpädagogik, Grundelemente der rhythmisch-musikalischen Erziehung, Systematisierung der rhythmisch-musikalischen Übungen, Therapieansätze von sprachheilpädagogischer Rhythmik und Persönliche Stellungnahme. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was versteht man unter rhythmisch-musikalischer Erziehung (RME)?
RME wird als ganzheitliches Erziehungsprinzip zur Entwicklung des Kindes definiert. Es betont die Bedeutung des Rhythmus als verbindendes Element zwischen Musik, Sprache und Bewegung. Ziel ist die Erziehung zu einem selbständigen und verantwortungsbewussten Menschen. Der Unterschied zur reinen Bewegungserziehung wird hervorgehoben.
Welche Grundelemente der RME werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundelemente Zeit, Raum, Kraft und Form der rhythmisch-musikalischen Erziehung.
Welche Arten von Übungen werden im Rahmen der RME vorgestellt?
Es werden Ordnungsübungen, Sozialübungen, Konzentrationsübungen, Phantasieübungen und Begriffsbildungsübungen vorgestellt und systematisiert.
Wie wird RME in der Sprachheilpädagogik eingesetzt?
Die Arbeit betrachtet RME sowohl als eigenständiges Unterrichtsfach als auch als Unterrichtsprinzip in der Sprachheilpädagogik. Konkrete Therapieansätze bei Dyslalien und Schetismus werden detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rhythmisch-musikalische Erziehung, Sprachbehinderung, Sprachheilpädagogik, Musiktherapie, Bewegung, Rhythmus, Ganzheitliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Therapieansätze, Dyslalien, Schetismus.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von RME für die ganzheitliche Entwicklung sprachbehinderter Kinder aufzuzeigen und konkrete Therapieansätze zu beleuchten.
- Quote paper
- Anne Baumann (Author), 2006, Rhythmisch-musikalische-Erziehung in der Sprachbehindertenpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73010