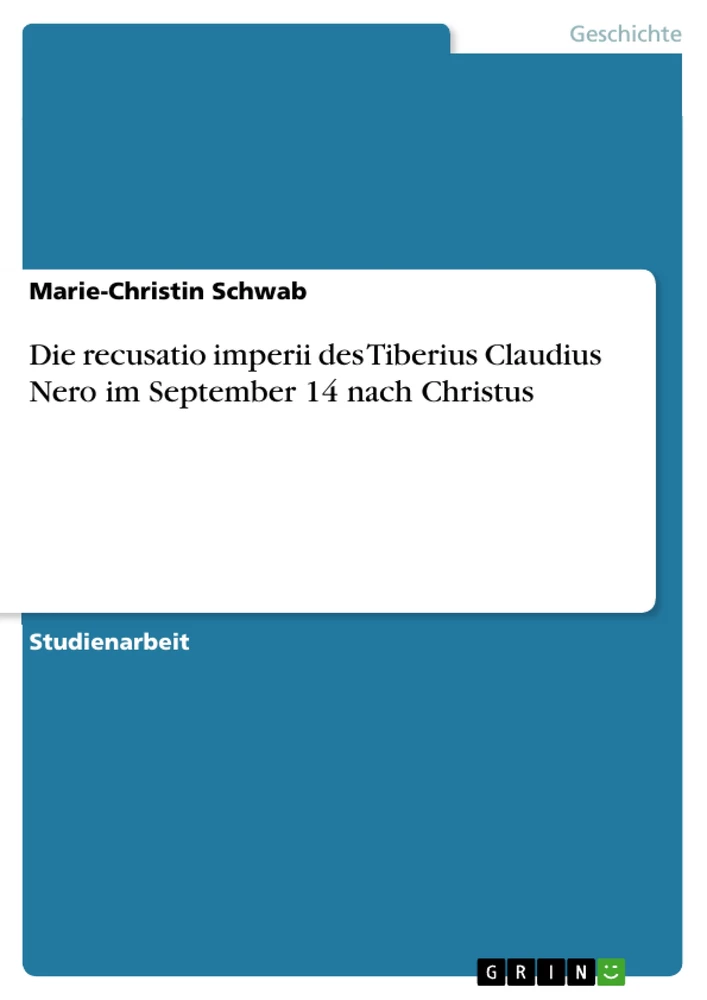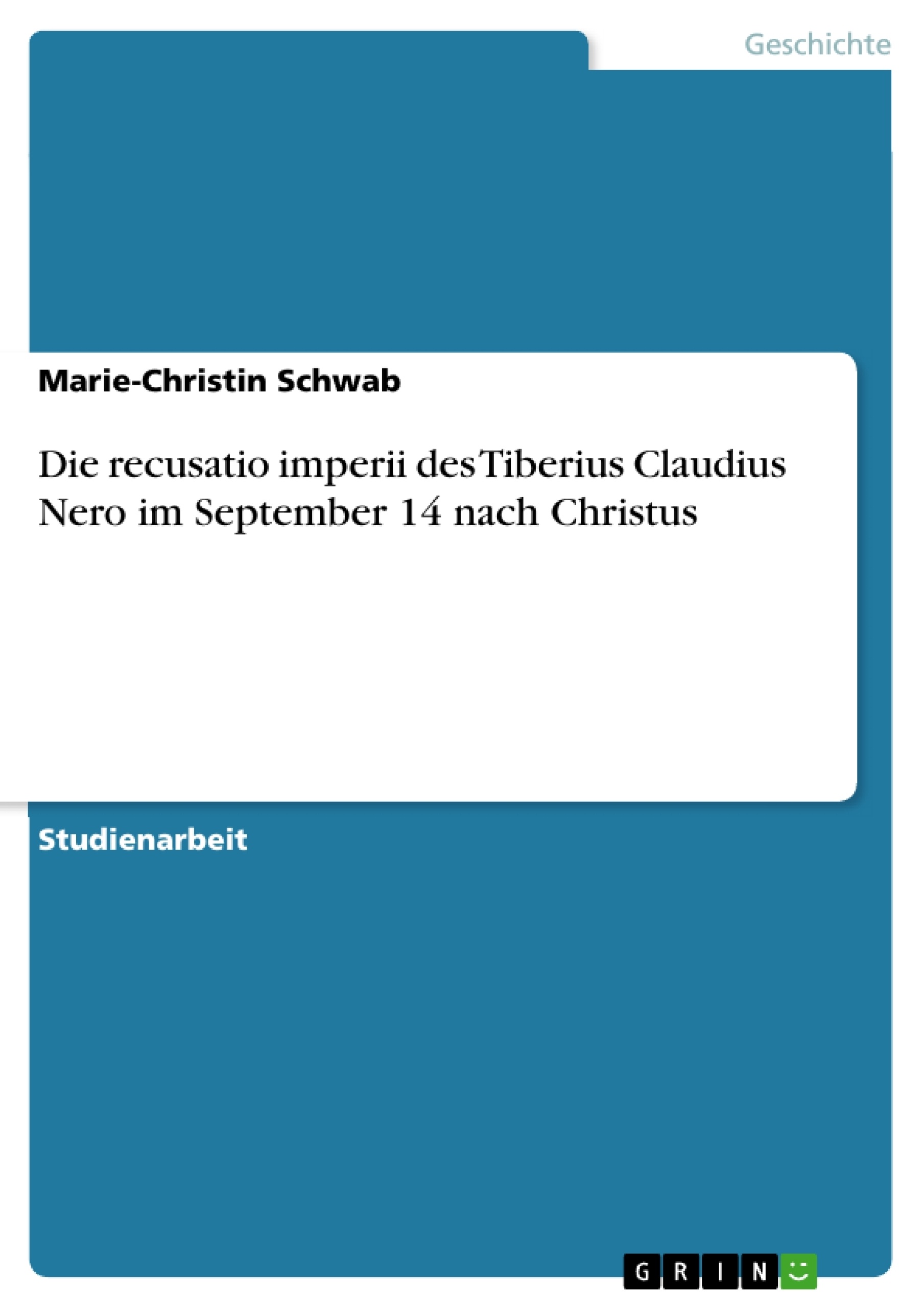Zu Beginn seiner Annalen schreibt Tacitus davon, dass er in seinem Geschichtswerk „den Prinzipat des Tiberius und seiner Nachfolger“ überliefern wolle und zwar ausdrücklich „sine ira et studio“, also „alles ohne Haß und Vorliebe“, da ihm dafür „jeglicher Grund fehlt.“ Beginnt man jedoch mit der Lektüre, so wird dem Leser recht schnell deutlich, dass Tacitus keineswegs auf die angekündigte unparteiische Art und Weise von der damaligen Zeit berichtet. Im Gegenteil, er „hat ein Bild des Kaisers Tiberius von großer suggestiver Kraft geschaffen“, welches durch eine sehr geschickte Darstellung vermittelt wird. So schreibt Tacitus über die Phase kurz vor Augustus Tod, dass „Gerüchte(n) über die kommenden Herrscher“ umgingen, denen zufolge „Tiberius Nero zwar in reifen Jahren“ sei, und „auch im Kriege erprobt, aber von dem alten, der Familie der Claudier angeborenem Hochmut beseelt, und viele Anzeichen von Grausamkeit, auch wenn er sie noch so sehr unterdrücke, brächen schon hervor.“ In dieser Formulierung wird deutlich, dass Tacitus zwar nicht selbst diese Aussage trifft, dafür bietet er trotz allem eine Charakterdarstellung, die sich natürlich, stetig weiter ausgeschmückt und wiederholt, im Kopf des Lesers festsetzt. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Beschreibung des Rhodos-Aufenthaltes von Tiberius, während dessen er „unter dem Anschein freiwilliger Zurückgezogenheit die Rolle eines Verbannten gespielt“, jedoch „auf nichts anderes als auf Haß, Heuchelei und geheime Lüste gesonnen.“ Sehr effektvoll beginnt der Autor mit dem Satz „Die erste Untat des neuen Prinzipats war die Ermordung des Agrippa Postumus.“ Tacitus beschuldigt Tiberius nicht direkt seinen zu dem Zeitpunkt einzigen „Rivalen“ ermordet zu haben, sondern lässt die Worte für sich sprechen, denn Tiberius stellt ja faktisch den Prinzipat dar.
Aufgrund dieser stets negativ gefärbten Geschichtsschreibung ist es unbedingt von Bedeutung immerzu auch andere antike Autoren sowie moderne Forschungsansichten herbeizuziehen, um ein möglichst vielseitiges Bild der damaligen Situation zu erhalten. Diese Hausarbeit stellt nun den Versuch dar, mittels der besagten vielfältigen Literatur einen kleine Einblick auf die recusatio imperii des Tiberius Nero zu werfen und dialektisch ihre Deutungen darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- „sine ira et studio“?
- Die recusatio imperii des Tiberius Claudius Nero im September 14 nach Christus
- Eine Begriffsbestimmung
- Die Erklärung des lateinischen Ausdrucks
- Die Bedeutung des Begriffs
- Die antiken Überlieferungen und der moderne Forschungsstand
- Ein kurzer Überblick über die Ereignisse im September 14 n. Chr.
- Gründe für die recusatio und ihre Deutungen
- negative Interpretationen
- positivere Deutungsansätze
- Theorien über das Ende der recusatio
- Eine Begriffsbestimmung
- Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die recusatio imperii des Tiberius Claudius Nero im September 14 n. Chr. Ziel ist es, verschiedene antike und moderne Interpretationen dieser Herrschaftsverweigerung dialektisch darzustellen und einen umfassenden Einblick in das Thema zu geben. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Quellen, um ein möglichst vielseitiges Bild der damaligen Situation zu erhalten.
- Begriffsbestimmung der recusatio imperii und ihrer Synonyme
- Analyse der antiken Überlieferungen bei Tacitus, Sueton und Cassius Dio
- Gegenüberstellung verschiedener Interpretationen der Gründe für die recusatio
- Untersuchung der modernen Forschung zum Thema
- Die Rolle der recusatio für die Legitimierung der Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
„sine ira et studio“?: Dieser einleitende Abschnitt analysiert Tacitus' Behauptung, seine Annalen „sine ira et studio“ verfasst zu haben, und konfrontiert diese Aussage mit der tatsächlich vorhandenen, stark negativen Darstellung des Tiberius. Es wird gezeigt, dass Tacitus, trotz seines behaupteten Unparteilichkeit, ein subjektives und suggestives Bild des Kaisers zeichnet, welches durch geschickte Formulierungen und wiederkehrende negative Charakterisierungen vermittelt wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, neben Tacitus auch andere antike Quellen und moderne Forschungsergebnisse heranzuziehen, um ein umfassenderes Bild zu erhalten.
Die recusatio imperii des Tiberius Claudius Nero im September 14 nach Christus: Dieses Kapitel beginnt mit einer genauen Begriffsbestimmung der „recusatio imperii“, indem es verschiedene lateinische Synonyme und deren Bedeutungen aus antiken Quellen (Tacitus, Sueton, Velleius Paterculus) erklärt und den theoretischen Hintergrund der Herrschaftsverweigerung als Legitimationsstrategie erläutert. Die recusatio wird hier nicht als tatsächliche Ablehnung, sondern als politisches Ritual dargestellt, welches dazu diente, die Herrschaft des Tiberius als von breitem Konsens getragen darzustellen und seine Maßhaltung und Würde zu betonen.
Die antiken Überlieferungen und der moderne Forschungsstand: Dieses Kapitel erläutert die verwendeten Quellen für die Analyse der tiberischen recusatio imperii, nämlich die Annalen des Tacitus (Buch I, Kapitel 7 und 11-13), die Vita des Tiberius bei Sueton (Kapitel 24/25), sowie die entsprechende Passage bei Cassius Dio (Buch LVII, Kapitel 1-3). Es betont die Bedeutung des Vergleichs dieser unterschiedlichen Quellen und der Einbeziehung der modernen Forschung, um eine dialektische und vielseitige Darstellung des Themas zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Methode der Quellenanalyse und dem Forschungsstand.
Schlüsselwörter
Recusatio imperii, Tiberius, Tacitus, Sueton, Cassius Dio, Annalen, Herrschaftsverweigerung, Legitimation, Prinzipat, Antike, Römische Geschichte, Quellenkritik, moderne Forschung.
Häufig gestellte Fragen zu: Die recusatio imperii des Tiberius Claudius Nero im September 14 n. Chr.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die recusatio imperii (Herrschaftsverweigerung) des Tiberius Claudius Nero im September des Jahres 14 n. Chr. Sie analysiert verschiedene antike und moderne Interpretationen dieses Ereignisses und bietet einen umfassenden Einblick in das Thema.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Analyse basiert auf den antiken Überlieferungen von Tacitus (Annalen), Sueton (Vita des Tiberius) und Cassius Dio. Die Arbeit betont die Bedeutung des Vergleichs dieser unterschiedlichen Quellen und die Einbeziehung der modernen Forschung für eine vielseitige Darstellung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel ist die dialektische Darstellung verschiedener Interpretationen der Herrschaftsverweigerung des Tiberius. Es soll ein umfassendes Bild der damaligen Situation und der Gründe für die recusatio geschaffen werden, wobei die Rolle dieses Ereignisses für die Legitimierung der Herrschaft Tibers besonders betrachtet wird.
Wie wird die recusatio imperii in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert die recusatio imperii nicht als bloße Ablehnung der Herrschaft, sondern als politisches Ritual. Dieses diente dazu, die Herrschaft Tibers als von breitem Konsens getragen darzustellen und seine Maßhaltung und Würde zu betonen. Es werden verschiedene lateinische Synonyme und deren Bedeutungen aus antiken Quellen erläutert.
Welche unterschiedlichen Interpretationen der recusatio werden behandelt?
Die Arbeit stellt verschiedene Interpretationen der Gründe für die recusatio gegenüber. Sie betrachtet sowohl negative als auch positivere Deutungsansätze und analysiert die verschiedenen Perspektiven kritisch.
Welche Rolle spielt Tacitus in der Arbeit?
Tacitus' Darstellung des Tiberius und seine Behauptung, seine Annalen „sine ira et studio“ verfasst zu haben, wird kritisch untersucht. Die Arbeit zeigt, dass Tacitus trotz seines Anspruchs auf Unparteilichkeit ein subjektives und suggestives Bild des Kaisers zeichnet. Daher wird betont, neben Tacitus auch andere Quellen und die moderne Forschung zu berücksichtigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit der Begriffsbestimmung der recusatio imperii, der Analyse der antiken Überlieferungen, dem Vergleich verschiedener Interpretationen, der Untersuchung der modernen Forschung und der Rolle der recusatio für die Legitimation der Herrschaft befassen. Ein einleitendes Kapitel befasst sich mit der Objektivität von Tacitus' Darstellung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Recusatio imperii, Tiberius, Tacitus, Sueton, Cassius Dio, Annalen, Herrschaftsverweigerung, Legitimation, Prinzipat, Antike, Römische Geschichte, Quellenkritik, moderne Forschung.
- Quote paper
- Marie-Christin Schwab (Author), 2007, Die recusatio imperii des Tiberius Claudius Nero im September 14 nach Christus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72988