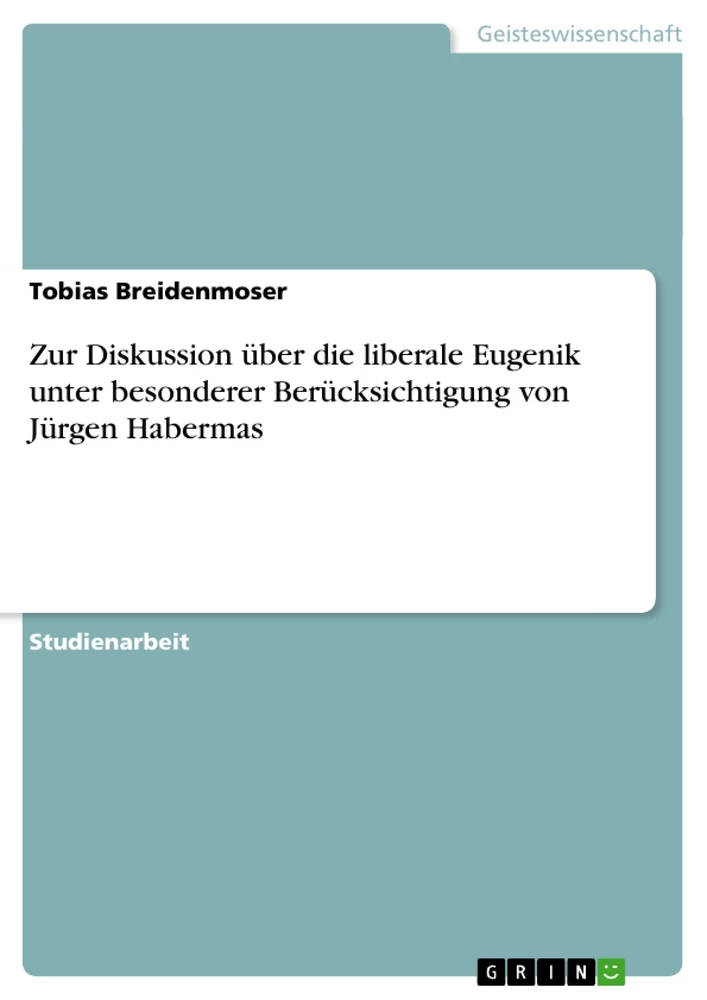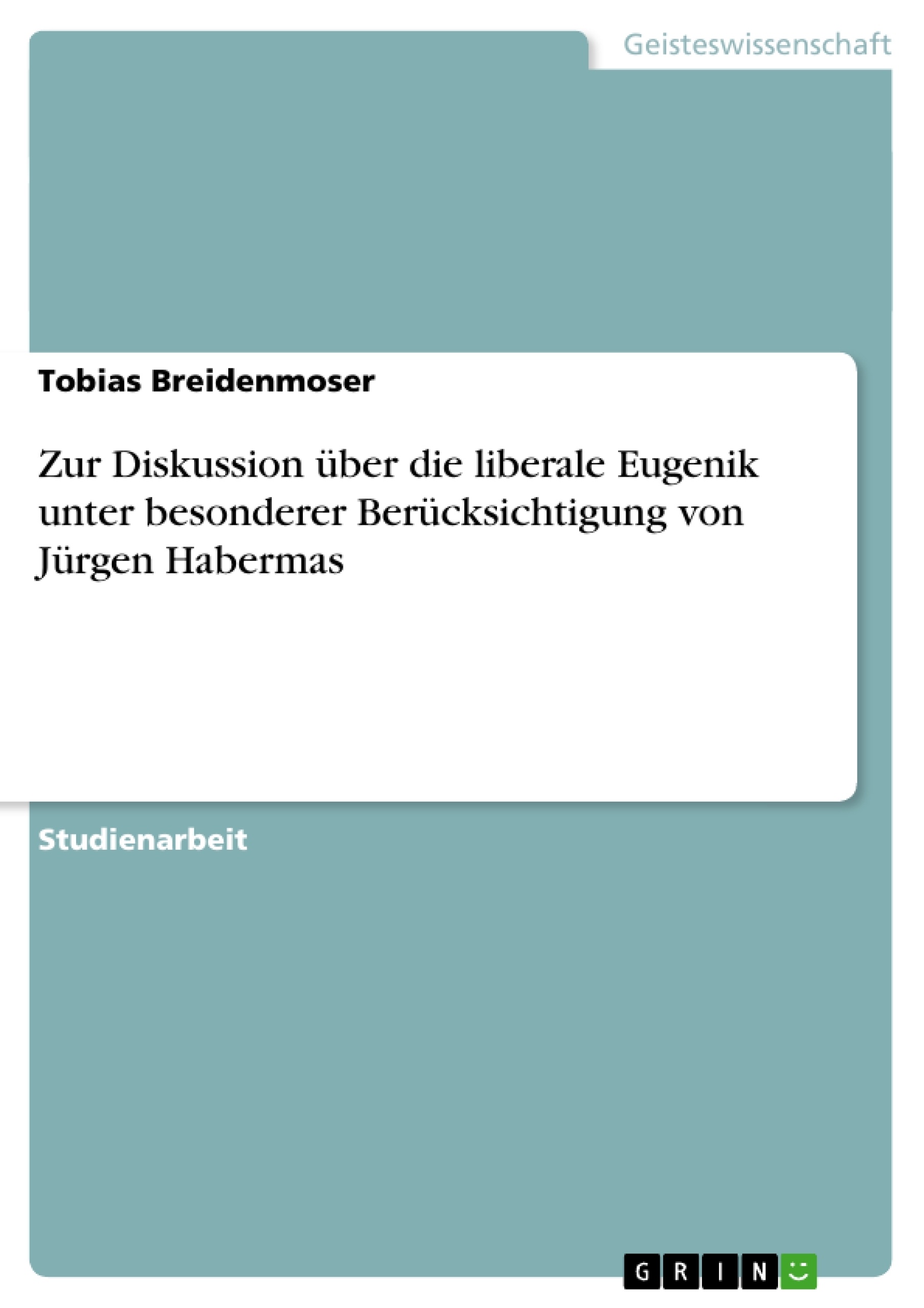Die biotechnische Forschung hat sich in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts rasant entwickelt. Gentechnische Forschungen führen zu völlig neuen technischen Anwendungen, die stärker in die Natur eingreifen können, als man es je zuvor konnte. An technischen Möglichkeiten scheinen dem Menschen kaum Grenzen gesetzt zu sein. Doch gibt es vielleicht ethische Grenzen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich Jürgen Habermas in seinem Buch „Die Zukunft der menschlichen Natur“. Er geht speziell auf die Frage ein, ob man durch Präimplantationsdiagnostik und genetischer Manipulation in das Erbgut des Menschen eingreifen und ihn beliebig designen darf. Diese Arbeit soll sich ebenfalls dieser Frage widmen.
Nach einem Überblick über die Kerngedanken von Habermas soll eine umfassende Grundlagendiskussion klären, wie sich dem Problem der liberalen Eugenik genähert werden kann. Es muss die Frage nach einer weltanschaulich neutralen Bewertungsmöglichkeit für diese Thematik aufgeworfen und beantwortet werden. Die Diskursethik von Habermas bietet hierfür gute Ansätze. Sie soll durch eine skizzierte Interessenethik erweitert und ergänzt werden. Diese bildet dann auch eine gute Möglichkeit, die angeführte Problematik wieder aufzugreifen und neu zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Habermas über die Frage der liberalen Eugenik
- Mit welchen Methoden lässt sich Ethik begründen?
- Kritik des metaphysischen Ethikverständnisses
- Darstellung und Kritik der Diskursethik
- Interessenethik
- Zur Diskussion um die liberale Eugenik bei Habermas
- Zur negativen Eugenik
- Zur positiven Eugenik
- Positive Eugenik und Gerechtigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch Jürgen Habermas' Argumentation zur liberalen Eugenik. Das Hauptziel ist die Überprüfung der Prämissen von Habermas' Schlussfolgerungen und die Stärkung möglicher Schwachpunkte mit neuen Argumenten. Die Arbeit beleuchtet, unter welchen Bedingungen Habermas' Schlussfolgerungen gültig sind und wie sie motiviert werden können.
- Habermas' Position zur liberalen Eugenik
- Die Begründung ethischer Prinzipien im nachmetaphysischen Kontext
- Diskursethik und Interessenethik als ethische Bewertungsgrundlagen
- Die ethische Bewertung von Präimplantationsdiagnostik und genetischer Manipulation
- Der Schutz der Identität unmanipulierter Erbanlagen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der liberalen Eugenik und der biotechnischen Forschung ein. Sie stellt die zentrale Frage nach ethischen Grenzen des menschlichen Eingriffs in das Erbgut und skizziert den Ansatz der Arbeit: eine kritische Auseinandersetzung mit Habermas' Argumentation und die Suche nach weltanschaulich neutralen Bewertungskriterien. Die rasante Entwicklung der Biotechnologie und die damit verbundenen ethischen Herausforderungen werden hervorgehoben, wobei die Arbeit die Position Habermas im Kontext dieser Herausforderungen untersucht.
Habermas über die Frage der liberalen Eugenik: Dieses Kapitel präsentiert Habermas' Standpunkt zur liberalen Eugenik. Es beschreibt die technologischen Möglichkeiten der Präimplantationsdiagnostik und genetischer Manipulation, differenziert zwischen negativer und positiver Eugenik und betont die Notwendigkeit einer ethischen Bewertung, die frei von metaphysischen und weltanschaulich aufgeladenen Kriterien ist. Habermas’ Sichtweise auf die „Moralisierung der menschlichen Natur“ und die Frage nach der Unverfügbarkeit der biologischen Grundlage personaler Identität bilden den Kern dieses Kapitels. Die Unterscheidung zwischen konservativen und liberalen Positionen in der Abtreibungsdebatte wird analysiert, wobei die Kritik an beiden Seiten hervorgehoben wird. Der Schutz des vorgeburtlichen Lebens wird nicht auf die Menschenwürde reduziert, sondern auf einem gattungsethischen Selbstverständnis begründet.
Mit welchen Methoden lässt sich Ethik begründen?: Dieses Kapitel behandelt die Frage nach einer weltanschaulich neutralen Ethikbegründung. Es kritisiert metaphysische Ethikverständnisse und stellt die Diskursethik Habermas' vor. Die Diskursethik wird als Ansatz für eine rationale und konsensfähige ethische Bewertung präsentiert, während sie durch eine skizzierte Interessenethik erweitert und im Kontext der Diskussion um die liberale Eugenik angewendet wird. Die Kritik an subjektiven und unbegründeten ethischen Prinzipien steht im Zentrum dieses Kapitels. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines methodischen Rahmens zur ethischen Beurteilung der neuen biotechnologischen Möglichkeiten, frei von metaphysischen Vorannahmen.
Zur Diskussion um die liberale Eugenik bei Habermas: Dieses Kapitel setzt sich detailliert mit Habermas' Argumentation zur liberalen Eugenik auseinander. Es beleuchtet seine Positionen zur negativen und positiven Eugenik sowie die Frage nach Gerechtigkeit im Kontext genetischer Manipulation. Die jeweiligen Argumente werden kritisch analysiert und bewertet, wobei der Schwerpunkt auf den ethischen Implikationen der biotechnologischen Interventionen liegt. Die Verbindung zu den vorherigen Kapiteln über Ethikbegründung und die Notwendigkeit einer weltanschaulich neutralen Position wird deutlich herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Liberale Eugenik, Jürgen Habermas, Diskursethik, Interessenethik, Präimplantationsdiagnostik, genetische Manipulation, negative Eugenik, positive Eugenik, Gerechtigkeit, Bioethik, Gattungsethik, nachmetaphysische Ethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Habermas und die liberale Eugenik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert kritisch Jürgen Habermas' Argumentation zur liberalen Eugenik. Sie untersucht seine Prämissen, mögliche Schwachstellen und sucht nach weltanschaulich neutralen Bewertungskriterien für biotechnologische Eingriffe in das menschliche Erbgut.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst Habermas' Position zur liberalen Eugenik, die Begründung ethischer Prinzipien im nachmetaphysischen Kontext, Diskursethik und Interessenethik als Bewertungsgrundlagen, die ethische Bewertung von Präimplantationsdiagnostik und genetischer Manipulation, sowie den Schutz der Identität unmanipulierter Erbanlagen. Sie differenziert zwischen negativer und positiver Eugenik und beleuchtet die Frage der Gerechtigkeit im Kontext genetischer Manipulation.
Wie wird die ethische Bewertung begründet?
Die Arbeit kritisiert metaphysische Ethikverständnisse und setzt auf eine weltanschaulich neutrale Begründung. Sie präsentiert Habermas' Diskursethik als Ansatz für eine rationale und konsensfähige ethische Bewertung und erweitert diesen Ansatz durch eine Interessenethik. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines methodischen Rahmens zur ethischen Beurteilung biotechnologischer Möglichkeiten, frei von metaphysischen Vorannahmen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine kritische Auseinandersetzung mit Habermas' Argumentation. Sie analysiert seine Schlussfolgerungen, prüft deren Gültigkeit und stärkt mögliche Schwachpunkte mit neuen Argumenten. Sie untersucht, unter welchen Bedingungen Habermas' Schlussfolgerungen gültig sind und wie sie motiviert werden können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Habermas' Position zur liberalen Eugenik, ein Kapitel zur ethischen Begründung, und ein Kapitel zur detaillierten Diskussion der liberalen Eugenik bei Habermas. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Liberale Eugenik, Jürgen Habermas, Diskursethik, Interessenethik, Präimplantationsdiagnostik, genetische Manipulation, negative Eugenik, positive Eugenik, Gerechtigkeit, Bioethik, Gattungsethik, nachmetaphysische Ethik.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die kritische Überprüfung von Habermas' Argumentation zur liberalen Eugenik und die Suche nach weltanschaulich neutralen Bewertungskriterien für biotechnologische Eingriffe.
Wie wird der Schutz des vorgeburtlichen Lebens begründet?
Der Schutz des vorgeburtlichen Lebens wird nicht auf die Menschenwürde reduziert, sondern auf einem gattungsethischen Selbstverständnis begründet.
- Quote paper
- Tobias Breidenmoser (Author), 2007, Zur Diskussion über die liberale Eugenik unter besonderer Berücksichtigung von Jürgen Habermas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72843