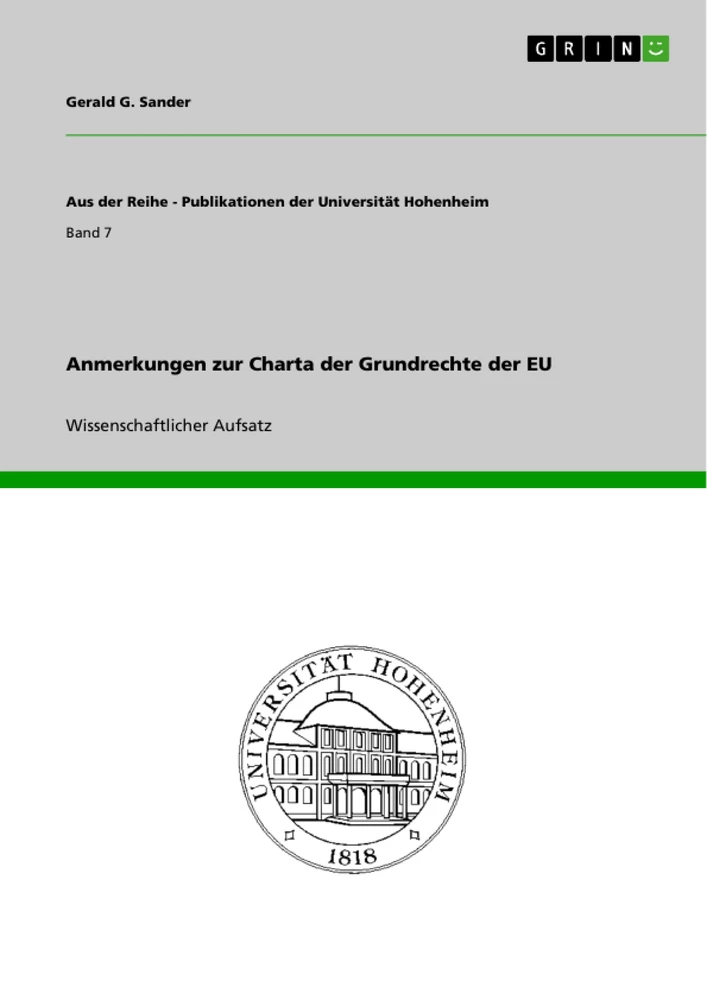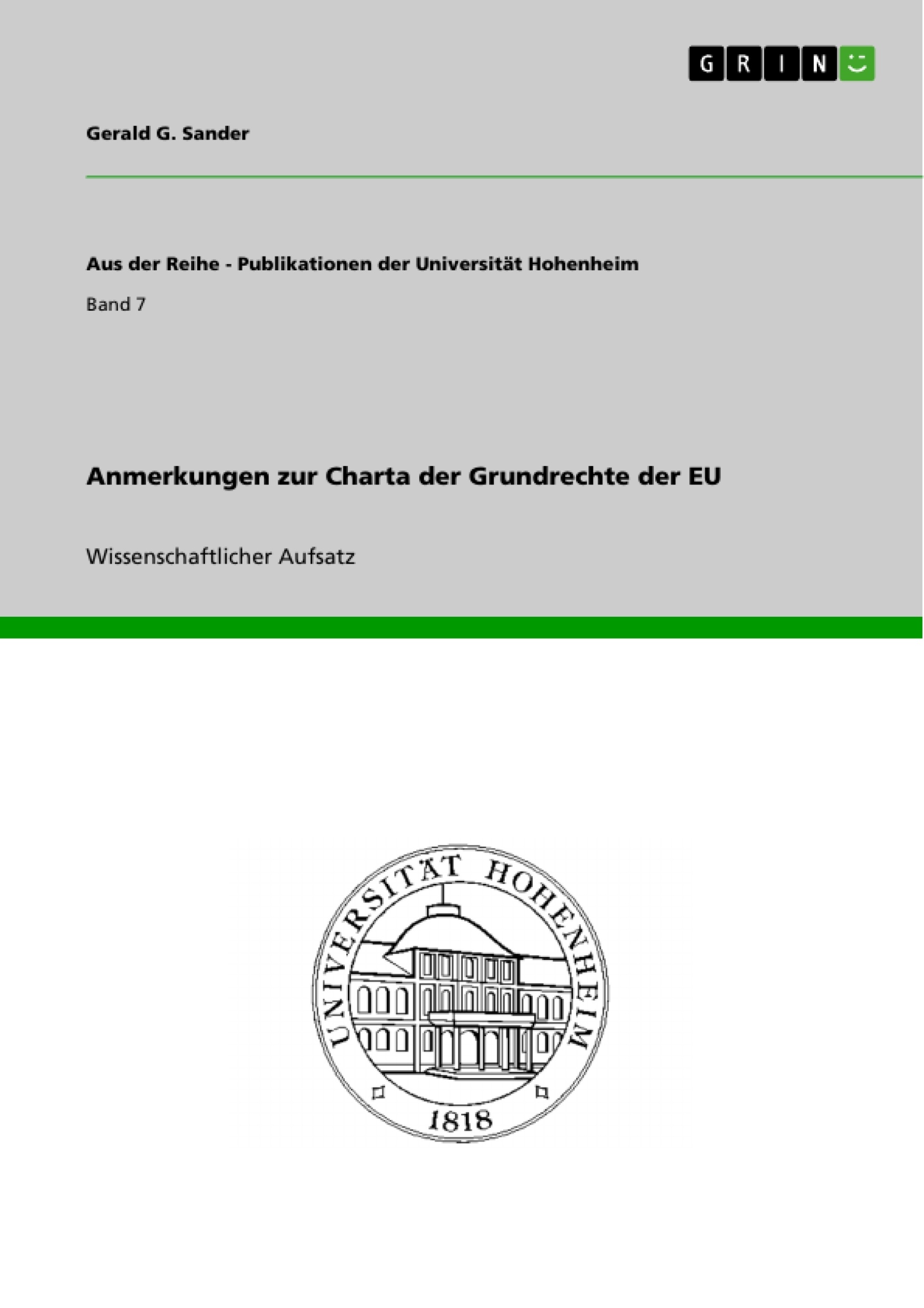Der Europäische Rat hatte auf seiner Tagung am 4./5. Juni 1999 in Köln die Erarbeitung einer
Charta der Grundrechte für notwendig erachtet, um diese Rechte für die Unionsbürger sichtbarer
zu gestalten.1 Er wies in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, dass die Charta
die Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie die Verfahrensgrundrechte umfassen soll, wie sie
in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK) gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben. Die
Charta sollte nach Auffassung des Europäischen Rates ferner jene Grundrechte enthalten, die
lediglich den Unionsbürgern zustehen. Bei der Ausarbeitung der Charta seien zudem wirtschaftliche
und soziale Rechte zu berücksichtigen, wie sie in der Europäischen Sozialcharta
und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer enthalten sind
(Art. 136 EGV), soweit sie nicht nur Ziele für das Handeln der Union begründen.
Der Europäische Rat setzte am 16. Oktober 1999 ein Gremium aus 62 Mitgliedern ein,
das sich auf seiner konstituierenden Sitzung am 17. Dezember 1999 den Namen „Konvent“
gab, und aus Vertretern verschiedener Legitimationsquellen bestand: ein Mitglied der Kommission,
15 persönliche Beauftragte der Staats- und Regierungschefs, 16 Mitglieder des Europäischen
Parlaments und 30 Mitglieder der nationalen Parlamente. Es sollte innerhalb eines
Jahres einen Entwurf der Charta ausarbeiten. Den Vorsitz übernahm der ehemalige deutsche
Bundespräsident Roman Herzog.
Am 28. September 2000 legte der Konvent seinen Entwurf vor, der vom Europäischen
Rat während des Sondergipfels in Biarritz am 13./14. Oktober 2000 grundsätzlich begrüßt
wurde. Schließlich wurde die Charta der Grundrechte der Europäischen Union am
8. Dezember 2000 von den drei Organen der EU, das heißt dem Europäischen Parlament, dem
Rat und der Kommission, anlässlich des Europäischen Rates in Nizza feierlich proklamiert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Die Entstehung der Grundrechtscharta
- Die Anerkennung von Grundrechten durch den EuGH
- Gründe für die Schaffung der Grundrechtscharta
- Der Inhalt der Charta
- Würde des Menschen
- Freiheiten
- Gleichheit
- Solidarität
- Bürgerrechte
- Justizielle Rechte
- Allgemeine Bestimmungen
- Grundrechtsträger und Grundrechtsverpflichtete
- Grundrechtsträger
- Grundrechtsverpflichtete
- Zum Status der Charta
- Das Verhältnis der Charta zur EMRK
- Kritische Bemerkungen zur Charta
- Die Charta als Teil einer künftigen Verfassung?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung befasst sich mit der Grundrechtscharta der Europäischen Union. Sie untersucht die Entstehung und den Inhalt der Charta und diskutiert ihre Bedeutung für den Grundrechtsschutz in der EU. Außerdem werden die Beziehungen der Charta zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und die Debatte um ihren Status als möglicher Bestandteil einer künftigen EU-Verfassung beleuchtet.
- Die Entstehung und die Hintergründe der Grundrechtscharta
- Die Bedeutung der Charta für den Grundrechtsschutz in der EU
- Der Inhalt der Charta und ihre verschiedenen Kapitel
- Das Verhältnis der Charta zur EMRK
- Die Debatte um den Status der Charta als Teil einer künftigen EU-Verfassung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Entstehung der Grundrechtscharta
Der Europäische Rat hat im Jahr 1999 die Erarbeitung einer Grundrechtscharta für die Europäische Union beschlossen. Die Charta sollte die in der EMRK garantierten Freiheits-, Gleichheits- und Verfahrensrechte sowie die aus den Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten resultierenden allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts umfassen. Außerdem sollten jene Grundrechte berücksichtigt werden, die nur den Unionsbürgern zustehen.
Die Anerkennung von Grundrechten durch den EuGH
Der EuGH hat aufgrund des Anwendungsvorrangs des EG-Rechts einen eigenen europäischen Grundrechtsschutz entwickelt, indem er sich auf die EMRK und die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten berief. Seit den 1960er Jahren hat der EuGH eine Vielzahl von Grundrechten, wie z.B. die Eigentums-, Berufs- und Vereinigungsfreiheit, anerkannt. Mit der Grundrechtscharta soll nun eine systematische Grundrechtsordnung auf europäischer Ebene geschaffen werden.
Gründe für die Schaffung der Grundrechtscharta
Die Grundrechtscharta dient der Stärkung des Schutzes der individuellen und kollektiven Grundrechte im Kontext der wachsenden Hoheitsgewalt der EU-Organe. Sie soll den Bürgern sichtbar machen, dass Europa ihre Rechte garantiert und schützt. Außerdem sollen die Grundprinzipien der europäischen Identität dargestellt werden. Die Kodifizierung der Grundrechte soll zudem die Rechtssicherheit erhöhen und die richterrechtliche Grundrechtsentwicklung legitimieren.
Der Inhalt der Charta
Die Charta gliedert sich in sieben Kapitel mit insgesamt 54 Artikeln, die Bereiche wie Würde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte, justizielle Rechte und allgemeine Bestimmungen behandeln. Zu den zentralen Bestimmungen gehören das Recht auf Leben, Unversehrtheit und das Verbot der Folter sowie die Gewissens-, Meinungsäußerungs- und Versamlungsfreiheit.
Grundrechtsträger und Grundrechtsverpflichtete
Die Charta definiert die Personen, die von den Grundrechten profitieren (Grundrechtsträger), und die Institutionen, die diese Rechte respektieren müssen (Grundrechtsverpflichtete). Zu den Grundrechtsträgern zählen alle Personen, die sich innerhalb des Anwendungsbereichs der Charta befinden, unabhängig von ihrer Nationalität.
Zum Status der Charta
Die Charta hat einen besonderen Status im System der europäischen Grundrechtsordnung. Sie soll die bisherigen Entwicklungen im Bereich des Grundrechtsschutzes durch den EuGH zusammenfassen und systematisieren. Allerdings ist ihr genaues Verhältnis zu den Verträgen und dem sekundären Recht der EU umstritten.
Das Verhältnis der Charta zur EMRK
Die Charta greift viele Grundrechte auf, die bereits in der EMRK verankert sind. Die Beziehung zwischen beiden Dokumenten ist komplex und erfordert eine genaue Analyse, um die jeweilige Bedeutung und den Anwendungsbereich der beiden Rechtsakte zu verstehen.
Kritische Bemerkungen zur Charta
Die Grundrechtscharta wird von verschiedenen Seiten kritisiert. Einige kritisieren die Einbeziehung sozialer Grundrechte, da diese in den Verfassungen der Mitgliedstaaten unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Andere bemängeln, dass die Charta einen zu weit gefassten Anwendungsbereich habe und die Handlungsfreiheit der Mitgliedstaaten einschränke.
Die Charta als Teil einer künftigen Verfassung?
Die Debatte über eine künftige EU-Verfassung stellt die Frage nach dem Status der Grundrechtscharta. Einige fordern eine Einbindung der Charta in eine Verfassung, während andere dies ablehnen und stattdessen einen weiterentwickelten Status der Charta innerhalb der bestehenden Rechtsordnung befürworten.
Schlüsselwörter
Grundrechte, Grundrechtscharta, Europäische Union, EuGH, EMRK, Menschenrechte, Freiheitsrechte, Gleichheitsrechte, soziale Grundrechte, Rechtsordnung, Rechtssicherheit, Verfassung, europäische Identität.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die EU-Grundrechtscharta proklamiert?
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union wurde am 8. Dezember 2000 in Nizza feierlich proklamiert.
Wer leitete den Konvent zur Erarbeitung der Charta?
Der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog übernahm den Vorsitz des Gremiums.
In welche Kapitel ist die Charta gegliedert?
Die Charta umfasst sieben Kapitel: Würde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte, justizielle Rechte und allgemeine Bestimmungen.
Wie verhält sich die Charta zur EMRK?
Die Charta greift viele Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) auf, stellt aber ein eigenständiges Dokument dar, das speziell auf die EU zugeschnitten ist.
Warum wurde die Grundrechtscharta geschaffen?
Hauptziele waren die Erhöhung der Sichtbarkeit der Rechte für Unionsbürger, die Stärkung des Rechtsschutzes gegenüber EU-Organen und die Dokumentation einer gemeinsamen europäischen Identität.
Wer sind die Grundrechtsverpflichteten der Charta?
Verpflichtet sind primär die Organe und Einrichtungen der EU sowie die Mitgliedstaaten, wenn sie Unionsrecht durchführen.
- Citar trabajo
- Dr. Gerald G. Sander (Autor), 2001, Anmerkungen zur Charta der Grundrechte der EU, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7275