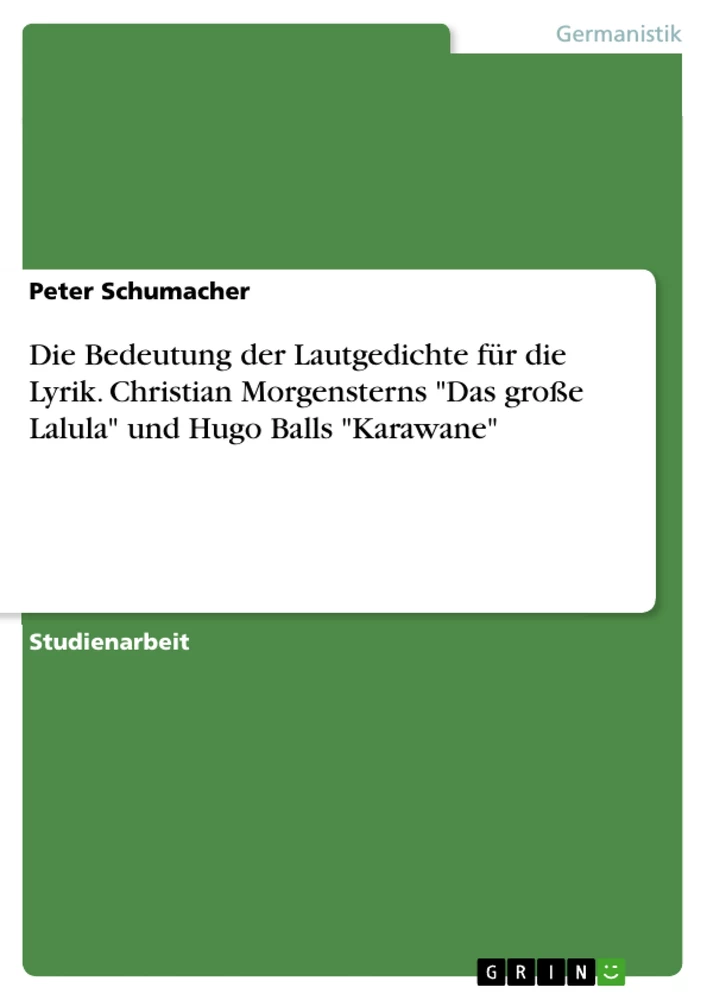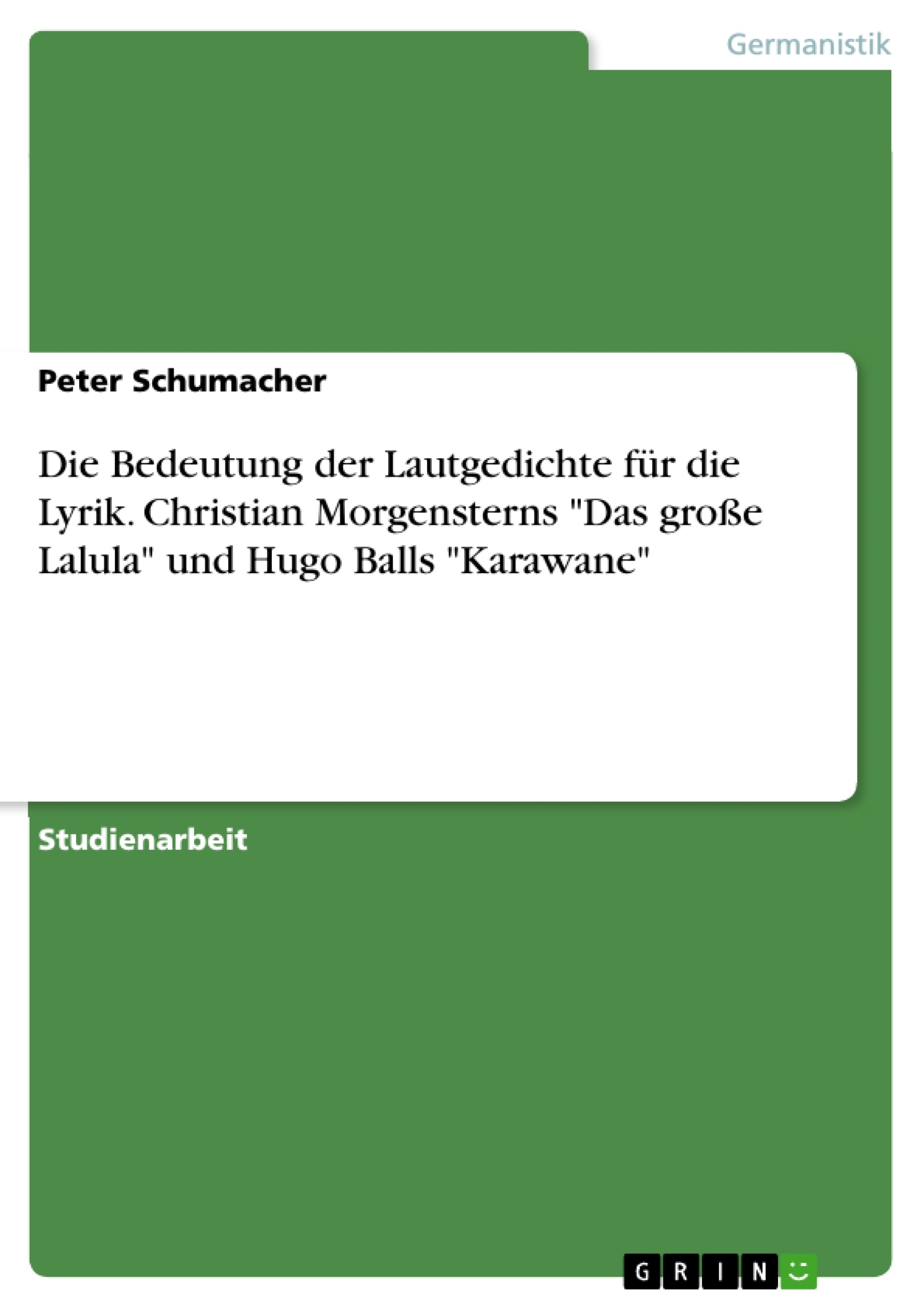Schon von Beginn an hatte es die Lautdichtung schwer, ernstgenommen zu werden. Ihre lyrische Berechtigung wurde von Anfang an diskutiert. Viele Kritiker in der Zeit der Entstehung und in der Blütezeit der Lautpoesie, dem Dadaismus, standen ihr völlig ohne Verständnis gegenüber. Sie reagierten bisweilen völlig abwehrend bis hin zu aggressiv. Die Lautdichtung wird von ihnen, ohne dass eine nähere Auseinandersetzung stattgefunden hat, pauschal abgewertet. So ist sie laut Reinhard Lettau nur ein Rückfall in menschliche Urzeit, also „infantile Regression“. Friedhelm Kemp geht sogar so weit, den Lautdichtern sprachliches Unvermögen vorzuwerfen, weswegen „diese ästhetischen Adamiten“ die Kritik und Abkehr von der Sprache nur als Vorwand nutzen um dies zu kaschieren.
In der folgenden Arbeit zeige ich auf, dass die Lautdichtung ein ernstzunehmender Zweig der Lyrik ist. Hierfür werde ich zunächst eine Definition und Erläuterung der beiden vorhandenen Strömungen innerhalb der Lautdichtung vornehmen. Danach folgt die Interpretation zweier Werke aus den zwei unterschiedlichen Strömungen der Lautpoesie. Im Fazit lege ich dann anhand der beiden interpretierten Werke dar, dass Lautdichtung ihre Berechtigung innerhalb der Poesie hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Interpretationen
- Christian Morgenstern: Das große Lalulā
- Hugo Ball: Karawane
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text befasst sich mit der Lautdichtung und argumentiert für deren Berechtigung als ernstzunehmender Zweig der Lyrik. Der Autor untersucht die verschiedenen Strömungen innerhalb der Lautpoesie, definiert deren Merkmale und beleuchtet die Intentionen der Dichter, die auf das Wort als Bedeutungsträger verzichten.
- Definition und Merkmale der Lautdichtung
- Die zwei Strömungen der Lautpoesie: Nonsensgedichte und Lautgedichte mit Titelbezug
- Der Verzicht auf das Wort als Bedeutungsträger und die Kritik an der traditionellen Sprache
- Die Rolle der Lautpoesie im Kontext des Dadaismus und des Ersten Weltkriegs
- Die Bedeutung der akustischen Realisation und die Einordnung der Lautpoesie in die Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Bedeutung der Lautdichtung und die Ablehnung, die sie vonseiten der Kritik erfahren hat. Sie kündigt die Absicht an, die Lautdichtung als eigenständigen Zweig der Lyrik zu verteidigen.
Im zweiten Kapitel wird die Lautdichtung definiert und die zwei wichtigen Strömungen innerhalb dieser Gattung unterschieden: Nonsensgedichte, die jegliche semantische Referenz ablehnen, und Lautgedichte, die durch den Titel einen Sinnzusammenhang erhalten. Es werden auch die drei wesentlichen Merkmale der Lautpoesie - der Verzicht auf das Wort, die Komposition von Sprachlauten und die akustische Realisation - herausgestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Interpretation zweier Werke aus den unterschiedlichen Strömungen der Lautpoesie: „Das große Lalulā“ von Christian Morgenstern und „Karawane“ von Hugo Ball. Durch diese Analyse soll die Berechtigung der Lautdichtung innerhalb der Lyrik demonstriert werden.
Schlüsselwörter
Lautdichtung, Lautpoesie, Nonsensgedichte, Klanggedicht, phonetisches Gedicht, akustische Poesie, Dadaismus, Hugo Ball, Christian Morgenstern, Verzicht auf das Wort, Sprachlaute, akustische Realisation, Lyrik, Versstruktur, Liedhaftigkeit, Wort- und Sprachmusik, Propaganda, Manipulation, Realität.
- Quote paper
- Peter Schumacher (Author), 2007, Die Bedeutung der Lautgedichte für die Lyrik. Christian Morgensterns "Das große Lalula" und Hugo Balls "Karawane", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72727