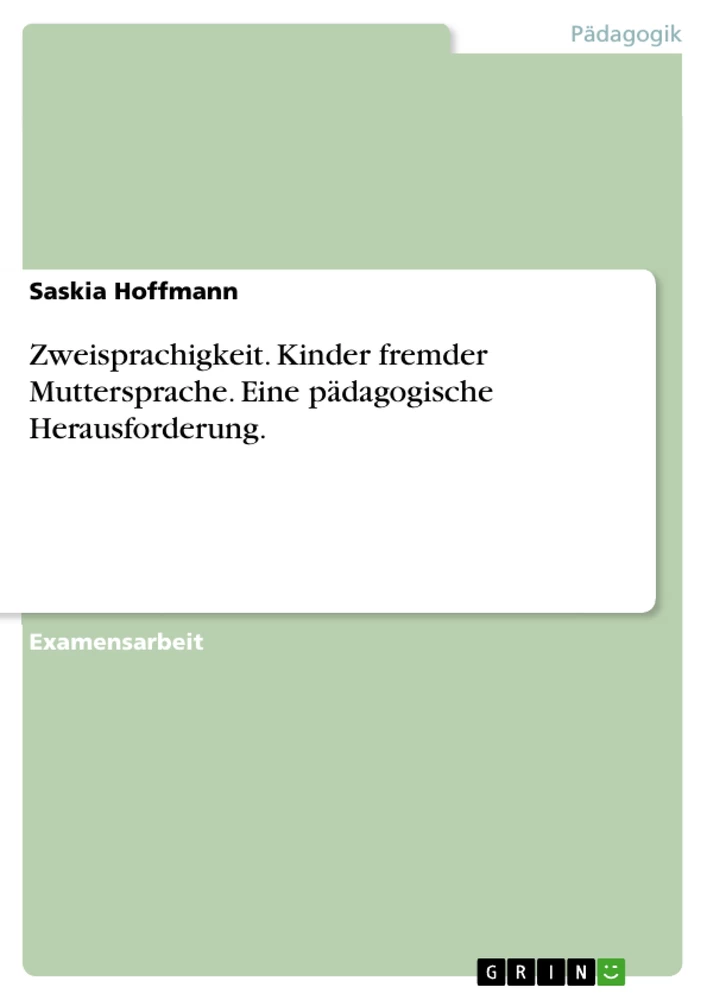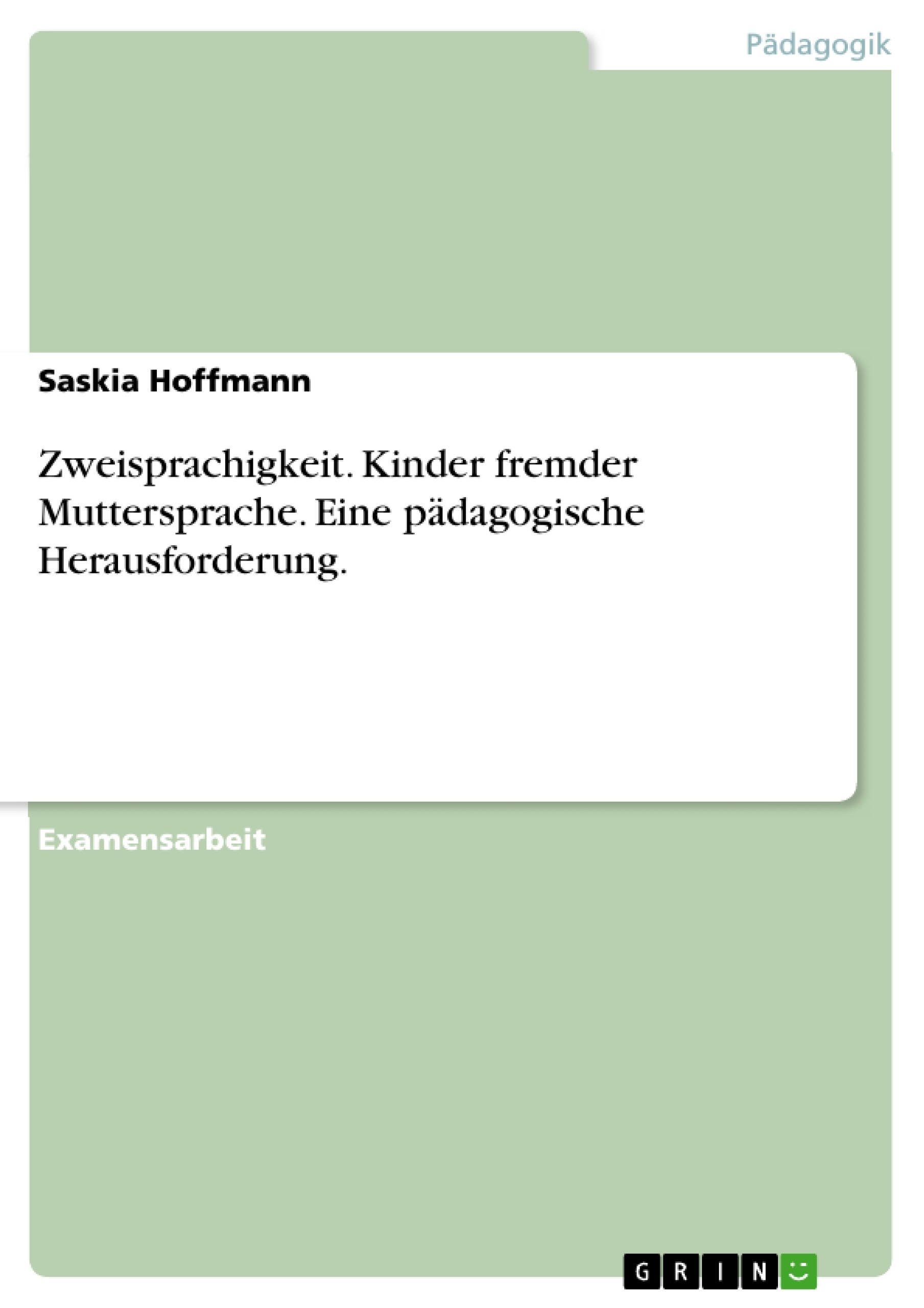Unsere heutige Gesellschaft ist von einem sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Wandel geprägt. Dieser bringt eine ethnische Vielfalt mit, die die Gesellschaft zunehmend heterogener werden lässt. In Deutschland sind bereits mehr als zehn Millionen Menschen zweisprachig. Rund ein Fünftel der Schüler haben Deutsch als Zweitsprache und damit eine nichtdeutsche Muttersprache. Oft treten sie in den Kindergarten oder die Schule ein, ohne vorher mit der deutschen Sprache konfrontiert worden zu sein. Sie lernen die Zweitsprache Deutsch unter erschwerten Bedingungen. Die Schwierigkeiten dieser Schüler im Zweitspracherwerb werden oft zu spät erkannt, wenn die Kulturtechniken wie Schreiben und Lesen nicht altersgemäß beherrscht werden. Das Thema Zweisprachigkeit wird daher auch in der Sprachbehindertenpädagogik immer aktueller. Oftmals werden die Schwierigkeiten dieser Kinder in ihrer Zweitsprache fälschlicherweise auf eine Sprachbehinderung zurückgeführt.
Diese Arbeit bezieht sich vor allem auf die Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund. Der Titel deutet bereits darauf hin, dass Zweisprachigkeit nicht als Belastung, sondern als eine pädagogische Herausforderung gesehen werden muss, die es unter Beachtung beider Sprachen zu meistern gilt. Nur so ist es möglich, diesen Kindern gerecht zu werden. Es gilt, die Lebenswirklichkeit, Stärken und Schwächen zweisprachiger Kinder zu beachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie Kinder sprechen lernen - Erstspracherwerb
- Erklärungsversuche aus der Spracherwerbsforschung
- Behaviorismus
- Nativismus
- Kognitivismus
- Interaktionismus
- Bedingungen für einen erfolgreichen Erstspracherwerb
- Sensomotorische Entwicklung
- Hörvermögen
- Sehvermögen
- Tastsinn
- Sprechwerkzeuge
- Hirnreifung
- Motivation
- Familiäre Lebensbedingungen
- Sensomotorische Entwicklung
- Entwicklungsphasen des Erstspracherwerbs
- Erklärungsversuche aus der Spracherwerbsforschung
- Zweisprachigkeit und Zweitspracherwerb
- Definitionen
- Erstsprache
- Muttersprache
- Zweisprachigkeit
- Mehrsprachigkeit
- Gruppen von Menschen mit fremder Muttersprache
- Aussiedler
- Gastarbeiter
- Asylbewerber
- Rahmenbedingungen des Zweitspracherwerbs
- Das Kind als Person
- Die Situation in der Familie
- Die Spracherziehungsmethoden
- Eine Person - eine Sprache
- Umgebungssprache – Familiensprache
- Schulsprache Familiensprache/Umgebungssprache
- Situationsabhängige Sprachtrennung
- Das soziale Umfeld
- Bildungspolitische Rahmenbedingungen
- Konzepte des Zweitspracherwerbs
- Gesteuerter und ungesteuerter Zweitspracherwerb
- Simultaner und sukzessiver Zweitspracherwerb
- Additiver und subtraktiver Zweitspracherwerb
- Doppelte Halbsprachigkeit/Semilingualismus
- Theorien zum Erwerb von Zweisprachigkeit
- Die Kontrastivhypothese
- Die Identitätshypothese
- Die Interlanguage-Hypothese
- Die Schwellen- und die Interdependenz-Hypothese
- Definitionen
- Chancen und Gefahren bei zweisprachiger Erziehung
- Zweisprachigkeit als Abweichung
- Probleme der Stigmatisierung
- Bedeutung der Zweisprachigkeit für die Identitätsentwicklung
- Problematik und Möglichkeiten der Sprachstandsdiagnose
- Probleme und Chancen in der Sprache
- Metasprachliche Fähigkeiten
- Sprachwechsel
- Sprachmischungen
- Interferenzen
- Mischsprache
- Fossilierungen und Backsliding
- Sprachverweigerung
- Stottern
- Verzögerte Sprachentwicklung
- Stammeln
- Lese-Rechtschreib-Schwäche
- Schriftspracherwerb
- Probleme und Möglichkeiten in der Bildungspolitik
- Segregation
- Sprachschutzprogramm
- Submersion
- Immersion
- Two-way-Modelle
- Deutsch als Zweitsprache
- Vorbereitungsklassen
- Muttersprachlicher Unterricht
- Fremdsprachlicher Fachunterricht
- Samstagsschulen
- Fremdsprachenunterricht
- Internationale Schulen
- Europäische Schulen
- Europaschulen und Schulversuche an staatlichen Schulen
- Einzeldarstellung eines Mädchens mit russischer Muttersprache
- Anamnese
- Rahmenbedingungen
- Situation in der Familie und im sozialen Umfeld
- Situation in der Schule
- Die Betrachtung des Kindes
- Sozial-emotionaler Bereich
- Sensumotorischer Bereich
- Kognitiver Bereich
- Sprachlich-kommunikativer Bereich
- Aussprache
- Wortschatz
- Redefluss
- Auditive Wahrnehmung
- Sprachbewusstsein/phonologische Bewusstheit
- Sprachverständnis
- Sprachgedächtnis
- Grammatik
- Lesefähigkeit
- Fähigkeiten in der Schriftsprache
- Überlegungen zur möglichen Genese der sprachlichen Beeinträchtigung
- Fördermaßnahmen
- Bisherige Fördermaßnahmen
- Darstellung der Fördermaßnahmen
- Fördereinheit: Wir machen Obstsalat
- Fördereinheit: Sprechreim zum Thema „Mein Körper“
- Vorschläge für die weitere pädagogische Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die pädagogischen Herausforderungen, die sich aus dem Spracherwerb von Kindern mit fremder Muttersprache ergeben. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Aspekte des Erst- und Zweitspracherwerbs zu entwickeln und konkrete Fördermöglichkeiten aufzuzeigen.
- Erstspracherwerb und seine Einflussfaktoren
- Theorien und Konzepte des Zweitspracherwerbs
- Chancen und Risiken zweisprachiger Erziehung
- Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit fremder Muttersprache
- Bildungspolitische Rahmenbedingungen und Fördermodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachlichen Herausforderungen bei Kindern mit fremder Muttersprache ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie begründet die Relevanz des Themas und legt den Fokus auf die pädagogischen Aspekte.
Wie Kinder sprechen lernen - Erstspracherwerb: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexen Prozesse des Erstspracherwerbs. Es werden verschiedene Erklärungsmodelle aus der Spracherwerbsforschung (Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus) vorgestellt und kritisch diskutiert. Besondere Beachtung finden die Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb, wie sensomotorische Entwicklung, Hirnreifung, Motivation und familiäre Lebensbedingungen. Die Entwicklungsphasen des Erstspracherwerbs werden ebenfalls beschrieben, um ein vollständiges Bild zu liefern.
Zweisprachigkeit und Zweitspracherwerb: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Erstsprache, Muttersprache, Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit. Es werden verschiedene Gruppen von Kindern mit fremder Muttersprache (Aussiedler, Gastarbeiter, Asylbewerber) vorgestellt und die Rahmenbedingungen des Zweitspracherwerbs analysiert. Hierzu zählen der Einfluss des Kindes, der Familie, der Spracherziehungsmethoden und des sozialen Umfelds sowie bildungspolitische Rahmenbedingungen. Verschiedene Konzepte des Zweitspracherwerbs (gesteuert/ungesteuert, simultan/sukzessiv, additiv/subtraktiv) und Theorien (Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguage-Hypothese, Schwellen- und Interdependenzhypothese) werden diskutiert.
Chancen und Gefahren bei zweisprachiger Erziehung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Chancen und Herausforderungen der zweisprachigen Erziehung. Es analysiert die Problematik der Stigmatisierung von Kindern mit anderer Muttersprache und untersucht die Bedeutung der Zweisprachigkeit für die Identitätsentwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sprachstandsdiagnose, ihren Möglichkeiten und Problemen. Schließlich werden verschiedene sprachliche Phänomene (z.B. Sprachmischungen, Interferenzen, Sprachverweigerung) und ihre Bedeutung im Kontext des Zweitspracherwerbs detailliert behandelt. Im Abschnitt zur Bildungspolitik werden unterschiedliche Integrationsmodelle und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
Einzeldarstellung eines Mädchens mit russischer Muttersprache: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Fallstudie eines Mädchens mit russischer Muttersprache. Es beinhaltet eine Anamnese, die Beschreibung der familiären und schulischen Rahmenbedingungen, sowie eine umfassende sprachliche und sozio-emotionale Analyse des Kindes. Die möglichen Ursachen der sprachlichen Beeinträchtigungen werden diskutiert und konkrete Fördermaßnahmen werden beschrieben und evaluiert. Zusätzlich werden Vorschläge für die weitere pädagogische Arbeit gegeben.
Schlüsselwörter
Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, Spracherwerbsforschung, Fremdsprachenunterricht, Sprachförderung, Sprachdiagnostik, Integration, Bildungspolitik, Identitätsentwicklung, Kinder mit Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Spracherwerb von Kindern mit fremder Muttersprache
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Spracherwerb bei Kindern mit fremder Muttersprache. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den pädagogischen Herausforderungen und Fördermöglichkeiten im Erst- und Zweitspracherwerb.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: Erstspracherwerb und seine Einflussfaktoren (u.a. Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus), Theorien und Konzepte des Zweitspracherwerbs (u.a. simultan/sukzessiv, additiv/subtraktiv), Chancen und Risiken zweisprachiger Erziehung, Sprachdiagnostik und -förderung, bildungspolitische Rahmenbedingungen und Fördermodelle (z.B. Immersion, Submersion, Two-way-Modelle), sowie eine Fallstudie eines Mädchens mit russischer Muttersprache.
Welche Erklärungsmodelle zum Erstspracherwerb werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert und diskutiert verschiedene Erklärungsmodelle aus der Spracherwerbsforschung zum Erstspracherwerb: den Behaviorismus, den Nativismus, den Kognitivismus und den Interaktionismus. Diese Modelle werden im Kontext der Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb (sensomotorische Entwicklung, Hirnreifung, Motivation, familiäre Lebensbedingungen) erläutert.
Welche Konzepte und Theorien zum Zweitspracherwerb werden behandelt?
Im Bezug auf den Zweitspracherwerb werden verschiedene Konzepte wie gesteuerter/ungesteuerter, simultaner/sukzessiver und additiver/subtraktiver Zweitspracherwerb erläutert. Zusätzlich werden Theorien wie die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese, die Interlanguage-Hypothese sowie die Schwellen- und Interdependenzhypothese diskutiert.
Welche Chancen und Gefahren der zweisprachigen Erziehung werden angesprochen?
Das Dokument beleuchtet die Chancen der zweisprachigen Erziehung im Hinblick auf die Identitätsentwicklung und die kognitiven Vorteile. Es thematisiert aber auch die Gefahren wie Stigmatisierung, Sprachprobleme (Sprachmischungen, Interferenzen, Sprachverweigerung etc.) und die Herausforderungen der Sprachstandsdiagnose. Es werden verschiedene bildungspolitische Ansätze zur Integration von Kindern mit anderer Muttersprache (z.B. Immersion, Submersion, Two-way-Modelle) diskutiert.
Wie wird die Sprachförderung im Dokument dargestellt?
Die Sprachförderung wird sowohl auf theoretischer Ebene (durch die Diskussion verschiedener Ansätze und Theorien) als auch auf praktischer Ebene (durch die Fallstudie eines Mädchens mit russischer Muttersprache) dargestellt. Die Fallstudie beinhaltet konkrete Fördermaßnahmen und Vorschläge für die weitere pädagogische Arbeit, z.B. Fördereinheiten mit spielerischen Ansätzen.
Welche bildungspolitischen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Das Dokument analysiert verschiedene bildungspolitische Rahmenbedingungen und Fördermodelle für Kinder mit fremder Muttersprache, darunter Segregation, Sprachschutzprogramme, Submersion, Immersion, Two-way-Modelle, Deutsch als Zweitsprache, Vorbereitungsklassen, muttersprachlicher Unterricht, fremdsprachlicher Fachunterricht, Samstagsschulen, Fremdsprachenunterricht, internationale und europäische Schulen.
Was ist die Fallstudie?
Die Fallstudie beschreibt detailliert den Spracherwerb eines Mädchens mit russischer Muttersprache. Sie umfasst eine Anamnese, die Beschreibung des familiären und schulischen Umfelds, eine sprachliche und sozio-emotionale Analyse des Kindes, Überlegungen zur Genese der sprachlichen Beeinträchtigung sowie konkrete Fördermaßnahmen und Vorschläge für zukünftige Förderung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter zum besseren Verständnis des Dokuments sind: Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, Spracherwerbsforschung, Fremdsprachenunterricht, Sprachförderung, Sprachdiagnostik, Integration, Bildungspolitik, Identitätsentwicklung, Kinder mit Migrationshintergrund.
- Quote paper
- Saskia Hoffmann (Author), 2006, Zweisprachigkeit. Kinder fremder Muttersprache. Eine pädagogische Herausforderung., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72714