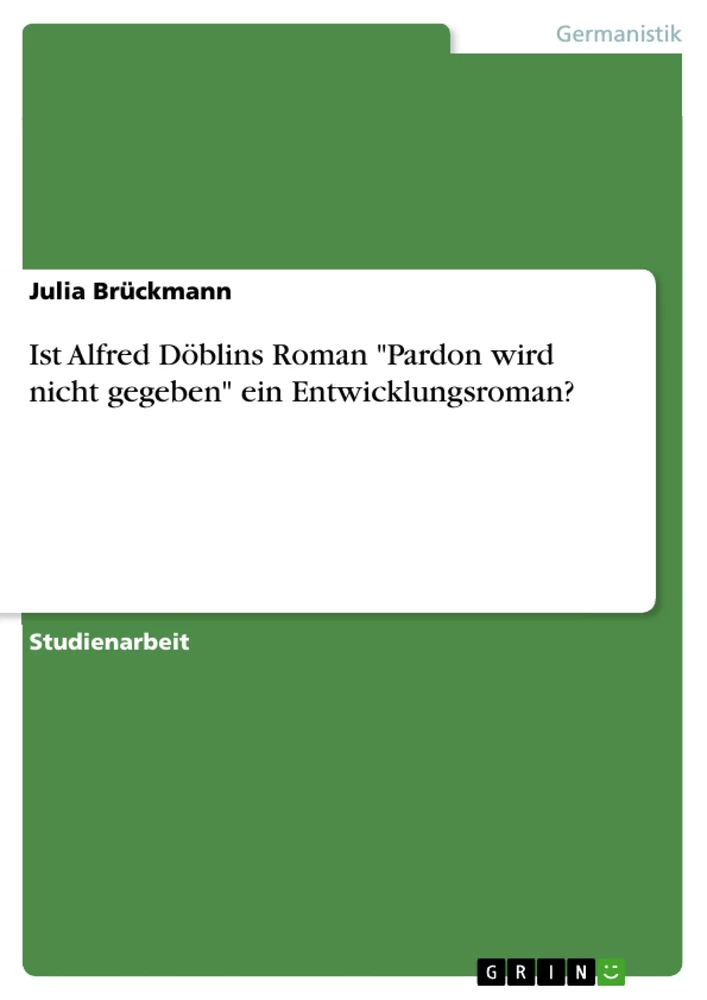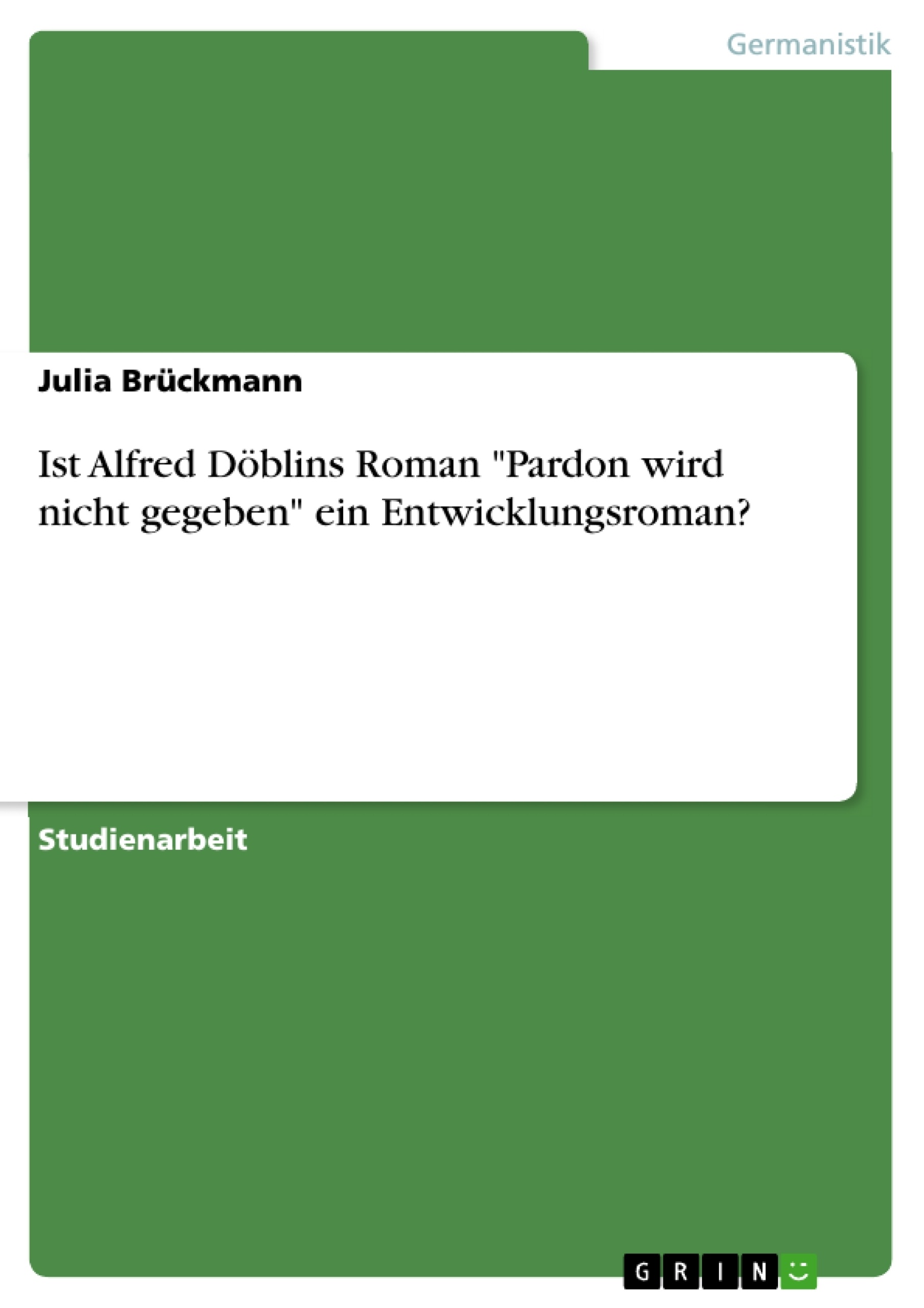Hört man den Namen Alfred Döblin, denkt man sofort an sein bekanntestes Werk „Berlin Alexanderplatz“, welches der Schriftsteller und Arzt 1929 verfasst hat. Weitaus weniger bekannt ist hingegen sein erster Roman, den er 1934 im französischen Exil schrieb: „Pardon wird nicht gegeben“. Er ist sein zweiter Berlin-Roman, in dem Döblin das Leben von Karl und seiner Familie aufzeigt, wie sie nach dem Tod des Vaters in die Großstadt ziehen. Dort lernen sie die Armut kennen, und nach einem gescheiterten Selbstmordversuch der Mutter muss Karl für die Familie sorgen. Der bald darauf erwachende Ehrgeiz der Mutter treibt Karl in die Fabrik des Onkels, wo er bald Karriere macht und durch eine arrangierte Hochzeit in die besseren Kreise aufsteigt.
„Berlin Alexanderplatz“ wird von vielen Literaturkritikern als Entwicklungsroman eingestuft. Auch in „Pardon wird nicht gegeben“ gibt es viele Anhaltspunkte, um auf einen Entwicklungsroman zu schließen. Ob dies also zutrifft, werde ich in der folgenden Arbeit untersuchen.
In dem ersten Schritt geht es um die Geschichte des Entwicklungsroman-Begriffs. Ich werde klären, wie er entstanden ist, wer ihn geprägt hat und in wieweit er sich von dem Bildungsroman-Begriffs unterscheidet.
Danach werde ich anhand des „Strukturmodells des Entwicklungsromans“, welches Herbert Tiefenbacher 1982 verfasst hat, „Pardon“ auf Parallelen und Unterschiede zum Entwicklungsroman hin untersuchen.
Abschließend geht es um die Ergebnisse, die dieser Vergleich mit dem Strukturmodell und den Definitionen erbracht hat. Ich werde versuchen zu klären, in wieweit Döblins Werk ein Entwicklungsroman ist, ob es überhaupt einer ist oder ob ein anderer Begriff passender wäre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Begriffe Bildungs- und Entwicklungsroman
- Entstehung und Definition des Bildungsromans
- Entstehung und Definition des Entwicklungsromans
- Pardon wird nicht gegeben - ein Entwicklungsroman?
- Strukturmodell des Entwicklungsromans
- Der Ausgangszustand
- Austritt aus der Harmonie
- Erste Makrosequenz
- Identitätskrise
- Neubeginn
- Zweite Makrosequenz
- Endzustand
- Strukturmodell des Entwicklungsromans
- Abschließende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit Alfred Döblins Roman „Pardon wird nicht gegeben“ als Entwicklungsroman klassifiziert werden kann. Dazu wird zunächst der Begriff des Entwicklungsromans im Kontext des Bildungsromans historisch und theoretisch beleuchtet. Anschließend wird Döblins Roman anhand eines etablierten Strukturmodells des Entwicklungsromans analysiert, um Parallelen und Unterschiede aufzuzeigen.
- Die historische Entwicklung und Definition des Bildungs- und Entwicklungsromans
- Die Anwendung eines Strukturmodells des Entwicklungsromans auf „Pardon wird nicht gegeben“
- Der Vergleich von Döblins Roman mit den Kriterien des Entwicklungsromans
- Die Identifizierung von Ähnlichkeiten und Unterschieden
- Die Schlussfolgerung bezüglich der Einordnung von „Pardon wird nicht gegeben“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Einordnung von Döblins „Pardon wird nicht gegeben“ als Entwicklungsroman. Sie nennt Döblins bekanntestes Werk „Berlin Alexanderplatz“ und führt kurz die Handlung von „Pardon wird nicht gegeben“ ein, in der der Protagonist Karl nach dem Tod seines Vaters in Berlin mit Armut und den Herausforderungen des städtischen Lebens konfrontiert wird. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der die historische Entwicklung des Entwicklungsroman-Begriffs beleuchtet und anschließend Döblins Roman anhand eines Strukturmodells untersucht.
Die Begriffe Bildungs- und Entwicklungsroman: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Definition der Begriffe Bildungs- und Entwicklungsroman. Es präsentiert verschiedene historische Ansätze, beginnend mit Morgensterns Definition des Bildungsromans, und analysiert die Beiträge von Fritz Martini und Wilhelm Dilthey zur Ausgestaltung dieser Konzepte. Diltheys Bezug auf Goethe's "Wilhelm Meister" als Paradebeispiel für den Bildungsroman wird hervorgehoben, ebenso die Entwicklung des Begriffs im Kontext gesellschaftlicher und literarischer Strömungen. Das Kapitel beleuchtet die charakteristischen Merkmale des Bildungsromans nach Dilthey, wie die Entwicklung in festgelegten Stufen und die Orientierung an einem Idealzustand. Schließlich wird die Erweiterung des Begriffs und die Einführung des umfassenderen Entwicklungsromans erläutert, da die engere Definition des Bildungsromans als zu restriktiv angesehen wird.
Schlüsselwörter
Alfred Döblin, Pardon wird nicht gegeben, Entwicklungsroman, Bildungsroman, Strukturmodell, Identitätskrise, Sozialer Aufstieg, Großstadt, Armut, Literaturkritik, Herber Tiefenbacher, Wilhelm Dilthey, Fritz Martini.
Häufig gestellte Fragen zu Alfred Döblins "Pardon wird nicht gegeben" - Eine Analyse als Entwicklungsroman
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob Alfred Döblins Roman "Pardon wird nicht gegeben" als Entwicklungsroman klassifiziert werden kann. Sie analysiert den Roman anhand eines etablierten Strukturmodells des Entwicklungsromans und vergleicht ihn mit den Kriterien dieses Genres.
Welche Aspekte des Entwicklungsromans werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung und Definition des Bildungs- und Entwicklungsromans, einschließlich der Beiträge von Autoren wie Morgenstern, Fritz Martini und Wilhelm Dilthey. Es wird ein Strukturmodell des Entwicklungsromans vorgestellt und auf "Pardon wird nicht gegeben" angewendet. Die Analyse umfasst den Ausgangszustand, den Austritt aus der Harmonie, Identitätskrisen, Neubeginne und den Endzustand des Protagonisten.
Wie wird der Roman "Pardon wird nicht gegeben" analysiert?
Die Analyse basiert auf einem etablierten Strukturmodell des Entwicklungsromans. Der Roman wird Schritt für Schritt anhand der einzelnen Phasen dieses Modells untersucht, um Parallelen und Unterschiede zu den typischen Merkmalen eines Entwicklungsromans aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Protagonisten Karl im Kontext von Armut und den Herausforderungen des städtischen Lebens in Berlin.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Alfred Döblin, Pardon wird nicht gegeben, Entwicklungsroman, Bildungsroman, Strukturmodell, Identitätskrise, sozialer Aufstieg, Großstadt, Armut, Literaturkritik, Herber Tiefenbacher, Wilhelm Dilthey, Fritz Martini.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Bildungs- und Entwicklungsroman, eine Analyse von "Pardon wird nicht gegeben" anhand des Strukturmodells des Entwicklungsromans und eine abschließende Bewertung.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann Alfred Döblins Roman "Pardon wird nicht gegeben" als Entwicklungsroman eingeordnet werden?
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt die Forschungsfrage, nennt Döblins bekanntestes Werk ("Berlin Alexanderplatz") und skizziert kurz die Handlung von "Pardon wird nicht gegeben". Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und die Methodik der Analyse.
Welche Rolle spielen Dilthey und Martini in der Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf die Beiträge von Wilhelm Dilthey und Fritz Martini zur Definition und Ausgestaltung der Konzepte Bildungs- und Entwicklungsroman. Diltheys Bezug auf Goethes "Wilhelm Meister" und die von ihm herausgestellten Merkmale des Bildungsromans werden diskutiert.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen?
Die abschließende Bewertung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage, ob "Pardon wird nicht gegeben" als Entwicklungsroman eingeordnet werden kann. Die Arbeit vergleicht die Ergebnisse mit den definierten Kriterien des Entwicklungsromans und zieht eine Schlussfolgerung auf Grundlage der durchgeführten Analyse.
- Quote paper
- Julia Brückmann (Author), 2001, Ist Alfred Döblins Roman "Pardon wird nicht gegeben" ein Entwicklungsroman?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72553