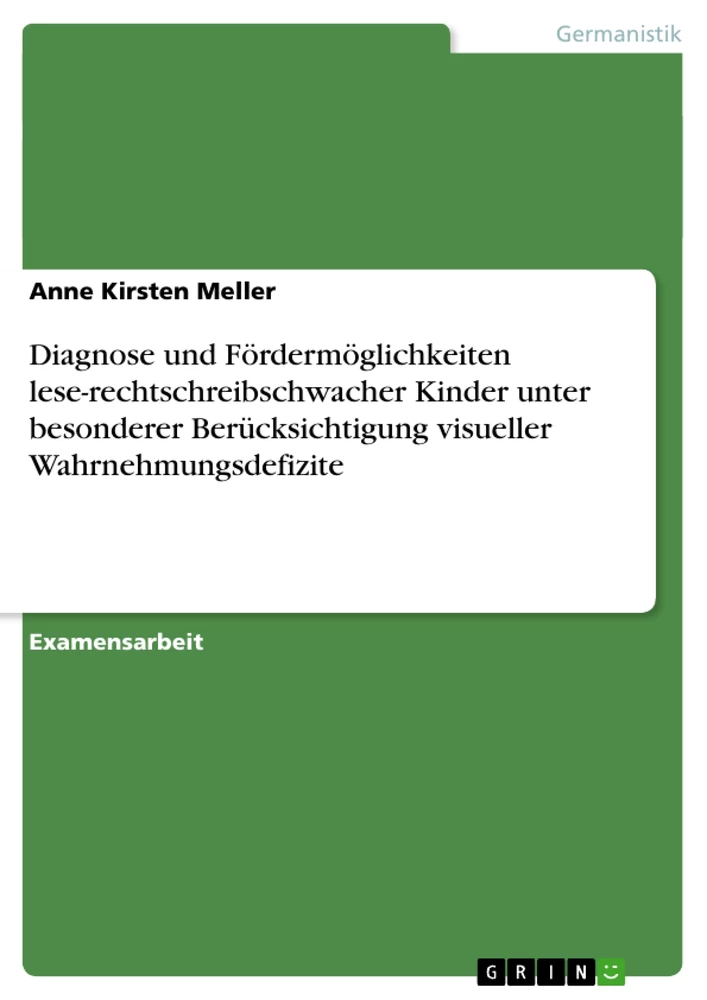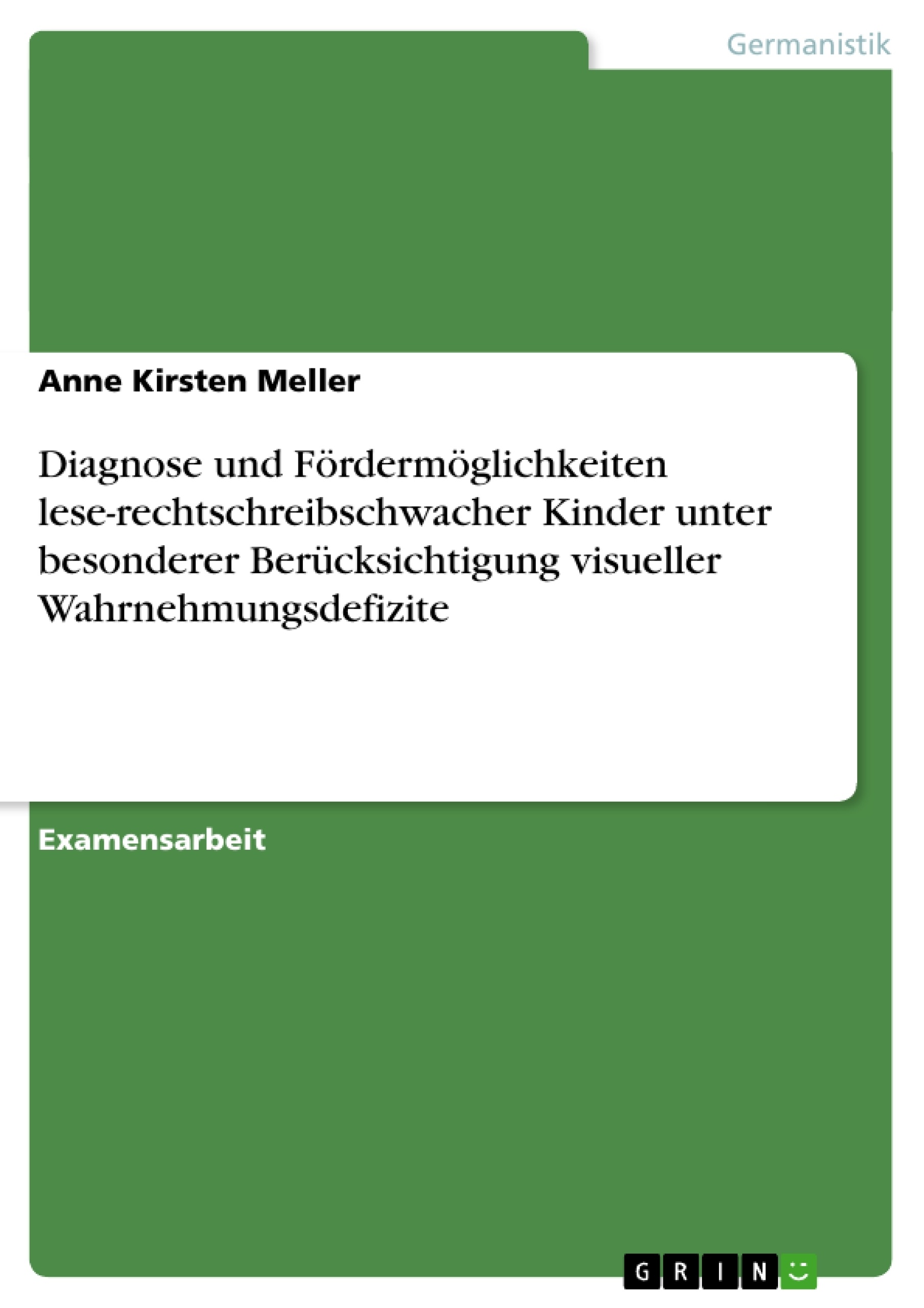Die folgende Staatsarbeit beschäftigt sich mit einer in Schulen und Wissenschaft hochaktuellen Thematik, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS). Oft wird bei Kindern eine LRS vermutet, für die jedoch keine eindeutige Erklärung vorliegt. Wie kann eine LRS diagnostiziert werden und welche Fördermöglichkeiten können seitens der Eltern, der Schule, und der Gesellschaft geboten werden, um Kindern wie Nadja das Lesen und Schreiben zu erleichtern?
Immer wieder suchen Eltern, Lehrer und die pädagogische sowie medizinische Forschung nach Ursachen einer LRS. Da bis heute immer wieder visuelle Wahrnehmungsstörungen als Hauptursache für LRS angenommen werden und einen intensiven Teil der Forschungspraxisbilden, wird in der vorliegenden besonders auf visuelle Schwächen, sowohl hinsichtlich der Diagnose, als auch der Förderung bei diagnostizierten Mängeln der Schriftsprache Bezug genommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hinführung zur Thematik und Aufbau der Arbeit
- 3 Überblick über Lese– Rechtschreibschwäche (LRS)
- 3.1 Historischer Abriss des Begriffs LRS
- 3.2 Definitionen
- 3.3 Erlasslage in NRW
- 3.4 Anzeichen und Symptomatik der LRS
- 3.4.1 Symptome einer Lesestörung
- 3.4.2 Schwächen in der Rechtschreibung:
- 3.4.3 Sekundäre, begleitende Symptome
- 3.5 Mögliche Risikofaktoren und Ursachenannahmen der LRS
- 3.5.1 Störungen des Speicherns, Behaltens und Abrufs
- 3.5.2 Individuelle körperliche Faktoren
- 3.5.2.1 Motorische Auffälligkeiten
- 3.5.2.2 Linkshändigkeit
- 3.5.3 Genetische „Vorbelastung“
- 3.5.4 Soziale und kognitive Faktoren
- 3.5.5 Schulische Bedingungen
- 3.5.6 Defizite der auditiven Wahrnehmung und sprachliche Defizite
- 3.5.7 Defizite in der visuellen Informationsverarbeitung
- 3.5.7.1 Visuelle Wahrnehmung und cerebrale Funktionen
- 3.5.7.1.1 Grundlagen des Sehens und der Verarbeitung visueller Seheindrücke
- 3.5.7.1.2 Physiologische Grundlagen des Lesens
- 3.5.7.2 Voraussetzungen einer guten visuellen Wahrnehmung
- 3.5.7.2.1 Blicksteuerung und Dynamisches Sehen
- 3.5.7.2.2 Optische Differenzierung
- 3.5.7.3 Defizite der visuellen Wahrnehmung bei LRS
- 3.5.7.3.1 Fehlerhafte Blickbewegungen
- 3.5.7.3.2 Heterophorie und „Winkelfehlsichtigkeit“
- 3.5.7.1 Visuelle Wahrnehmung und cerebrale Funktionen
- 4 Diagnose von LRS
- 4.1 Stellenwert und Bedeutung der Diagnose
- 4.2 Förderdiagnostik
- 4.3 Multiaxiale Diagnostik
- 4.4 Psychodiagnostische Verfahren zur Früherkennung von LRS
- 4.4.1 Bielefelder Screening (BISC)
- 4.4.2 Differenzierungsprobe (DP)
- 4.4.3 Psycholinguistischer Entwicklungstest (PET)
- 4.4.4 Körperkoordinationstest für Kinder (KTK)
- 4.5 Hilfsangebote für Eltern und Lehrer
- 4.6 Standardisierte Testverfahren
- 4.6.1 Intelligenztests
- 4.6.2 Rechtschreibtests
- 4.6.3 Lesetests
- 4.7 Diagnose visueller Wahrnehmungsdefizite
- 4.7.1 Visuelle Auffälligkeiten
- 4.7.2 Augenärztliche, orthoptische und optometrische Untersuchungen
- 4.7.3 Testung visueller Wahrnehmungsfähigkeiten
- 4.7.3.1 Berücksichtigung der visuellen Wahrnehmung in ausgewählten Verfahren
- 4.7.3.2 Standardisierte Tests zur visuellen Wahrnehmungsfähigkeit
- 4.7.3.2.1 Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (FEW)
- 4.7.3.2.2 Test zur Prüfung optischer Differenzierungsleistungen (POD)
- 5 Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS
- 5.1 Schulische Förderung
- 5.1.1 Interne Förderung
- 5.1.2 Externe Förderung (Förderunterricht)
- 5.2 Außerschulische Fördermaßnahmen
- 5.2.1 In einer Fördereinrichtung
- 5.2.2 Zu Hause
- 5.3 Okuläre Therapien und Fördermöglichkeiten der visuellen Wahrnehmung
- 5.3.1 Okuläre Therapie
- 5.3.1.1 Prismenbrille
- 5.3.1.2 Okkulsionstherapie
- 5.3.1.3 Rasterbrille
- 5.3.1.4 Irlen- Therapie
- 5.3.2 Hinweise und Übungsanregungen für den Unterricht
- 5.3.3 Hilfen zur Erleichterung des Lese- Rechtschreibprozesses
- 5.3.4 Förderkonzept nach Marianne FROSTIG
- 5.3.5 Training mit Computerprogrammen
- 5.3.6 Außerschulisches, institutionelles Training visueller Funktionen
- 5.3.6.1 Optometrisches Visualtraining
- 5.3.6.2 Erfahrungen des Visualtrainings mit Sarah in England
- 5.3.7 Hinweise und Übungsanregungen zur visuellen Wahrnehmungsförderung durch die Eltern
- 5.3.1 Okuläre Therapie
- 5.1 Schulische Förderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diagnose und Fördermöglichkeiten lese-rechtschreibschwacher Kinder, wobei ein besonderer Fokus auf visuellen Wahrnehmungsdefiziten liegt. Ziel ist es, auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse Hilfestellungen für Eltern und Lehrkräfte zur frühzeitigen Diagnose und effektiven Förderung von LRS zu entwickeln.
- Historische Entwicklung des Verständnisses von LRS
- Definitionen und Symptome von LRS
- Diagnostische Verfahren zur Erkennung von LRS und visuellen Wahrnehmungsdefiziten
- Schulkische und außerschulische Fördermöglichkeiten
- Okuläre Therapien und Visualtraining
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Problematik von Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und der damit verbundenen Schwierigkeiten für betroffene Kinder. Sie führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach Diagnose- und Fördermöglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung visueller Wahrnehmungsdefizite.
2 Hinführung zur Thematik und Aufbau der Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Komplexität des Wahrnehmungsprozesses, insbesondere der visuellen Wahrnehmung, und deren Bedeutung für den Schriftspracherwerb. Es verdeutlicht anhand von Beispielen die subjektive Natur von Wahrnehmung und führt in den Aufbau der Arbeit ein.
3 Überblick über Lese– Rechtschreibschwäche (LRS): Kapitel 3 bietet einen umfassenden Überblick über LRS. Es beleuchtet den historischen Abriss der Begrifflichkeit, unterschiedliche Definitionen, die Erlasslage in NRW, die Symptomatik (Lesestörungen und Rechtschreibschwächen), mögliche Risikofaktoren (auditive und visuelle Wahrnehmungsstörungen, genetische Faktoren, soziale und schulische Bedingungen), und neurophysiologische Prozesse des Lesens. Der Fokus liegt auf der Rolle visueller Wahrnehmungsdefizite.
4 Diagnose von LRS: Kapitel 4 befasst sich mit der Diagnostik von LRS. Es beschreibt den Stellenwert und die Bedeutung einer umfassenden Diagnose, verschiedene diagnostische Ansätze (Förderdiagnostik und multiaxiale Diagnostik), verschiedene psychodiagnostische Verfahren zur Früherkennung (BISC, DP, PET, KTK) und standardisierte Testverfahren (Intelligenztests, Rechtschreibtests, Lesetests). Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Diagnose visueller Wahrnehmungsdefizite, inklusive augenärztlicher, orthoptischer und optometrischer Untersuchungen.
5 Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS: Kapitel 5 präsentiert verschiedene Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS, sowohl schulische (interne und externe Förderung), als auch außerschulische (Fördereinrichtungen, Förderung zu Hause). Es beschreibt okuläre Therapien (Prismenbrille, Okklusionstherapie, Rasterbrille, Irlen-Therapie) und bietet detaillierte Einblicke in das Förderkonzept nach Marianne Frostig sowie Erfahrungen mit optometrischem Visualtraining, illustriert am Beispiel des Mädchens Sarah. Der Abschnitt schließt mit Hinweisen zur Förderung der visuellen Wahrnehmung durch Eltern.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Legasthenie, visuelle Wahrnehmung, Diagnose, Fördermöglichkeiten, visuelle Wahrnehmungsdefizite, Förderdiagnostik, multiaxiale Diagnostik, neurophysiologische Prozesse, okuläre Therapien, Visualtraining, Frostig-Test, BISC, DP, PET, schulische und außerschulische Förderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Diagnose und Fördermöglichkeiten lese-rechtschreibschwacher Kinder
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Diagnose und den Fördermöglichkeiten für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS). Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Rolle von visuellen Wahrnehmungsdefiziten bei LRS. Die Arbeit richtet sich an Eltern und Lehrkräfte und bietet Hilfestellungen für die frühzeitige Diagnose und effektive Förderung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen Abriss des Begriffs LRS, Definitionen und Symptome von LRS, verschiedene diagnostische Verfahren (inklusive psychodiagnostischer Tests wie BISC, DP, PET, KTK und standardisierter Tests), die Diagnose visueller Wahrnehmungsdefizite (mit Augenmerk auf augenärztliche, orthoptische und optometrische Untersuchungen), sowie schulische und außerschulische Fördermöglichkeiten, einschließlich okulärer Therapien (Prismenbrille, Okklusionstherapie, Rasterbrille, Irlen-Therapie) und Visualtraining.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, eine Hinführung zur Thematik und dem Aufbau der Arbeit, einen Überblick über LRS, ein Kapitel zur Diagnose von LRS und ein Kapitel zu den Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, beginnend mit der Definition und den Symptomen von LRS bis hin zu konkreten Fördermethoden und Therapien.
Welche diagnostischen Verfahren werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene diagnostische Verfahren zur Erkennung von LRS und visuellen Wahrnehmungsdefiziten. Dazu gehören psychodiagnostische Verfahren wie das Bielefelder Screening (BISC), die Differenzierungsprobe (DP), der Psycholinguistische Entwicklungstest (PET) und der Körperkoordinationstest für Kinder (KTK). Außerdem werden standardisierte Testverfahren wie Intelligenztests, Rechtschreibtests und Lesetests sowie Verfahren zur Diagnose visueller Wahrnehmungsdefizite (z.B. Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (FEW), Test zur Prüfung optischer Differenzierungsleistungen (POD)) und augenärztliche, orthoptische und optometrische Untersuchungen behandelt.
Welche Fördermöglichkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS vor, sowohl schulische (interne und externe Förderung) als auch außerschulische Maßnahmen (Fördereinrichtungen, Förderung zu Hause). Ein besonderer Fokus liegt auf okulären Therapien wie Prismenbrille, Okklusionstherapie, Rasterbrille und Irlen-Therapie. Darüber hinaus werden das Förderkonzept nach Marianne Frostig, Visualtraining (mit Beispielen aus der Praxis) und die Förderung der visuellen Wahrnehmung durch Eltern beschrieben.
Welche Rolle spielt die visuelle Wahrnehmung bei LRS?
Die Arbeit betont die Bedeutung der visuellen Wahrnehmung für den Schriftspracherwerb und die Rolle visueller Wahrnehmungsdefizite bei LRS. Es werden die neurophysiologischen Prozesse des Lesens und die Auswirkungen von Defiziten in der visuellen Wahrnehmung auf das Lesen und Schreiben detailliert erklärt. Die Arbeit bietet konkrete Ansätze zur Diagnose und Förderung visueller Wahrnehmungsdefizite.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Eltern und Lehrkräfte, die sich umfassend über LRS informieren und praktische Hilfestellungen für die Diagnose und Förderung betroffener Kinder suchen. Die Informationen sind auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aufbereitet und bieten einen praxisorientierten Ansatz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Legasthenie, visuelle Wahrnehmung, Diagnose, Fördermöglichkeiten, visuelle Wahrnehmungsdefizite, Förderdiagnostik, multiaxiale Diagnostik, neurophysiologische Prozesse, okuläre Therapien, Visualtraining, Frostig-Test, BISC, DP, PET, schulische und außerschulische Förderung.
- Quote paper
- Anne Kirsten Meller (Author), 2005, Diagnose und Fördermöglichkeiten lese-rechtschreibschwacher Kinder unter besonderer Berücksichtigung visueller Wahrnehmungsdefizite, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72481