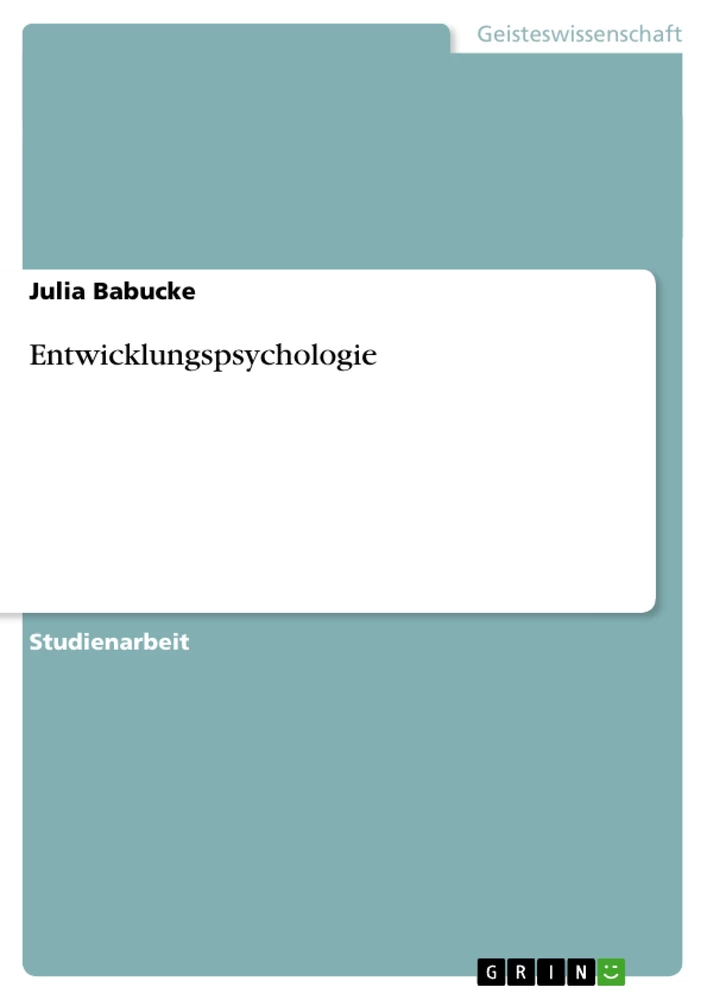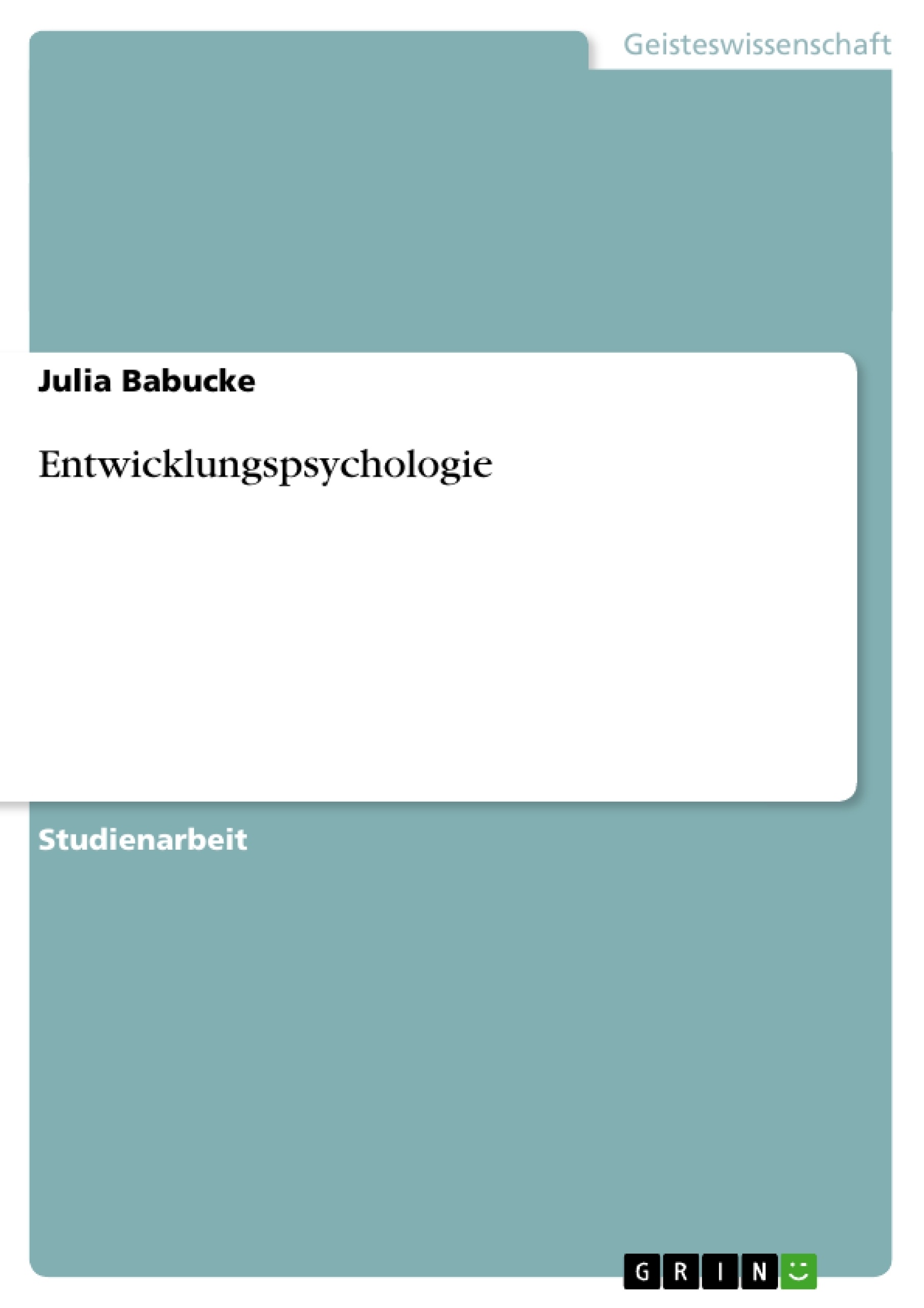Da es sich bei dem Begriff „Entwicklung“ um eine, in Phasen verlaufende, prozesshafte Veränderung der Biografie handelt, die Lernen aufgrund von endogenen und exogenen Faktoren beinhaltet, ist entwicklungspsychologisches Wissen immer dann erforderlich und sinnvoll, wenn man mit anderen Menschen, in unserem Falle Kindern und / oder Jugendlichen, zusammen arbeitet.
Mögliche Anwendungsgebiete hierfür sind beispielsweise prophylaktische bzw. präventive, diagnostische Arbeit und die Durchführung einer Beratungsfunktion.
Mit entwicklungspsychologischen Vorkenntnissen ist eine sozialpädagogische Fachkraft in der Lage, unter anderem Entwicklungsdefizite, z. B. Verzögerungen, zu erkennen, einzuordnen und diese schließlich mit Hilfe von adäquaten Angeboten oder
Projekten abzubauen. Trotzdem finden wir es wichtig, dass man den Kindern oder Jugendlichen auch die Möglichkeit gibt, Entwicklungsdefizite selbstständig und nach eigenem Zeitempfinden aufzuarbeiten. Bei „Fehl-Entwicklungen“ sollte hingegen schnell reagiert werden, um fatale Folgen für den weiteren Verlauf des psychischen Zustandes auszuschließen. Anders sieht dies bei der Arbeit mit älteren Menschen aus. In diesem Arbeitsfeld sollte man versuchen Bedingungen zu schaffen, die den individuellen
Abbauprozess verlangsamen (z. B. durch Gedächtnistraining oder selbstständiges Einrichten, aufräumen usw.).
Trotzdem sollte man darauf achten, dass der / die ältere Person nicht über- bzw. unterfordert oder vielleicht sogar vernachlässigt wird. Allerdings ist auch zu sagen, dass entwicklungspsychologisches Wissen nicht erst dann angewandt werden kann, wenn bereits Defizite oder gar Störungen vorliegen, sondern auch als präventive Maßnahme zu sehen ist. Verfügt die pädagogische Fachkraft über dieses Wissen, so sind z. B. bei einem Kind, dass den Tod eines Elternteils erleben musste, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, um mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine spätere Entwicklungsstörung, aufgrund dieses traumatischen Erlebnisses, ausschließen zu können.
Inhaltsverzeichnis
1. Entwicklungspsychologie der Lebensspanne, Anlage und Umwelt
1.1 Entwicklungspsychologisches Wissen in der Praxis
1.2 Beratungsgespräch bezüglich evtl. Schizophrenievererbung
2. Die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten – der Beitrag Jean Piagets
2.1 Kognitive Fähigkeiten bei Kindern im Alter von ~9 bis 10 Jahren
2.2 Erlebnisorientierte Stimulierung der kognitiven Entwicklung
3. Bindung und Familienentwicklungspsychologie
3.1 Gespräche mit Bezugspersonen bezüglich der FST-Ergebnisse
3.2 Erstellung eines Familien-Bildes aus entwicklungspsychologischem Blickwinkel
4. Konditionierung und Soziales Lernen
4.1 Operantes Konditionieren in der Praxis – Ein Lernexperiment
4.2 Ein Lernexperiment mit Mischlingswelpe „Merlin“
4.3 Aufrechterhaltung einer Reaktion durch operantes Konditionieren
5. Literaturverzeichnis
1. Entwicklungspsychologie der Lebensspanne, Anlage und Umwelt
1.1 Entwicklungspsychologisches Wissen in der Praxis
Da es sich bei dem Begriff „Entwicklung“ um eine, in Phasen verlaufende, prozesshafte Veränderung der Biografie handelt, die Lernen aufgrund von endogenen und exogenen Faktoren beinhaltet, ist entwicklungspsychologisches Wissen immer dann erforderlich und sinnvoll, wenn man mit anderen Menschen, in unserem Falle Kindern und / oder Jugendlichen, zusammen arbeitet.
Mögliche Anwendungsgebiete hierfür sind beispielsweise prophylaktische bzw. präventive, diagnostische Arbeit und die Durchführung einer Beratungsfunktion.
Mit entwicklungspsychologischen Vorkenntnissen ist eine sozialpädagogische Fachkraft in der Lage, unter anderem Entwicklungsdefizite, z. B. Verzögerungen,
zu erkennen, einzuordnen und diese schließlich mit Hilfe von adäquaten Angeboten oder Projekten abzubauen.
Trotzdem finden wir es wichtig, dass man den Kindern oder Jugendlichen auch die Möglichkeit gibt, Entwicklungsdefizite selbstständig und nach eigenem Zeitempfinden aufzuarbeiten.
Bei „Fehl-Entwicklungen“ sollte hingegen schnell reagiert werden, um fatale Folgen für den weiteren Verlauf des psychischen Zustandes auszuschließen.
Anders sieht dies bei der Arbeit mit älteren Menschen aus.
In diesem Arbeitsfeld sollte man versuchen Bedingungen zu schaffen, die den individuellen Abbauprozess verlangsamen (z. B. durch Gedächtnistraining oder selbstständiges Einrichten, aufräumen usw.).
Trotzdem sollte man darauf achten, dass der / die ältere Person nicht über- bzw. unterfordert oder vielleicht sogar vernachlässigt wird.
Allerdings ist auch zu sagen, dass entwicklungspsychologisches Wissen nicht erst dann angewandt werden kann, wenn bereits Defizite oder gar Störungen vorliegen, sondern auch als präventive Maßnahme zu sehen ist.
Verfügt die pädagogische Fachkraft über dieses Wissen, so sind z. B. bei einem Kind, dass den Tod eines Elternteils erleben musste, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit eine spätere Entwicklungsstörung, aufgrund dieses traumatischen Erlebnisses, ausschließen zu können.
1.2 Beratungsgespräch bezüglich evtl. Schizophrenievererbung
Wenn eine Frau mit aktuellem Kinderwunsch in unsere Beratungsstelle kommt, sich jedoch Sorgen macht, da bei zwei ihrer Familienangehörigen einmal eine Schizophrenie diagnostiziert worden ist, würden wir der Frau als erstes sagen, dass wir ihr die Entscheidung nicht abnehmen können. Es liegt nicht in unserem Ermessen, ihr zu einer Schwangerschaft zu raten oder abzuraten.
Anschließend würden wir mit der Dame allgemein über das Krankheitsbild „Schizophrenie“ reden, da es hierbei laut ICD 10 verschiedene Gruppierungen gibt, wie z. B. Paranoide Schizophrenie, Hebephrene Schizophrenie, usw.
(vgl. http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2005/fr-icd.htm)
Danach würden wir der Frau aber auch erklären, dass es bei dem derzeitigen wissenschaftlichen Forschungsstand, keine definitiven Befunde gibt, wie die Ursachen einer Persönlichkeitsstörung zu erklären sind.
Alle Aussagen, die wir machen können, sind demnach zum momentanen Zeitpunkt lediglich „Wahrscheinlichkeitstheorien“.
Dann würden wir der Frau auch mitteilen, dass bei Menschen, in deren Familie eine schizophrene Erkrankung diagnostiziert worden ist, zwar eine größere Wahrscheinlichkeit des Auftretens vorhanden ist, aber eine Schizophrenie wahrscheinlich nicht allein auf endogene, d. h. genetisch bedingte, Faktoren zurückzuführen ist.
Wenn dann scheinbar nicht nur endogene Ursachen vorliegen, sondern auch exogene Faktoren von Bedeutung sind, so würden wir der Frau dies auch mitteilen.
Wir würden ihr folglich erklären, dass auch die Umwelt ein mögliches Auftreten der Schizophrenie beeinflussen kann.
Wenn das Kind in einer friedlichen und harmonischen Umgebung aufwächst, d. h. ohne drastische Lebenseinschnitte, wäre es beinahe unmöglich, dass eine Schizophrenie auftreten würde.
Allerdings kann man solche Lebenseinschnitte natürlich nicht prognostizieren.
Aus diesem Grunde würden wir die Frau über Präventivmaßnahmen bzw. Präventionsmöglichkeiten informieren, die sie jederzeit in Anspruch nehmen kann.
Des Weiteren können wir die Frau im Verlauf unseres Gespräches darüber unterrichten,
welche Arten von Beratung und Familientherapie angeboten werden, ihr ggf. Adressen und Ansprechpartner mitgeben, um auch von unserer Seite aus Präventionsarbeit zu leisten.
2. Die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten – der Beitrag Jean Piagets
2.1 Kognitive Fähigkeiten bei Kindern im Alter von ~9 bis 10 Jahren
Laut Jean Piaget befinden sich Kinder vom 7. bis etwa 11. / 12. Lebensjahr in der 3. Phase seiner Entwicklungsstufen: die Phase der konkreten Operationen.
Voraussetzung hierfür sind die Erfahrungen aus den vorangegangenen beiden Phasen, der sensumotorischen Phase und der präoperationalen Phase.
Gleichzeitig ist die 3. auch die Basis für die letzte Phase Piagets Stufenmodells der kognitiven Entwicklung (Phase der formalen Operationen).
Grundlegend muss festgehalten werden, dass es qualitative Unterschiede im Handeln und Denken zwischen Kindern und Erwachsenen gibt.
Außerdem sind differenzierte Entwicklungstempi möglich, die sowohl durch endogene also auch exogene Faktoren beeinflusst werden.
In der Stufe der konkreten Operationen verliert die Wahrnehmung der Kinder die dominantere Rolle, d. h. Kinder besitzen nun die Fähigkeit, aufgrund ihrer bisher gewonnenen Erfahrungen, Kontexte zu entwickeln und zu erkennen und werden somit nicht mehr überwiegend Rückschlüsse durch auditive und visuelle Reize ziehen. (z. B. Mengenversuche oder Größenempfinden).
Kinder können Erfahrungen aus der Vergangenheit (Erlebnisse mit „optischen Täuschungen“ wie z. B. das kleine breite und das hohe schmale gefüllte Glas) selbstständig anwenden.
Des Weiteren hat sich auch der Zahlbegriff entwickelt, was wichtig ist, da sich die Kinder, in dieser Phase, im Grundschulalter befinden.
Sie erkennen Mengen und können diese auch ohne visuelle Objekte abzählen.
Das bedeutet, dass sie z. B. Vorstellungen haben, welchen Wert ein bestimmter Geldbetrag hat und was man damit anfangen kann.
In dieser Alterspanne können Kinder also Konstanzen selbstständig erkennen und koordinieren.
Außerdem haben sich in dieser Phase auch die Fertigkeiten im Bereich der Sprache weiter ausgedehnt. Nicht nur ein gestiegener Wortschatz, sondern auch eine kompetentere Form des Gedächtnisses kann nun vorausgesetzt werden.
Ein Beispiel hierfür wäre, dass Kinder in dem Schulfach „Rechnen“ nach dem Thema „teilen“ auch noch wissen, wie sie eine Subtraktions- oder Multiplikationsaufgabe lösen müssen.
„Das Denken besitzt bereits die Eigenschaft der Reversibilität (Umkehrbarkeit), d. h., die konkreten Operationen können gedanklich umgekehrt werden, so dass eine durchgeführte Operation wieder aufgehoben wird. Das kindliche Denken erreicht in dieser Struktur die erste Form eines stabilen Gleichgewichts.“ (zit. Stangl, 2003, http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOGNITIVEENTWICKLUNG/Piagetmodell.shtml)
Kinder mit wenig Erfahrungen, Spiel- und Lernmöglichkeiten können aus diesem Raster jedoch herausfallen und sich noch nicht auf der konkret-operatorischen Stufe befinden.
Denn nach Jean Piaget sind die Stufen mit abhängig von den jeweiligen Lebenserfahrungen des Individuums.
[...]
- Quote paper
- Julia Babucke (Author), 2005, Entwicklungspsychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72304