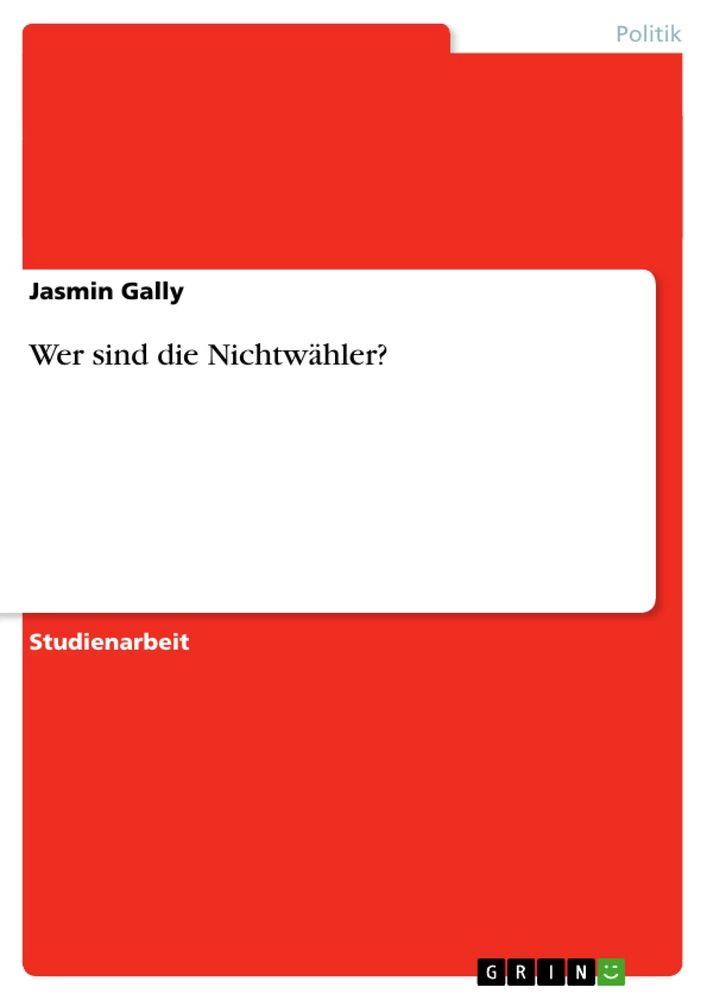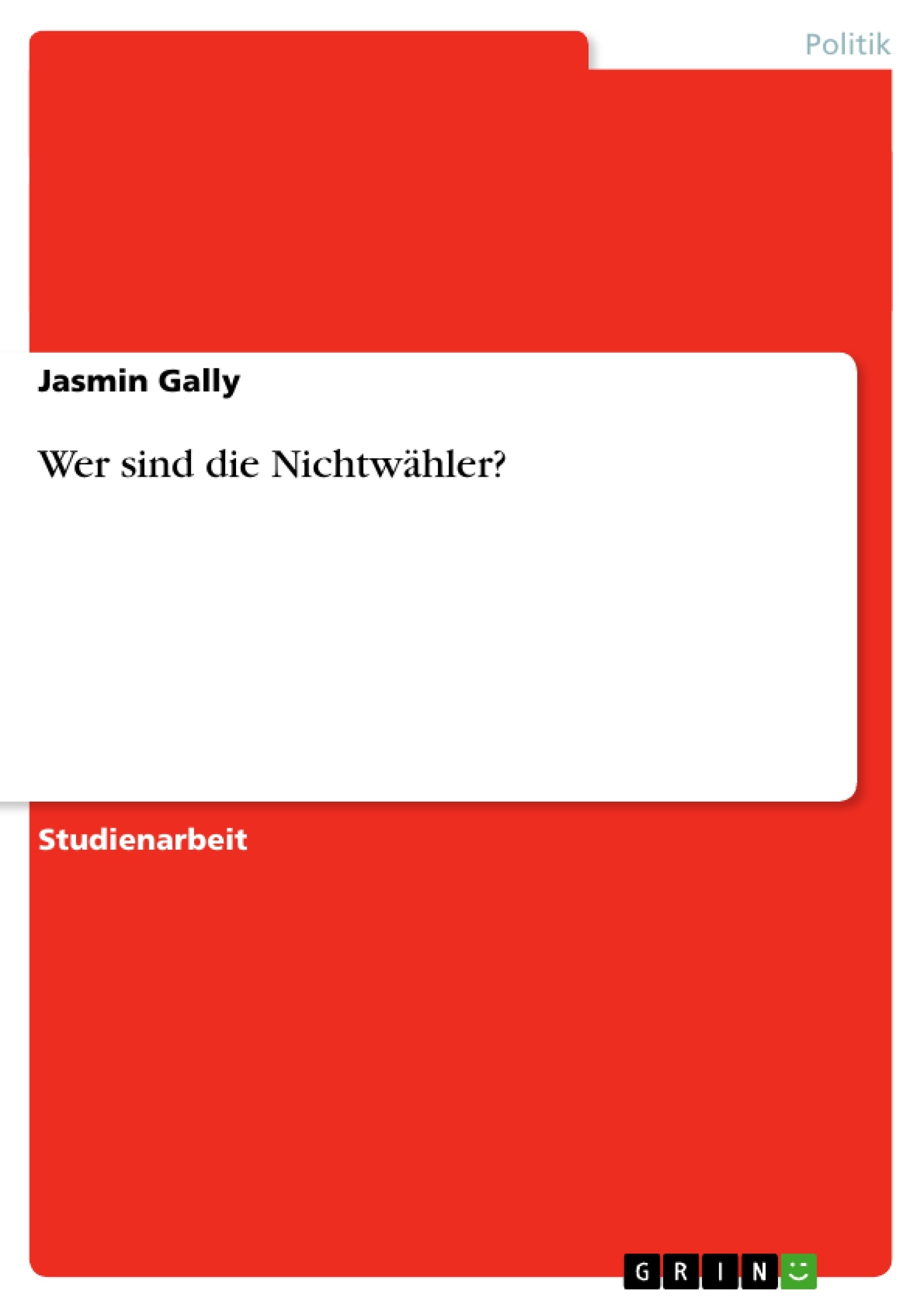Seit Anfang der 1980er Jahre sieht sich die deutsche Wahlforschung mit einem Phänomen konfrontiert, dass bis dahin für die Bundesrepublik Deutschland eigentlich als vernachlässigbar galt. Dem Phänomen sinkender Wahlbeteiligung und der immer größer werdenden Gruppe der Nichtwähler. Seit bestehen der Bundesrepublik befand sich die Wahlbeteiligung auf einem konstant hohen Niveau das als vollkommen normal angesehen wurde und in der Wahlforschung keine besondere Erwähnung fand. Zwar hielt der Begriff von der „Partei der Nichtwähler“ durch Eugen Würzburger schon 1907 Einzug in die Literatur, doch erst seit der Bundestagswahl 1980, bei der die Zahl der Nichtwähler um 2,1% dramatisch anstieg, ließ sich diese Entwicklung auch in der Forschung nicht weiter ignorieren.
In den Mittelpunkt der verschiedenen Untersuchungen rückte vor allem die Frage, wer die Nichtwähler eigentlich sind. Welche Faktoren für die Stimmenthaltung liegen vor und damit gleichzeitig auch für die Tatsache, dass sie dadurch freiwillig ein wichtiges Instrument der politischen Partizipation aus der Hand geben. Auch die Bewertung der Nichtwahl führt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen zu kontroversen Diskussionen. Bedeutet die steigende Zahl der Wahlverweigerer eine Normalisierung und die Anpassung an einen internationalen Trend und kann eine zu hohe Wahlbeteiligung sogar eine Gefahr für ein demokratisches System darstellen, oder sind die sinkende Wahlbeteiligung und deren Gründe, gar die Symptome für eine bereits bestehende Systemkrise und Ausdruck wachsender Partei- und Politikverdrossenheit und zunehmender Skepsis gegenüber traditionellen Formen der politischen Willensbildung.
Mit der folgenden Arbeit soll nun versucht werden, sich der Frage nach der Identität der Nichtwähler zu nähern und einige der vielfältigen Gründe und Einflussfaktoren zu beschreiben, welche verantwortlich für die sinkende Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland sein können. Auch einige Argumente, die im Rahmen der Diskussion über die Bedeutung der steigenden Anzahl von Nichtwählern von den jeweiligen Parteien ins Feld geführt wurden, sollen vor dem Hintergrund dieses Aufsatzes vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Typologie der Nichtwähler
- Unechte bzw. Technische Nichtwähler
- Grundsätzliche Nichtwähler
- Konjunkturelle Nichtwähler
- Einflussfaktoren für Wahlenthaltung
- Sozialstrukturelle Einflussfaktoren
- Alter
- Geschlecht
- Sozio-ökonomischer Status
- Konfession
- Sozialpsychologische Einflussfaktoren
- Erklärungsversuche für steigende Wahlenthaltung
- Wertewandel und Postmaterialismustheorie
- Realignment/Dealignment
- Individualisierung und die Entfremdung von der Politik
- Krise oder Normalisierung der deutschen Demokratie?
- Normalisierungsthese
- Krisensymptome
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Nichtwähler in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht, wer die Nichtwähler sind, welche Faktoren ihre Wahlverweigerung beeinflussen und welche Bedeutung diese Entwicklung für die deutsche Demokratie hat.
- Typologie der Nichtwähler und deren Bedeutung
- Analyse sozialstruktureller und sozialpsychologischer Einflussfaktoren auf die Wahlenthaltung
- Erklärungsansätze für die steigende Anzahl von Nichtwählern, wie Wertewandel, Dealignment und Individualisierung
- Bewertung der Nichtwahl als Ausdruck von Normalisierung oder Systemkrise
- Diskussion um die Bedeutung der Nichtwähler für das deutsche Parteiensystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Nichtwähler ein und beleuchtet die historische Entwicklung der Wahlbeteiligung in Deutschland. Sie stellt die zentrale Frage nach der Identität der Nichtwähler und den Gründen für ihre Wahlverweigerung.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Typologie der Nichtwähler. Es werden verschiedene Typen von Nichtwählern vorgestellt und unterschieden, darunter unechte, grundsätzliche und konjunkturelle Nichtwähler.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Einflussfaktoren für die Wahlenthaltung. Es werden sowohl sozialstrukturelle als auch sozialpsychologische Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozio-ökonomischer Status, Konfession und Kosten-Nutzen-Abwägungen beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Erklärungsansätzen für die steigende Wahlenthaltung. Es werden verschiedene Theorien wie Wertewandel, Realignment/Dealignment und Individualisierung diskutiert.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Frage, ob die steigende Zahl der Nichtwähler ein Zeichen für eine Normalisierung oder eine Krise der deutschen Demokratie ist.
Schlüsselwörter
Nichtwähler, Wahlbeteiligung, Parteiensystem, Wahlenthaltung, Sozialstruktur, Sozialpsychologie, Wertewandel, Dealignment, Individualisierung, Demokratie, Systemkrise, Protestwähler, Voice-Exit-Modell
- Quote paper
- Jasmin Gally (Author), 2007, Wer sind die Nichtwähler?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72280