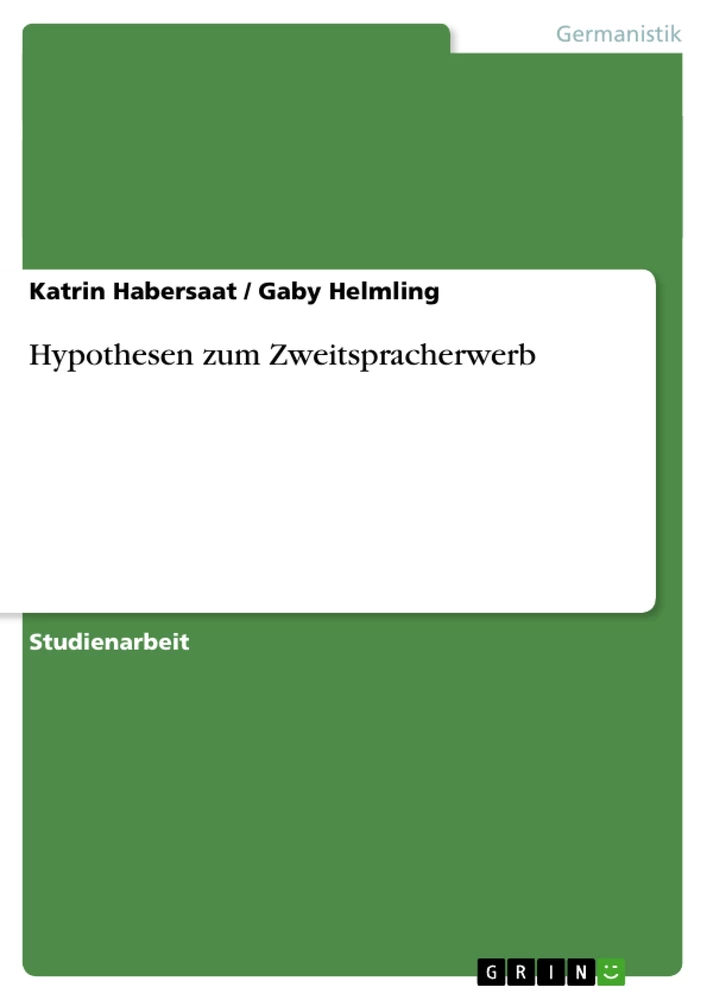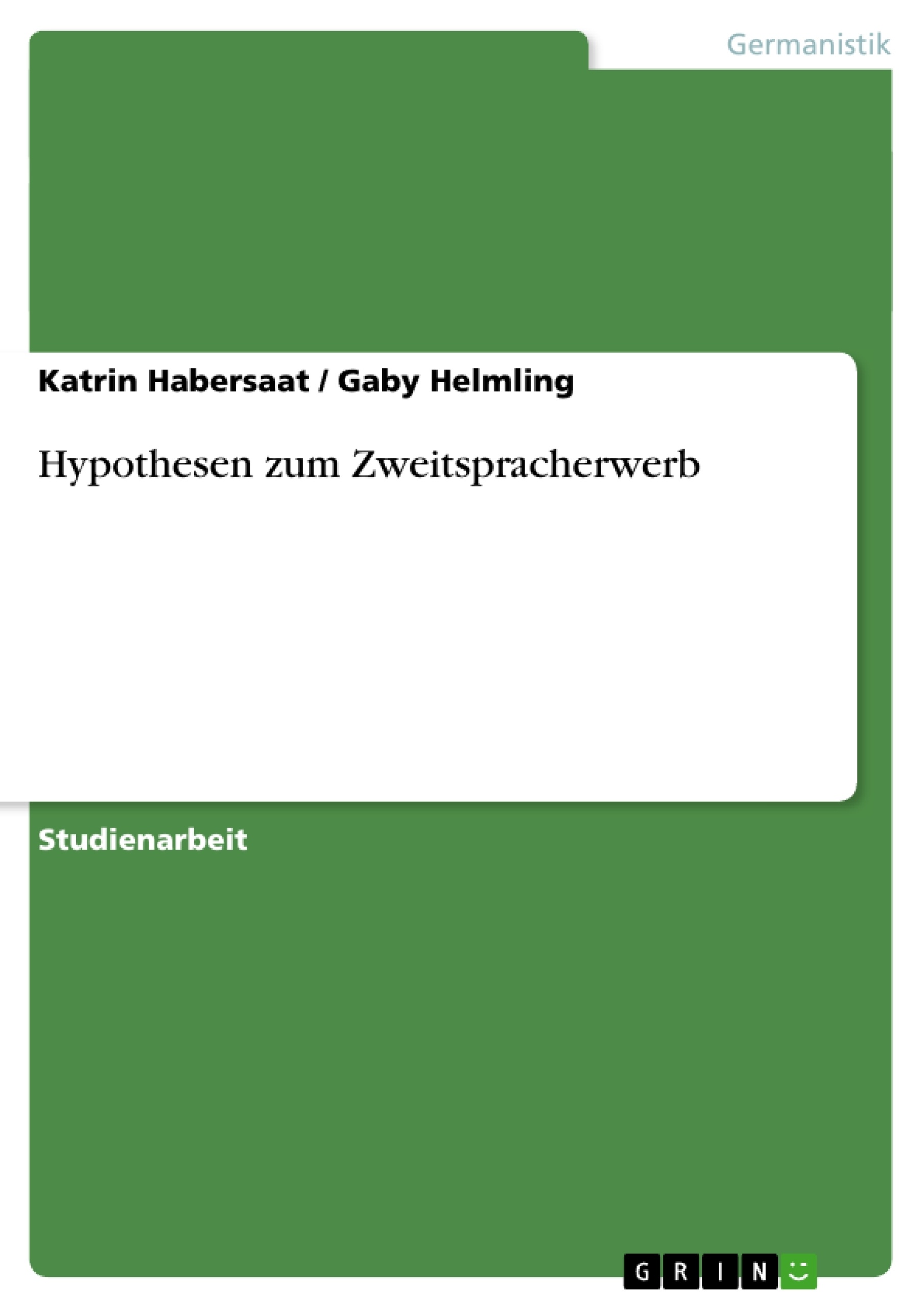Die Kontrastivhypothese ist als erste Theorie über den Zweitspracherwerb entwickelt worden. Sie wurde 1947 von Fries initiiert und 1957 von Lado fortgeführt. Die Kontrastivhypothese ist wie folgend definiert:
„Die Grundsprache des Lerners beeinflußt den Erwerb einer Zweitsprache dadurch, daß in Grund- und Zweitsprache identische Elemente und Regeln leicht und fehlerfrei zu erlernen sind. Unterschiedliche Elemente und Regeln dagegen bereiten Lernschwierigkeiten und führen zu Fehlern.“ 1
Nach dieser Definition steht nicht der Lerner im Mittelpunkt, sondern die zwei Sprachen (Grund- und Zielsprache). Kontrastiv meint in diesem Zusammenhang das Gegenüberstellen verschiedener Sprachsysteme. Durch die Gegenüberstellung der beiden Sprachsysteme kann man Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausfinden (s. Anlage 1). Um aber Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden, muß man erst einmal Kriterien aufstellen, nach denen man zwei Sprachen vergleichen kann. Sinnvoll und möglich sind eigentlich nur Vergleiche morphologischer und syntaktischer Strukturen. Vollständige Sprachvergleiche, die die formale und inhaltliche Seite zweier Sprachen erfassen, sind kaum möglich.
Es ist bis heute keine kontrastive Darstellung eines Sprachenpaares gelungen. Die Kontrastivhypothese setzt also voraus, daß man zum Erlernen einer Sprache lediglich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier Sprachen systematisieren und offenlegen muß. Durch den Sprachvergleich kann man dann auch Sprachschwierigkeiten in ihren Ursachen ergründen.
Wie schon gesagt, steht bei dieser Hypothese nicht der Sprecher (Lerner) im Mittelpunkt, sondern die beiden Sprachen. Deshalb kann man keine psycho- und soziolinguistischen Aussagen über das Sprachverhalten des Lerners mit dieser Hypothese treffen. Die Aussagekraft der Kontrastivhypothese ist auf einige formale Aspekte des Zweitspracherwerbs, wie der Erwerb syntaktischer Strukturen, beschränkt. Man kann aber sagen, daß die zu erlernende Zweitsprache von der bereits beherrschten Erstsprache in mehrfacher Weise beeinflußt wird.
Juhász nennt die Verletzung der sprachlichen Norm der Zielsprache „Interferenz“. Ist der Zweitspracherwerber in seiner Übertragung von language 1 (L1) auf language 2 (L2) erfolgreich, so spricht man von einem „positiven Transfer“. Beispiel: L1: „Sie öffnet die Tür.“ => L2: „She opens the door.“ „positiver Transfer“
[...]
Inhaltsverzeichnis
- KONTRASTIVHYPOTHESE
- IDENTITÄTSHYPOTHESE
- INTERLANGUAGE-HYPOTHESE
- MONITOR-THEORIE
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit verschiedenen Theorien zum Zweitspracherwerb. Sie analysiert die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese, die Interlanguage-Hypothese sowie die Monitor-Theorie.
- Analyse verschiedener Theorien zum Zweitspracherwerb
- Untersuchung des Einflusses der Erstsprache auf den Erwerb der Zweitsprache
- Bedeutung von Interferenz und positivem Transfer
- Kritik an den verschiedenen Theorien
- Zusammenfassung der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Kontrastivhypothese
Die Kontrastivhypothese, die erste Theorie zum Zweitspracherwerb, geht davon aus, dass die Erstsprache den Erwerb der Zweitsprache beeinflusst, indem identische Elemente und Regeln leicht zu lernen sind, während Unterschiede zu Lernschwierigkeiten führen. Die Hypothese konzentriert sich auf die Gegenüberstellung der beiden Sprachsysteme und versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufinden. Die Kritik an der Kontrastivhypothese liegt darin, dass sie den Lerner nicht in den Mittelpunkt stellt und andere Fehlerquellen außer der Interferenz ignoriert. Die Hypothese wird daher abgeschwächt und besagt nun, dass die Erstsprache sowohl positive als auch negative Einflüsse auf den Zweitspracherwerb ausübt.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Interlanguage-Hypothese, Monitor-Theorie, Erstsprache, Interferenz, positiver Transfer, Lernschwierigkeiten, Fehlerquellen, Sprachvergleich.
- Citar trabajo
- Katrin Habersaat (Autor), Gaby Helmling (Autor), 1999, Hypothesen zum Zweitspracherwerb, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72121