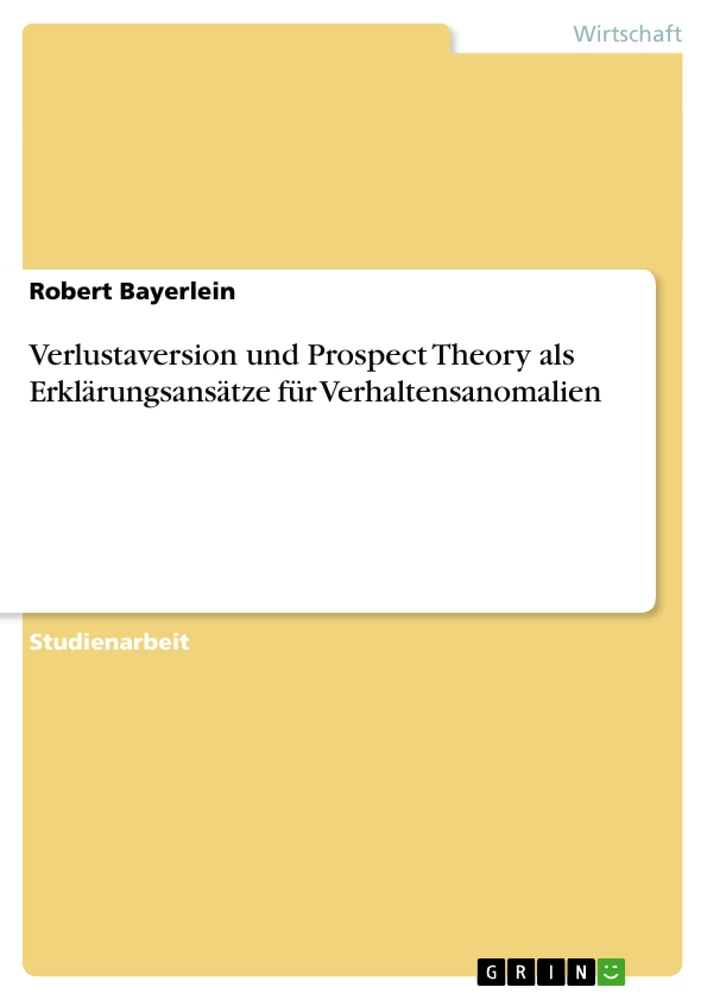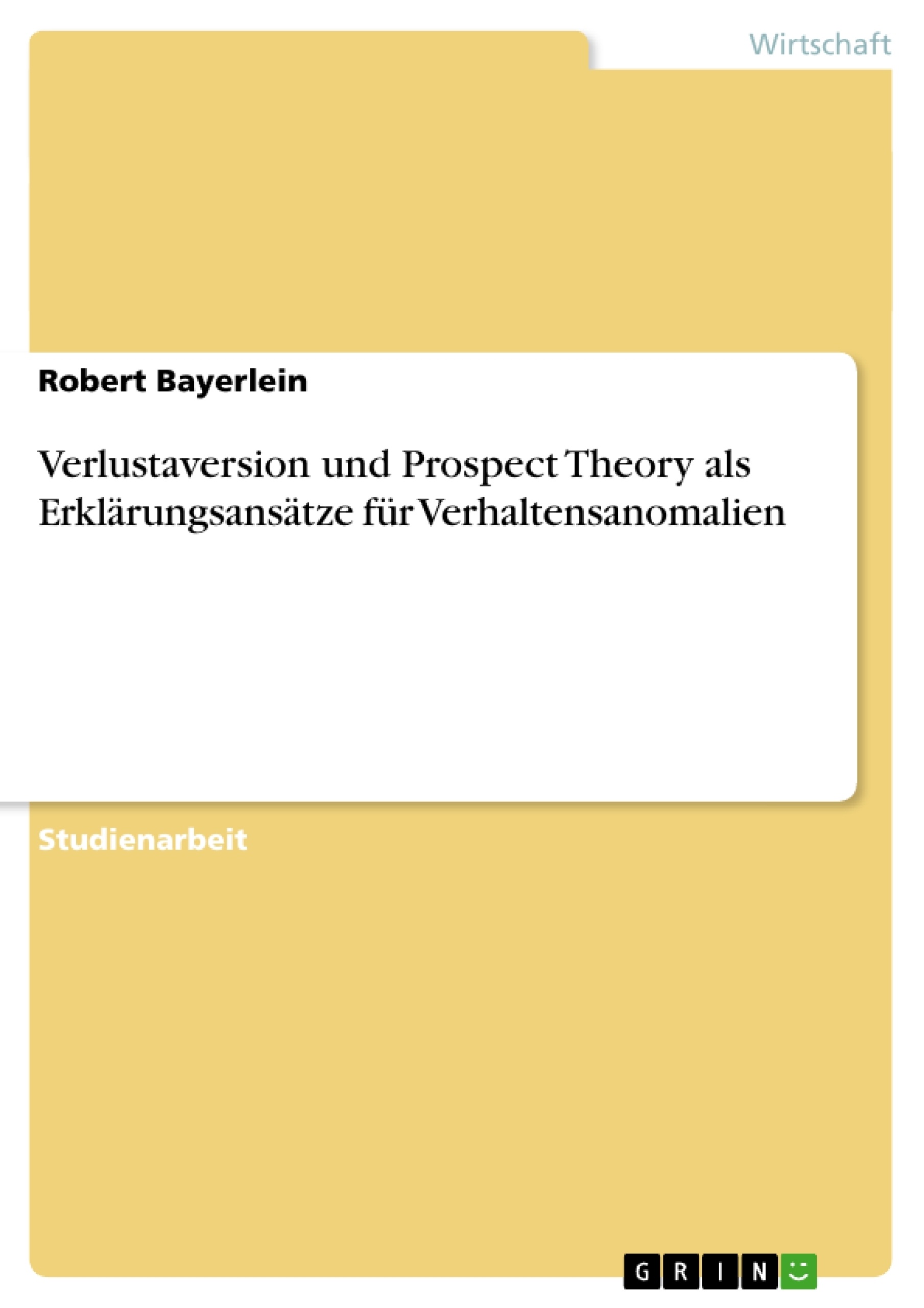Die Entscheidungstheorie verfolgt das Ziel, Menschen bei komplexen Entscheidungen zu unterstützen. Innerhalb der Entscheidungstheorie wird zwischen präskriptiver und deskriptiver Entscheidungstheorie unterschieden. Die präskriptive Entscheidungstheorie beschreibt nicht die Realität, sondern gibt Verhaltensempfehlungen für alternative Entscheidungssituationen. Ihr Gegenstand sind Aussagen zur rationalen Auswahl einer Alternative unter verschiedenen Alternativen. Eine rationale Wahl kann dann getroffen werden, wenn das Rationalprinzip angewendet wird. Nach dem Rationalprinzip sollte ein rational handelnder Mensch seine Ressourcen so verwenden, dass sein Nutzen maximiert wird. Die Erwartungsnutzentheorie, deren axiomatische Fundierung auf einen Ansatz von Neumann und Morgenstern zurückgeht, gehört zu den wichtigsten Grundlagen der präskriptiven Entscheidungstheorie. Das Ziel der deskriptiven Entscheidungstheorie besteht dagegen darin, das tatsächlich beobachtbare menschliche Verhalten in Entscheidungsprozessen zu beschreiben. Hierzu werden Hypothesen über das Verhalten von Individuen formuliert, mit deren Hilfe bei Kenntnis der jeweiligen Ausgangsposition Entscheidungen prognostiziert werden können . Das tatsächliche Verhalten von Entscheidungsträgern in Entscheidungsprozessen widerspricht zum Teil dem in der präskriptiven Theorie vorausgesetzten rationalen Verhalten. In letzter Zeit ist die Erwartungsnutzentheorie durch eine Vielzahl von empirisch-experimentellen Befunden zu sogenannten Verhaltens- und Entscheidungsanomalien unter Druck geraten. Nach Klose sind Entscheidungsanomalien "empirisch beobachtbare (systematische) Abweichungen individuellen Urteils- und Entscheidungsverhaltens von Standardannahmen entscheidungslogischer Entwürfe und ökonomischer Modelle" . Insbesondere die Verletzung des Unabhängigkeitsaxioms durch das Allais- und das Ellsberg-Paradoxon führte zu einer Suche nach sog. alternativen Erwartungsnutzentheorien. Als Reaktion auf diese Befunde sind in jüngster Zeit einige Alternativen zur Erwartungsnutzentheorie entstanden. Eines der bedeutsamsten und am häufigsten diskutierten Modelle ist die Prospect Theorie von Kahneman/Tversky (1979).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Entscheidungs- und Verhaltensanomalien
- 1. Verlustaversion
- 2. Referenzpunkt-Effekt
- 3. Endowment-Effekt
- 4. Status Quo Bias
- 5. Anchoring
- 6. Abnehmende Sensitivität (Diminishing Sensitivity)
- 7. Overconfidence
- III. Prospect Theorie
- 1. Klassische Prospect Theorie
- 1.1. Editierphase
- 1.2. Nutzenfunktion
- 1.3. Wertfunktion
- 1.4. Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion
- 1.5. Kritik der klassischen Prospect Theorie
- 2. Cumulative Prospect Theorie
- 3. Anwendungsgebiete der Prospect Theorie
- 1. Klassische Prospect Theorie
- IV. Fazit
- V. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verlustaversion und die Prospect Theorie als Erklärungsansätze für Verhaltensanomalien im ökonomischen Entscheidungsfindungsprozess. Sie analysiert, wie diese Konzepte Abweichungen vom rationalen Entscheidungsverhalten erklären können.
- Verlustaversion und ihre Auswirkungen auf Entscheidungen
- Die Prospect Theorie als alternatives Modell zur Erwartungsnutzentheorie
- Empirische Befunde und Experimente zur Veranschaulichung der Verhaltensanomalien
- Anwendung der Prospect Theorie in verschiedenen Bereichen
- Kritikpunkte und Weiterentwicklungen der Prospect Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Einführung differenziert zwischen präskriptiver und deskriptiver Entscheidungstheorie. Während erstere rationale Entscheidungsfindung beschreibt und Empfehlungen gibt, konzentriert sich letztere auf die Beschreibung des tatsächlichen, oft irrationalen, menschlichen Entscheidungsverhaltens. Die Arbeit hebt die Erwartungsnutzentheorie als Grundlage der präskriptiven Theorie hervor und zeigt, wie empirische Befunde zu Entscheidungsanomalien – systematische Abweichungen vom rationalen Verhalten – diese Theorie in Frage stellen. Die Prospect Theorie wird als bedeutende Alternative vorgestellt, die auf diese Anomalien reagiert.
II. Entscheidungs- und Verhaltensanomalien: Dieses Kapitel fokussiert auf Verhaltensanomalien, die für die Prospect Theorie relevant sind. Es wird die Verlustaversion als zentrale Anomalie ausführlich beschrieben, die besagt, dass Menschen Verluste stärker gewichten als Gewinne gleicher Höhe. Ein Experiment von Kahneman, Knetsch und Thaler veranschaulicht diesen Effekt mit dem Vergleich der Bereitschaft, eine Tasse zu verkaufen versus zu kaufen. Das Kapitel erwähnt weitere Anomalien wie den Referenzpunkt-Effekt, den Endowment-Effekt, den Status Quo Bias, Anchoring, abnehmende Sensitivität und Overconfidence, ohne jedoch auf Details einzugehen.
Schlüsselwörter
Verlustaversion, Prospect Theorie, Entscheidungsanomalien, Erwartungsnutzentheorie, Verhaltensökonomie, Referenzpunkt, Endowment-Effekt, Rationalität, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Entscheidungs- und Verhaltensanomalien im Lichte der Prospect Theorie"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Prospect Theorie und Entscheidungsanomalien. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Verlustaversion und der Prospect Theorie als Erklärung für abweichendes Entscheidungsverhalten vom rationalen Modell der Erwartungsnutzentheorie.
Welche Entscheidungsanomalien werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Entscheidungsanomalien, die vom rationalen Entscheidungsmodell abweichen. Im Detail wird die Verlustaversion erklärt, zusätzlich werden der Referenzpunkt-Effekt, der Endowment-Effekt, der Status Quo Bias, Anchoring, abnehmende Sensitivität und Overconfidence erwähnt.
Was ist die Prospect Theorie?
Die Prospect Theorie wird als alternatives Modell zur Erwartungsnutzentheorie vorgestellt. Sie erklärt, warum Menschen in ihren Entscheidungen oft von rationalem Verhalten abweichen. Das Dokument beschreibt die klassische Prospect Theorie mit ihren Bestandteilen (Editierphase, Nutzenfunktion, Wertfunktion, Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion) und deren Kritikpunkte, sowie die kumulative Prospect Theorie und deren Anwendungsgebiete.
Wie wird die Verlustaversion erklärt?
Die Verlustaversion besagt, dass Menschen Verluste stärker gewichten als gleich hohe Gewinne. Das Dokument veranschaulicht diesen Effekt anhand eines Experiments von Kahneman, Knetsch und Thaler zum Vergleich von Kauf- und Verkaufsbereitschaft einer Tasse.
Was ist der Unterschied zwischen präskriptiver und deskriptiver Entscheidungstheorie?
Die präskriptive Entscheidungstheorie beschreibt rationale Entscheidungsfindung und gibt Empfehlungen, während die deskriptive Entscheidungstheorie das tatsächliche, oft irrationale Entscheidungsverhalten beschreibt. Die Prospect Theorie gehört zur deskriptiven Entscheidungstheorie.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung, Entscheidungs- und Verhaltensanomalien, Prospect Theorie (inkl. klassischer und kumulativer Prospect Theorie und Anwendungsgebiete), Fazit und Quellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Verlustaversion, Prospect Theorie, Entscheidungsanomalien, Erwartungsnutzentheorie, Verhaltensökonomie, Referenzpunkt, Endowment-Effekt, Rationalität, empirische Forschung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Dokument enthält eine Quellenangabe (Kapitel V), die weiterführende Informationen bietet.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm. Robert Bayerlein (Author), 2002, Verlustaversion und Prospect Theory als Erklärungsansätze für Verhaltensanomalien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7211