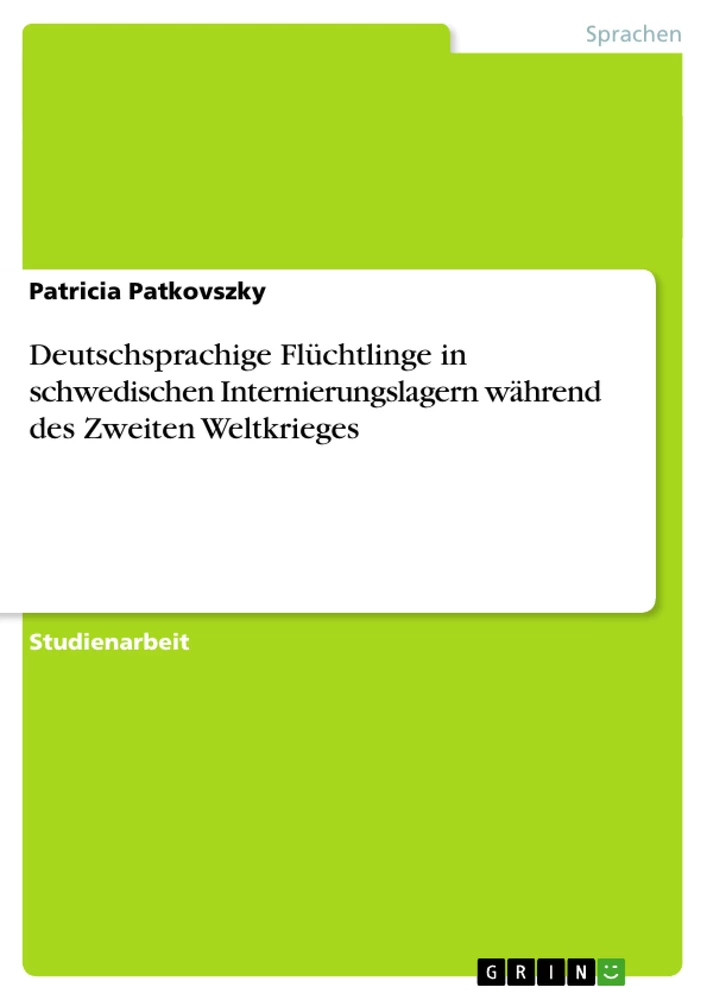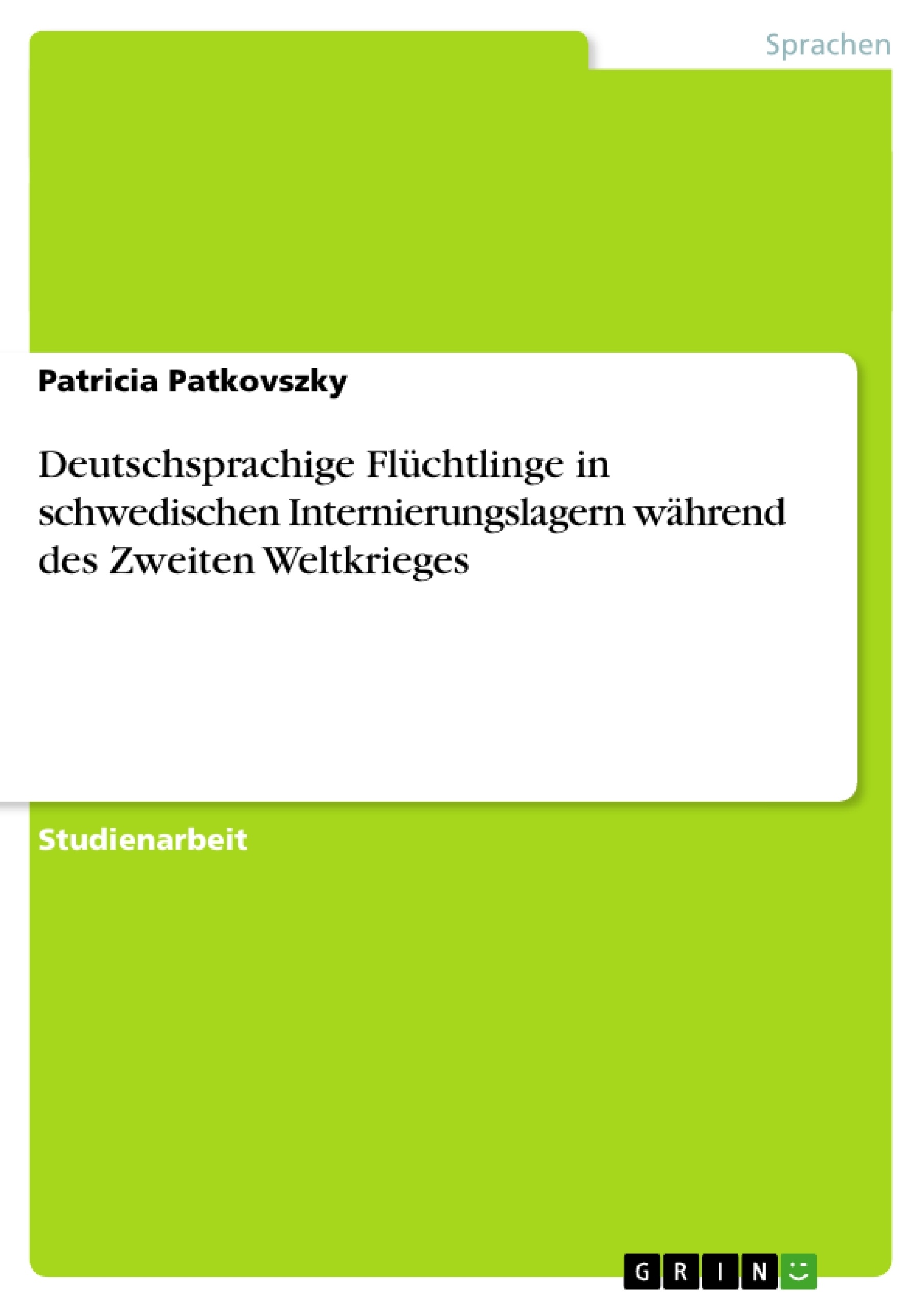Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 begannen in Deutschland systematisch Übergriffe auf politisch Andersdenkende und die jüdische Bevölkerung. Auch die politischen Gegner des NS-Regimes wurden verfolgt und verhaftet, die illegale politische Arbeit immer schwieriger. Vielen blieb als einziger Ausweg nur noch die Flucht. Insgesamt sahen sich nach 1933 etwa 500.000 Menschen dazu gezwungen, Deutschland, Österreich und das Sudetenland zu verlassen, etwa zehn Prozent von ihnen waren politische Flüchtlinge, während die übrigen 90 Prozent von der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung betroffen waren.
Nach Ausbruch des Krieges erwies sich das neutrale Schweden neben der Schweiz und Großbritannien als eines der letzten Länder, in denen Exilanten Zuflucht finden konnten.
Dabei wurde diese Zufluchtsstätte oftmals zu einem weiteren Ort der Auseinandersetzung mit dem Schicksal als Flüchtling, denn die Devise der protektionistischen Fremdenpolitik Schwedens hieß: 'Schweden den Schweden'. Hierbei galt es nicht nur den gespannten Arbeitsmarkt, sondern auch die 'schwedische Rasse' vor einer drohenden Überfremdung zu schützen. Vor allem Juden und Kommunisten aus Osteuropa und Deutschland wurden dabei als Bedrohung angesehen.
Eine Verfügung vom 16. Februar 1940 ermöglichte schließlich die Einrichtung von Lagern, in denen ab März 1940 nicht nur Kommunisten sondern auch andere 'unbequeme' Flüchtlinge interniert wurden. Paradoxerweise galt der Vorwand der Schutzhaft: sowohl die schwedische Bevölkerung sollte vor den Inhaftierten - mehr noch - die Inhaftierten vor dem Zugriff der deutschen Behörden geschützt werden.
Mit der Situation deutscher Internierter in schwedischen Internierungslagern soll sich diese Arbeit beschäftigen. Dabei werde ich zuerst die schwedische Fremdenpolitik 1938 -1945, sowie die Aufnahme der Flüchtlinge im Land, von der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bis zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt bzw. der Einweisung in Lager, kurz beleuchten. Danach werde ich mich den Internierungslagern zuwenden.
Mein Augenmerk möchte ich dabei auf folgende Fragen richten: Welche Motivationen führte die Regierung zur Einrichtung solcher Lager? Wie sahen die Lebensbedingungen für Internierte in diesen Lagern aus? Welche Möglichkeiten hatten die Inhaftierten gegen ihre Lage zu protestieren? Wie reagierte die schwedische Öffentlichkeit auf diese Lager?
Die Beantwortung dieser Fragen wird wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die schwedische Fremdenpolitik 1938-1945
- Die Aufnahme der Flüchtlinge in Schweden.
- Internierungs- und Disziplinierungslager in Schweden
- Die Lagerordnung am Beispiel Langmorå und Smedsbo
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Situation deutscher Internierter in schwedischen Internierungslagern während des Zweiten Weltkriegs. Sie beleuchtet die schwedische Fremdenpolitik von 1938 bis 1945 und die Aufnahme deutscher Flüchtlinge in Schweden, von der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bis zur Einweisung in Lager. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Internierungslager und die Beantwortung folgender Fragen: Welche Gründe führten zur Einrichtung dieser Lager? Wie sahen die Lebensbedingungen für die Internierten aus? Welche Möglichkeiten hatten sie, gegen ihre Lage zu protestieren? Wie reagierte die schwedische Öffentlichkeit auf diese Lager?
- Die schwedische Fremdenpolitik und ihre Auswirkungen auf die Aufnahme deutscher Flüchtlinge
- Die Gründe für die Einrichtung von Internierungslagern in Schweden
- Die Lebensbedingungen in den Internierungslagern und die Behandlung der Inhaftierten
- Die Möglichkeiten für die Internierten, gegen ihre Lage zu protestieren
- Die öffentliche Reaktion auf die Internierungslager in Schweden
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die schwedische Fremdenpolitik von 1938 bis 1945 und skizziert die Herausforderungen und die Reaktionen Schwedens auf die wachsende Flüchtlingswelle aus Deutschland. Es werden die politischen und gesellschaftlichen Faktoren beleuchtet, die die Aufnahmepolitik des Landes beeinflussten.
Im zweiten Kapitel werden die Internierungslager in Schweden im Detail untersucht. Die Arbeit analysiert die Motivationen der schwedischen Regierung für die Einrichtung dieser Lager, die Lagerordnung am Beispiel Langmorå und Smedsbo, die Lebensbedingungen der Inhaftierten sowie die Möglichkeiten für Widerstand und Proteste.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die schwedische Fremdenpolitik im Zweiten Weltkrieg, die Internierung deutscher Flüchtlinge, die Lebensbedingungen in Internierungslagern, die Diskriminierung von Flüchtlingen und die öffentliche Meinung in Schweden gegenüber der Internierung.
- Quote paper
- Patricia Patkovszky (Author), 2006, Deutschsprachige Flüchtlinge in schwedischen Internierungslagern während des Zweiten Weltkrieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72096