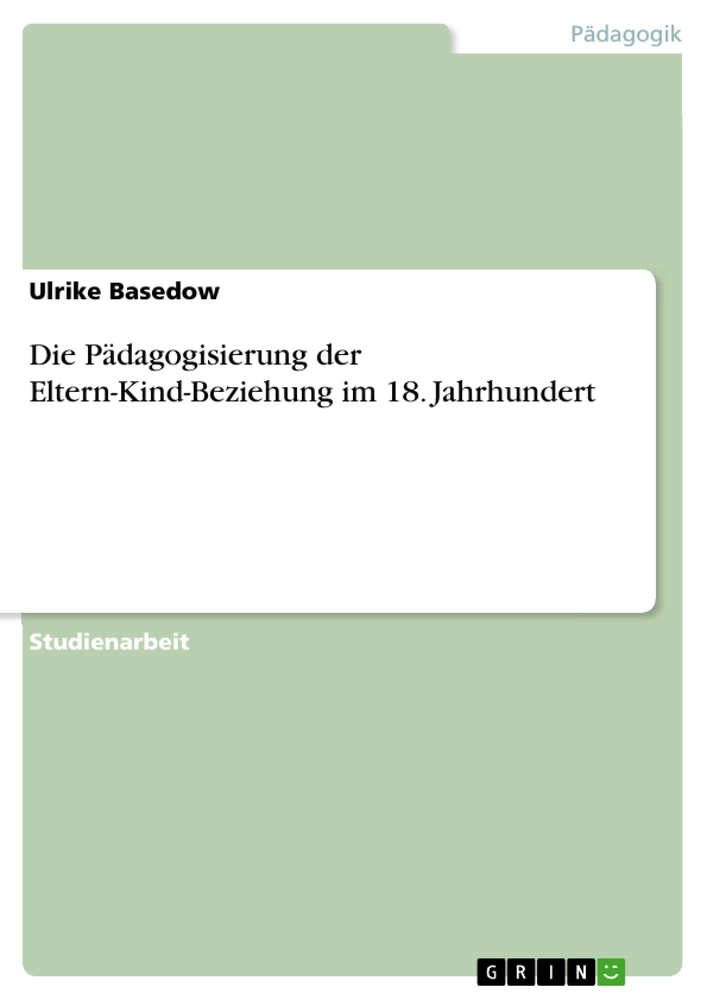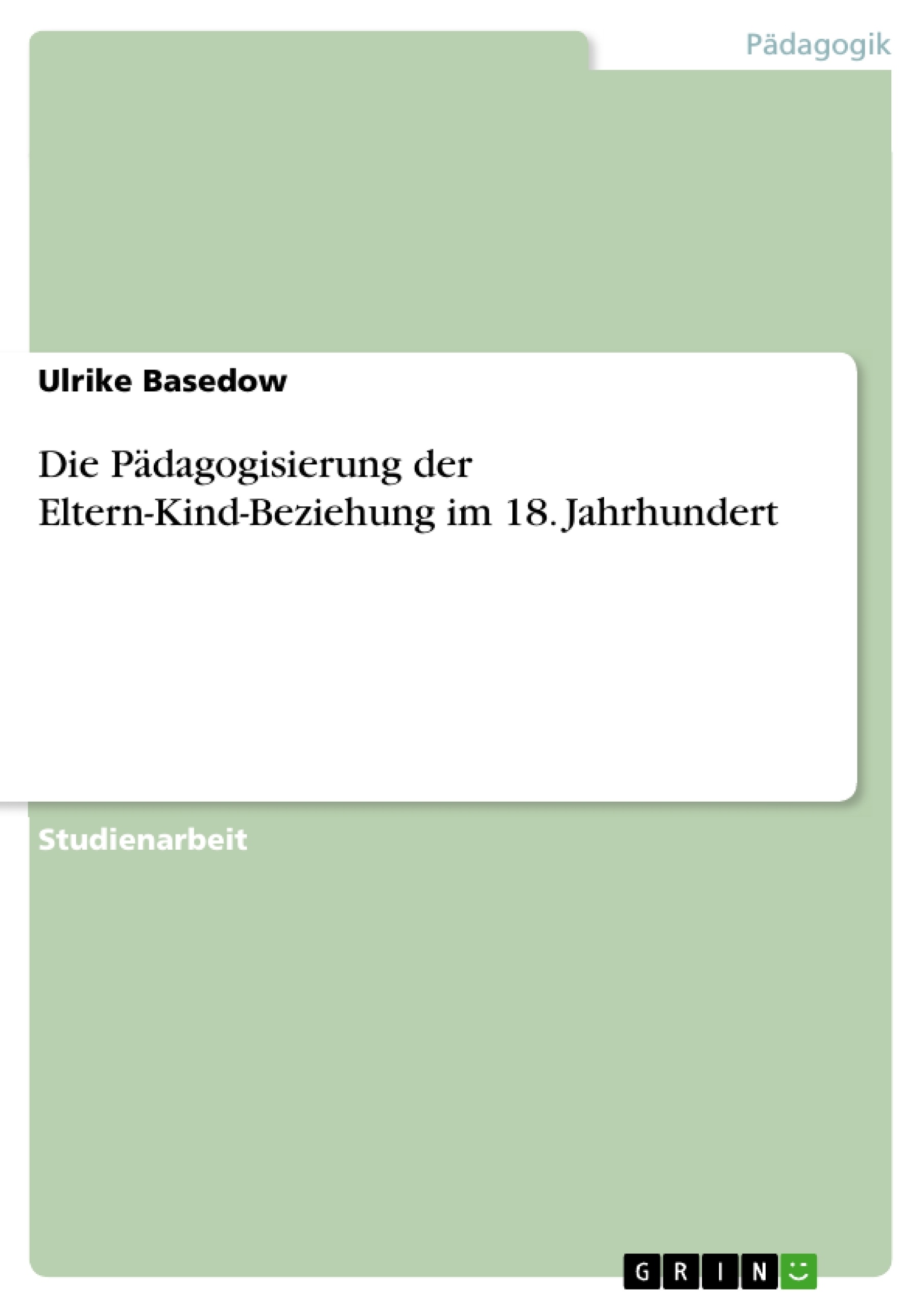Diese Ausarbeitung bezieht sich auf das gehaltene Referat im Kontext des Seminars mit dem Thema der Epoche der Aufklärung, d.h. das 18. Jahrhundert. Diese Epoche wird auch als das „Pädagogische Zeitalter“ betitelt, was den Wandel der Werte und Normen im gesamten Leben der damaligen Menschen beinhaltet. In dem Seminar wurden die Philanthropen und ihre Ideen vorgestellt, sowie auch das Bildungswesen der verschiedenen Klassen und auch Altersgruppen. Dieser Text beleuchtet nun insbesondere die Familie, und die Stellung des Kindes und der Frau. Zunächst wird erläutert, wie sich die Situation vor dem Wandel gestaltet hat, und was die Forderungen der Aufklärer waren, um sich dem Zeitgeist anzupassen. Der nächste Abschnitt befasst sich mit dem Wandel der Mutter – Kind – Beziehung, wobei die Erweiterung der mütterlichen Verantwortung und die Mittel zur Erziehung zur Mütterlichkeit gesondert beschrieben werden. Anschließend werden auch die negativen Seiten der, durch die Aufklärung entstandenen, neuen Werte und Ideale beleuchtet und abschließend gefragt, ob Mutterliebe wirklich ein Instinkt ist, oder man es nicht als gesellschaftliches Phänomen betrachten kann, oder sogar muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Eltern – Kind – Beziehung zu Beginn des 18. Jahrhundert
- 2. Die Forderungen der Aufklärer
- 3. Der Wandel der Mutter – Kind – Beziehung
- 3. (1) Die Erweiterung der mütterlichen Verantwortung
- 3. (2) Mittel zur Erziehung zur Mütterlichkeit
- 4. Die negativen Seiten der „neuen Mutter“
- 4. (1) Die Infragestellung der Mutterliebe durch Elisabeth Badinter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht den Wandel der Eltern-Kind-Beziehung, insbesondere der Mutter-Kind-Beziehung, im 18. Jahrhundert im Kontext der Aufklärung. Sie analysiert die Situation vor dem Einfluss der Aufklärungsphilosophie und die Forderungen der Aufklärer zur Veränderung. Im Mittelpunkt stehen die Veränderungen der mütterlichen Rolle und die damit verbundenen Herausforderungen und Kritikpunkte.
- Die Eltern-Kind-Beziehung zu Beginn des 18. Jahrhunderts
- Die Forderungen der Aufklärer nach pädagogischer Reform
- Der Wandel der Mutterrolle und die Erweiterung der mütterlichen Verantwortung
- Methoden der Erziehung zur Mütterlichkeit
- Kritik an den neuen Idealen der Mutter-Kind-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Eltern – Kind – Beziehung zu Beginn des 18. Jahrhundert: Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die Eltern-Kind-Beziehung geprägt von hoher Kinder- und Säuglingssterblichkeit. Kinder wurden oft als Belastung empfunden, und die Mutterliebe, wie wir sie heute kennen, spielte kaum eine Rolle. Repressive Erziehungspraktiken waren weit verbreitet, und Kinder wurden oft Ammen oder anderen Personen anvertraut. Die hohen Sterberaten hingen mit mangelnder Fürsorge und fehlgeleiteten Erziehungspraktiken zusammen, die trotz teilweise vorhandenem Wissen über bessere Methoden ignoriert wurden. Religiöse Ideale, die die Fürsorge für Kinder forderten, standen im Gegensatz zur Armut und den damit verbundenen Überlebenskämpfen vieler Familien, was zu verhüllten Formen von Kindermord führte.
2. Die Forderungen der Aufklärer: Dieser Abschnitt würde die Forderungen der Aufklärer bezüglich der Erziehung und der Rolle der Eltern im 18. Jahrhundert beschreiben. Es würde sich um eine detaillierte Analyse der pädagogischen Ideen der Aufklärung und deren Auswirkungen auf die Familie handeln. Die Zusammenfassung würde die wichtigsten Argumente und Vorschläge der Aufklärer erläutern, wie diese die Veränderungen in der Mutter-Kind-Beziehung beeinflussten und welche neuen Ideale sie propagierten.
3. Der Wandel der Mutter – Kind – Beziehung: Dieses Kapitel analysiert die Transformation der Mutter-Kind-Beziehung im Zuge der Aufklärung. Es beschreibt die Erweiterung der mütterlichen Verantwortung, die nun über die bloße körperliche Versorgung hinausging und pädagogische Aspekte umfasste. Die Zusammenfassung erläutert die neuen Methoden der Erziehung zur Mütterlichkeit und die damit verbundenen Erwartungen an die Mutter. Sie würde die vielschichtigen Aspekte des Wandels beleuchten und die unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen dieser neuen Rolle darstellen.
4. Die negativen Seiten der „neuen Mutter“: Dieser Abschnitt befasst sich kritisch mit den Schattenseiten der durch die Aufklärung beeinflussten Veränderungen der Mutterrolle. Er würde die Infragestellung der Mutterliebe durch Denkerinnen wie Elisabeth Badinter thematisieren und die damit verbundenen gesellschaftlichen und individuellen Konflikte analysieren. Die Zusammenfassung würde die ambivalenten Auswirkungen der neuen Ideale auf die Frauen und ihre Lebensrealität erörtern und die Grenzen und Widersprüche der aufklärerischen pädagogischen Vorstellungen beleuchten.
Schlüsselwörter
Aufklärung, Pädagogik, Eltern-Kind-Beziehung, Mutter-Kind-Beziehung, Mutterrolle, Kindersterblichkeit, Erziehung, Mutterliebe, Aufklärer, Repressive Erziehung, Soziale Geschichte der Kindheit.
Häufig gestellte Fragen: Wandel der Eltern-Kind-Beziehung im 18. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Eltern-Kind-Beziehung, insbesondere der Mutter-Kind-Beziehung, im 18. Jahrhundert im Kontext der Aufklärung. Sie analysiert die Situation vor dem Einfluss der Aufklärungsphilosophie und die Forderungen der Aufklärer zur Veränderung. Im Mittelpunkt stehen die Veränderungen der mütterlichen Rolle und die damit verbundenen Herausforderungen und Kritikpunkte.
Welche Epochen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Eltern-Kind-Beziehung zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit der sich im Laufe des Jahrhunderts verändernden Beziehung im Kontext der Aufklärungsphilosophie.
Wie war die Eltern-Kind-Beziehung zu Beginn des 18. Jahrhunderts charakterisiert?
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die Eltern-Kind-Beziehung von hoher Kinder- und Säuglingssterblichkeit geprägt. Kinder wurden oft als Belastung empfunden, und die Mutterliebe, wie wir sie heute kennen, spielte kaum eine Rolle. Repressive Erziehungspraktiken waren weit verbreitet, und Kinder wurden oft Ammen oder anderen Personen anvertraut. Hohe Sterberaten hingen mit mangelnder Fürsorge und fehlgeleiteten Erziehungspraktiken zusammen, die trotz teilweise vorhandenem Wissen über bessere Methoden ignoriert wurden. Religiöse Ideale, die die Fürsorge für Kinder forderten, standen im Gegensatz zur Armut und den damit verbundenen Überlebenskämpfen vieler Familien, was zu verhüllten Formen von Kindermord führte.
Welche Forderungen stellten die Aufklärer auf?
Dieser Abschnitt der Arbeit beschreibt detailliert die Forderungen der Aufklärer bezüglich der Erziehung und der Rolle der Eltern im 18. Jahrhundert. Es handelt sich um eine Analyse der pädagogischen Ideen der Aufklärung und deren Auswirkungen auf die Familie. Die wichtigsten Argumente und Vorschläge der Aufklärer werden erläutert, wie diese die Veränderungen in der Mutter-Kind-Beziehung beeinflussten und welche neuen Ideale sie propagierten.
Wie veränderte sich die Mutter-Kind-Beziehung im 18. Jahrhundert?
Dieses Kapitel analysiert die Transformation der Mutter-Kind-Beziehung im Zuge der Aufklärung. Es beschreibt die Erweiterung der mütterlichen Verantwortung, die nun über die bloße körperliche Versorgung hinausging und pädagogische Aspekte umfasste. Die Arbeit erläutert die neuen Methoden der Erziehung zur Mütterlichkeit und die damit verbundenen Erwartungen an die Mutter. Sie beleuchtet die vielschichtigen Aspekte des Wandels und die unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen dieser neuen Rolle.
Gab es Kritik an den neuen Idealen der Mutter-Kind-Beziehung?
Ja, dieser Abschnitt befasst sich kritisch mit den Schattenseiten der durch die Aufklärung beeinflussten Veränderungen der Mutterrolle. Er thematisiert die Infragestellung der Mutterliebe durch Denkerinnen wie Elisabeth Badinter und analysiert die damit verbundenen gesellschaftlichen und individuellen Konflikte. Die ambivalenten Auswirkungen der neuen Ideale auf die Frauen und ihre Lebensrealität werden erörtert, ebenso die Grenzen und Widersprüche der aufklärerischen pädagogischen Vorstellungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Aufklärung, Pädagogik, Eltern-Kind-Beziehung, Mutter-Kind-Beziehung, Mutterrolle, Kindersterblichkeit, Erziehung, Mutterliebe, Aufklärer, Repressive Erziehung, Soziale Geschichte der Kindheit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Die Eltern – Kind – Beziehung zu Beginn des 18. Jahrhunderts; 2. Die Forderungen der Aufklärer; 3. Der Wandel der Mutter – Kind – Beziehung; 4. Die negativen Seiten der „neuen Mutter“.
- Quote paper
- Ulrike Basedow (Author), 2005, Die Pädagogisierung der Eltern-Kind-Beziehung im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72022