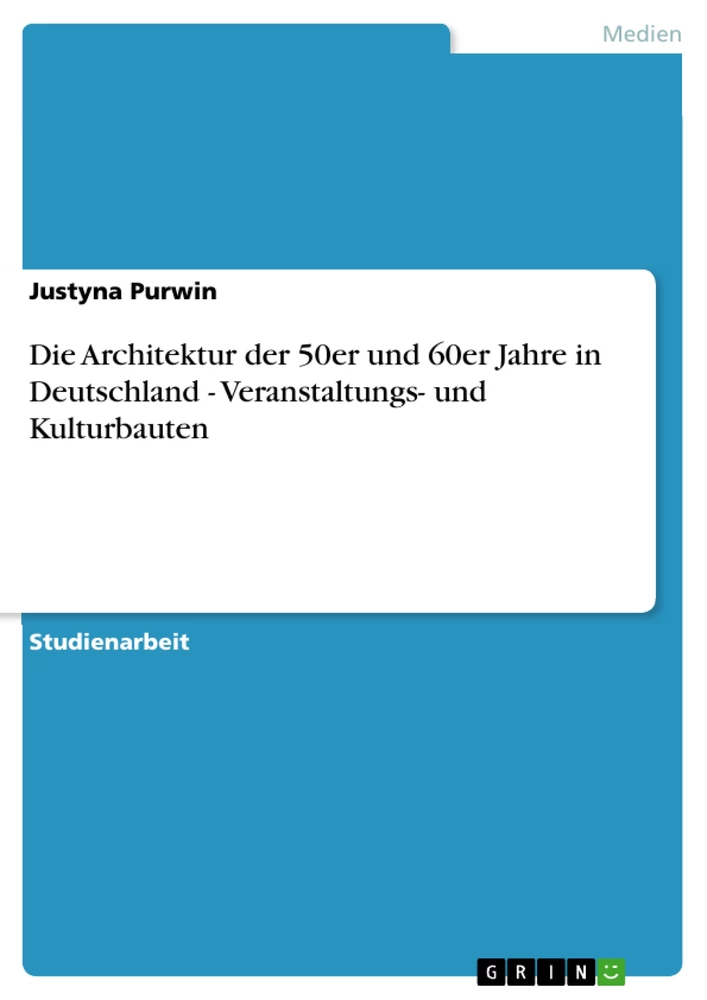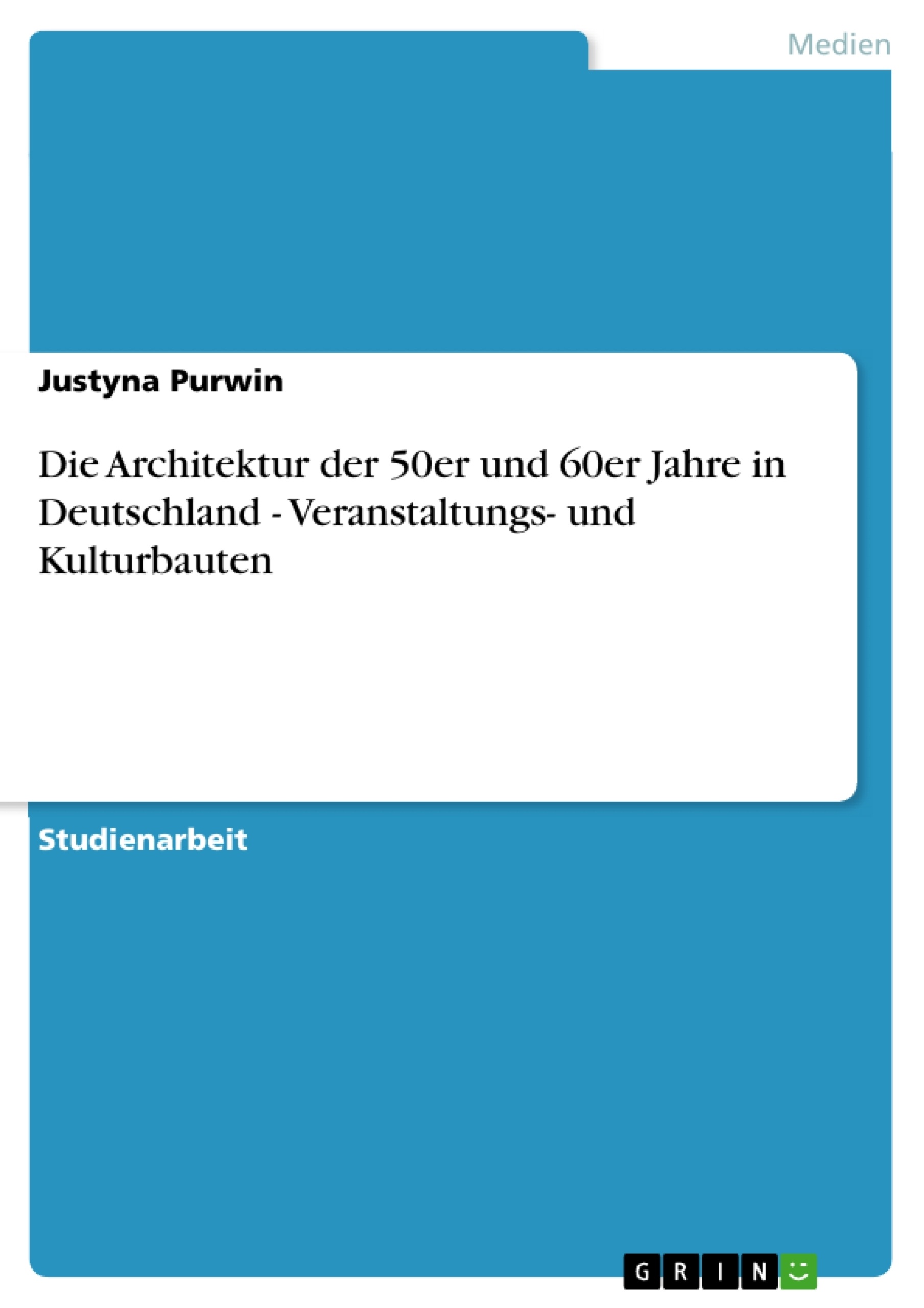Die vorliegende Arbeit ist die Ausarbeitung des Referats zum Thema „Kultur- und Veranstaltungsbauten der 50er und 60er Jahre“, welches ich in der Veranstaltung „Denkmalpflege und Nachkriegsarchitektur“ im Sommersemester 2005 an der Universität Bremen gehalten habe. Diese Hausarbeit besteht aus vier Teilen und einem Anhang. Der erste Teil ist die Einführung, in der ich die allgemeinen Informationen zu der Entwicklung der Nachkriegsarchitektur in Deutschland vorstelle. In dem zweiten Teil widme ich mich speziell der Architektur der 50er Jahre in Deutschland. Ich konzentriere mich hier auf die Kino- und Theaterbauten der 50er Jahre im geteilten Deutschland. Ich präsentiere drei Kinos: „Baki“ in München, das Doppelkino „Zoo-Palast“ uns „Atelier am Zoo“ in Westberlin und das „Schlosstheater“ in Münster sowie ein Theater: das „Stadttheater“ in Münster. Im dritten Teil behandle ich die wichtigsten Merkmale der Architektur der 60er Jahre und präsentiere den Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung 1967 in Montreal, die Stadthalle Bremen und die Philharmonie Berlin. Der letzte Teil ist die Schlussbetrachtung. Im Anhang befinden sich die Fotografien der präsentierten Gebäude. Für die Architektur in der Bundesrepublik Deutschland der Nachkriegsjahre werden in der Regel vier Phasen beschrieben:
- der notdürftige Wideraufbau der Infrastruktur
- der Wideraufbau bis Mitte der 50er Jahre vorwiegend nach restaurativen Leitbildern
- das Anknüpfen an Tendenzen des „Neuen Bauens“1 vor 1933
- das Anknüpfen an den Internationalen Stil bis 1960er Jahre2
Die Architekturentwicklung ging in den einzelnen Städten nicht immer parallel, was mit den örtlichen Besonderheiten der Nachkriegssituation zusammenhängt. Städte, die in besonders starkem Maße zerstört waren, wurden in anderer Weise wiederaufgebaut, als solche, in denen relativ viele historische Gebäude erhalten waren. In der Nachkriegszeit verlief die Entwicklung der Architektur in der DDR und Bundesrepublik Deutschland zuerst auf getrennten Wegen.
==
1 Das Neue Bauen ist eine neue Stilrichtung in der Architektur, die in den 20er Jahren entstand. Angeregt von neuen Bautechniken wie Eisenbau und Stahlbau rückte die Konstruktion in den Vordergrund. Dekorative Elemente waren unerwünscht. http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Bauen
2 Brosch, Astrid: Kinobauten der 1950er Jahre im geteilten Deutschland. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2003, S. 103-104
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Architektur der 50er Jahre
- Kinobauten
- München „Baki“
- West-Berlin „Zoo-Palast“ und „Atelier am Zoo“
- Münster „Schlosstheater“
- Theater
- Stadttheater Münster
- Kinobauten
- Die Architektur der 60er Jahre
- Deutscher Pavillon auf der Weltausstellung 1967 in Montreal
- Die Stadthalle Bremen
- Die Philharmonie Berlin
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Architektur von Kultur- und Veranstaltungsbauten in Deutschland während der 1950er und 1960er Jahre. Sie beleuchtet die Entwicklung der Architektur in der Nachkriegszeit, unter Berücksichtigung der politischen und gesellschaftlichen Einflüsse in Ost und Westdeutschland. Der Fokus liegt auf den charakteristischen Merkmalen der jeweiligen Architektur-Epochen und deren Abgrenzung zueinander.
- Entwicklung der Nachkriegsarchitektur in Ost- und Westdeutschland
- Charakteristische Merkmale der Architektur der 1950er Jahre
- Charakteristische Merkmale der Architektur der 1960er Jahre
- Vergleich der Architektur der 50er und 60er Jahre
- Einfluss von politischen und gesellschaftlichen Faktoren auf die Architektur
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Diese Arbeit stellt die Ausarbeitung eines Referats zum Thema „Kultur- und Veranstaltungsbauten der 50er und 60er Jahre“ dar, welches im Sommersemester 2005 an der Universität Bremen gehalten wurde. Sie gliedert sich in vier Teile und einen Anhang mit Fotografien der präsentierten Gebäude. Die Einführung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Nachkriegsarchitektur in Deutschland, die in vier Phasen unterteilt wird: notdürftiger Wiederaufbau, restaurativer Wiederaufbau, Anknüpfen an das „Neue Bauen“ und Anknüpfen an den Internationalen Stil. Die Arbeit beschreibt die unterschiedlichen Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland und legt den Fokus auf Kino- und Theaterbauten der 50er Jahre und ausgewählte Gebäude der 60er Jahre. Die unterschiedlichen architektonischen Ansätze in Ost und West werden angedeutet.
Die Architektur der 50er Jahre: Dieses Kapitel charakterisiert die Architektur der 1950er Jahre durch die Verschmelzung von Stadt und Natur, mit Begriffen wie Licht, Luft und Sonne. Im Gegensatz zur Monumentalität der 1930er Jahre steht die transparente Leichtigkeit und dynamische Bewegung der 50er Jahre. Die Arbeit analysiert den Gegensatz zur Klotzigkeit der Fertigbauten der 1960er Jahre und beschreibt typische Elemente dieser Ära wie dünne Dächer, geschwungene Treppengeländer, Beton-Rasterbau und die Verwendung von Betonfertigteilen in der Fassadengestaltung. Beispiele aus Kino- und Theaterbauten in Ost- und Westdeutschland veranschaulichen diese Merkmale, wobei der Unterschied in den architektonischen Ansätzen zwischen Ost und West deutlich wird.
Die Architektur der 60er Jahre: Dieses Kapitel befasst sich mit der Architektur der 1960er Jahre und präsentiert drei exemplarische Bauwerke: den Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung 1967 in Montreal, die Stadthalle Bremen und die Philharmonie Berlin. Es werden die charakteristischen Merkmale dieser Architektur, im Vergleich zu den 50er Jahren, analysiert und an den Beispielen erläutert. Die Kapitel vermittelt ein Verständnis für die Weiterentwicklung der Architektur in den 60er Jahren und hebt den Unterschied im Stil und der Funktionalität der präsentierten Gebäude hervor. Die Zusammenfassung fokussiert sich auf die Beschreibung der Architekturmerkmale der gezeigten Gebäude und ihrer Stellung innerhalb des größeren Kontexts der 60er Jahre Architektur.
Schlüsselwörter
Nachkriegsarchitektur, Kulturbauten, Veranstaltungsbauten, 1950er Jahre, 1960er Jahre, Kinoarchitektur, Theaterarchitektur, Bundesrepublik Deutschland, DDR, Internationaler Stil, Neues Bauen, Wiederaufbau, Stadtplanung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Kultur- und Veranstaltungsbauten der 50er und 60er Jahre"
Welche Architektur-Epochen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Architektur von Kultur- und Veranstaltungsbauten in Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren. Sie vergleicht die charakteristischen Merkmale beider Epochen und beleuchtet die Unterschiede in Ost- und Westdeutschland.
Welche Gebäude werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Gebäude, darunter Kinobauten wie das „Baki“ in München, den „Zoo-Palast“ und das „Atelier am Zoo“ in West-Berlin, das „Schlosstheater“ in Münster und das Stadttheater Münster. Zudem werden der Deutsche Pavillon auf der Weltausstellung 1967 in Montreal, die Stadthalle Bremen und die Philharmonie Berlin untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Nachkriegsarchitektur in Ost- und Westdeutschland, die charakteristischen Merkmale der Architektur der 1950er und 1960er Jahre, den Vergleich beider Epochen und den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Faktoren auf die Architektur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, Kapitel zur Architektur der 1950er und 1960er Jahre und eine Schlussbetrachtung. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Darstellung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte und eine Liste der Schlüsselwörter. Ein Anhang mit Fotografien der präsentierten Gebäude wird erwähnt.
Welche charakteristischen Merkmale der Architektur der 50er Jahre werden beschrieben?
Die Architektur der 50er Jahre wird durch die Verschmelzung von Stadt und Natur, Licht, Luft und Sonne charakterisiert. Im Gegensatz zur Monumentalität der 1930er Jahre steht die transparente Leichtigkeit und dynamische Bewegung. Typische Elemente sind dünne Dächer, geschwungene Treppengeländer, Beton-Rasterbau und die Verwendung von Betonfertigteilen in der Fassadengestaltung.
Welche charakteristischen Merkmale der Architektur der 60er Jahre werden beschrieben?
Die Arbeit analysiert die Architektur der 60er Jahre anhand von Beispielen wie dem Deutschen Pavillon in Montreal, der Stadthalle Bremen und der Philharmonie Berlin. Es wird ein Vergleich zu den 50er Jahren gezogen und der Unterschied im Stil und der Funktionalität der Gebäude hervorgehoben. Die Klotzigkeit der Fertigbauten wird im Gegensatz zur Leichtigkeit der 50er Jahre dargestellt.
Wie werden die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland in der Architektur berücksichtigt?
Die Arbeit deutet die unterschiedlichen architektonischen Ansätze in Ost und West an und zeigt die Unterschiede in den Beispielen aus Kino- und Theaterbauten der 50er Jahre auf. Die unterschiedlichen Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland im Kontext der Nachkriegszeit werden in der Einführung erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Nachkriegsarchitektur, Kulturbauten, Veranstaltungsbauten, 1950er Jahre, 1960er Jahre, Kinoarchitektur, Theaterarchitektur, Bundesrepublik Deutschland, DDR, Internationaler Stil, Neues Bauen, Wiederaufbau, Stadtplanung.
Wo wurde die Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit wurde als Referat im Sommersemester 2005 an der Universität Bremen gehalten.
- Quote paper
- Justyna Purwin (Author), 2006, Die Architektur der 50er und 60er Jahre in Deutschland - Veranstaltungs- und Kulturbauten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72007