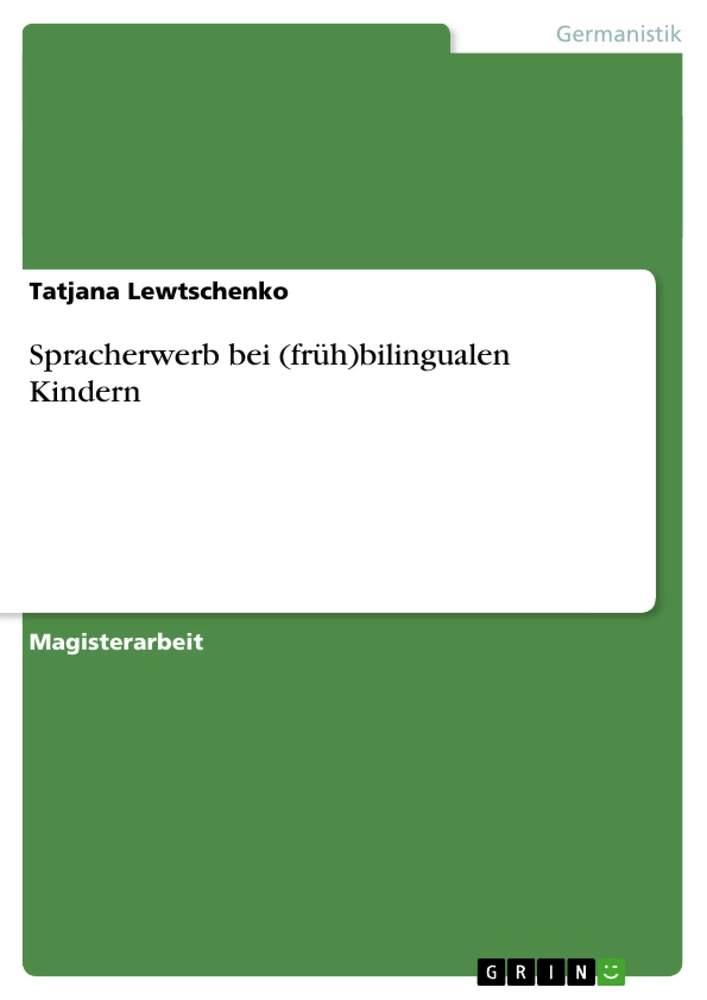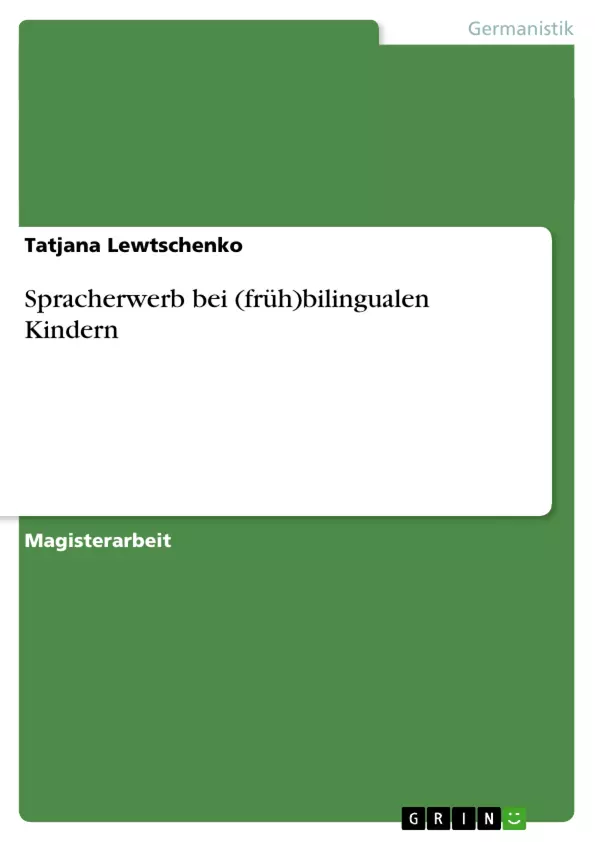Es ist heutzutage kaum zu bestreiten, dass das ganze Europa mehrsprachig ist. Deutschland bildet da keine Ausnahme: Es bestehen zahlreiche Mischehen, Emigrantenfamilien pflegen ihre Landessprachen. Einwanderer und ihre Kinder, die nach Deutschland kommen, müssen sich den neuen Bedingungen anpassen, auch in sprachlicher Hinsicht. Das Kontingent der Schüler an deutschen Schulen ist alles andere als homogen. In dieser Situation stellen sich Eltern und viele Lehrer die Frage, wie man solchen Kindern gegenüber sprachlich verhält und wie man mit der Muttersprache der Kinder umgeht. Nicht selten sind Fälle, bei denen Eltern in Deutschland auf die zweisprachige/mehrsprachige Erziehung der Kinder verzichten, um gleichsam die deutsche Sprache bei den Kindern nicht zu „benachteiligen" oder zu „stören“. Eine zweisprachige Kindererziehung ist bis heute mit vielen Vorurteilen verbunden. Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, bilinguale Spracherwerbsprozesse zu erklären und zu veranschaulichen, dass Zweisprachigkeit nicht schädlich ist, wenn man das Kind richtig fördert.
Um an das Problem der Zweisprachigkeit heranzugehen, wird die Arbeit nach dem folgenden Plan aufgebaut: man fängt mit allgemeinen Spracherwerbs- und Sprachentwicklungstheorien (Kapitel 2). Das ist unerlässlich, denn Spracherwerbsprozesse verlaufen bei ein- und mehrsprachigen Kindern identisch. Hier werden Prozesse der Lauterzeugung und Wortschatz- und Grammatikentwicklung behandelt. Auch ein kurzer Überblick der allgemein geltenden Spracherwerbstheorien ist vorhanden (Behaviorismus, Nativismus, kognitive Theorie und die Theorie der Interaktion). Danach werden der bilinguale Spracherwerb und seine Spezifika genauer betrachtet (Kapitel 3). Grundbegriffe und das Wesen der Zweisprachigkeit werden erläutert, eine allgemeine Charakteristik des zweisprachigen Individuums wird gegeben. In den darauf folgenden Kapiteln (Kapiteln 4-7) wird auf die mit der Zweisprachigkeit verbundenen Erscheinungen eingegangen. Darunter sind Überlegungen über die Intelligenz der Bilingualen (Kapitel 4), modernen Gehirnforschungen im Bereich Bilingualität (Kapitel 5), Besonderheiten der bilingualen Erziehung von frühem Kindesalter bzw. von der Geburt an (Kapitel 6), Begleiterscheinungen der Zweisprachigkeit - Interferenz und Code-switching (Kapitel 7).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spracherwerb allgemein
- Lauterzeugung
- Die Entwicklung des Wortschatzes
- Spracherwerbstheorien. Kurzer Überblick
- Bilingualer Spracherwerb: Definitionen und Grundbegriffe
- Allgemeine Charakteristik von Bilingualen
- Sprachmoden
- Zweisprachigkeit und Intelligenz
- Neurowissenschaftliche Untersuchungen im Bereich "frühbilinguale Entwicklung"
- Spracherwerb im frühen Kindesalter
- Interferenz und Code Switching
- Untersuchungen/Beobachtungen an zweisprachigen Kindern
- Beispielsanalysen
- Aufnahme 1. Vivien
- Aufnahme 2. Christine
- Aufnahme 3. Nastja
- Aufnahme 4. Violetta
- Aufnahme 5. Max
- Auswertung der Analysen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Spracherwerb bei (früh)bilingualen Kindern. Ziel ist es, den bilingualen Spracherwerbsprozess zu erklären und zu verdeutlichen, dass Zweisprachigkeit nicht schädlich ist, wenn sie richtig gefördert wird. Die Arbeit widerlegt Vorurteile gegenüber der zweisprachigen Erziehung und zeigt auf, wie man Kinder in diesem Kontext optimal unterstützt.
- Vergleichende Analyse von ein- und zweisprachigem Spracherwerb
- Exploration der Spezifika des bilingualen Spracherwerbs
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Zweisprachigkeit und Intelligenz
- Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die frühbilinguale Entwicklung
- Praktische Beispiele und Analysen von zweisprachigen Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik des mehrsprachigen Europas und die Herausforderungen der zweisprachigen Erziehung in Deutschland dar. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit der sprachlichen Unterstützung von Kindern in bilingualen Familien.
- Spracherwerb allgemein: Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegenden Phasen des Spracherwerbs, von der Lauterzeugung bis zur Entwicklung des Wortschatzes und der Grammatik. Ein kurzer Überblick über allgemeine Spracherwerbstheorien (Behaviorismus, Nativismus, kognitive Theorie und die Theorie der Interaktion) wird gegeben.
- Bilingualer Spracherwerb: Definitionen und Grundbegriffe: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Bilingualität und beschreibt die allgemeine Charakteristik von bilingualen Individuen. Es beleuchtet den Einfluss der Sprachmoden auf den Spracherwerb.
- Zweisprachigkeit und Intelligenz: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Zweisprachigkeit und Intelligenz. Es beleuchtet die Vorteile und Herausforderungen der bilingualen Entwicklung.
- Neurowissenschaftliche Untersuchungen im Bereich "frühbilinguale Entwicklung": Dieses Kapitel stellt die Erkenntnisse der modernen Gehirnforschung im Bereich der Bilingualität vor. Es zeigt, wie der Spracherwerb im Gehirn von bilingualen Kindern abläuft.
- Spracherwerb im frühen Kindesalter: Dieses Kapitel widmet sich dem Spracherwerb im frühen Kindesalter, insbesondere bei früh bilingualen Kindern. Es beleuchtet die Besonderheiten der bilingualen Erziehung von der Geburt an.
- Interferenz und Code Switching: Dieses Kapitel analysiert die Begleiterscheinungen der Zweisprachigkeit, wie Interferenz und Code-switching. Es beleuchtet die Ursachen und Folgen dieser Phänomene.
- Untersuchungen/Beobachtungen an zweisprachigen Kindern: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Beispiele und Analysen von bilingualen Kindern, deren Sprache aufgezeichnet und transkribiert wurde. Es liefert Erkenntnisse aus der direkten Beobachtung von Spracherwerbsvorgängen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Begriffe des bilingualen Spracherwerbs, darunter frühbilinguale Entwicklung, Zweisprachigkeit, Interferenz, Code Switching, Sprachmoden, Spracherwerbstheorien, neurowissenschaftliche Erkenntnisse, praktische Beobachtungen und Analysen. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des bilingualen Spracherwerbs auf die kognitive Entwicklung, die Sprachentwicklung und die soziale Integration von Kindern. Sie stellt wichtige Erkenntnisse über die Vorteile und Herausforderungen der zweisprachigen Erziehung dar.
Häufig gestellte Fragen
Ist eine zweisprachige Erziehung schädlich für die Entwicklung des Kindes?
Nein, Zweisprachigkeit ist nicht schädlich. Die Arbeit verdeutlicht, dass bilinguale Spracherwerbsprozesse bei richtiger Förderung positive Auswirkungen haben und Vorurteile gegenüber Mehrsprachigkeit unbegründet sind.
Was unterscheidet den bilingualen vom einsprachigen Spracherwerb?
Die grundlegenden Prozesse der Lauterzeugung sowie der Wortschatz- und Grammatikentwicklung verlaufen bei ein- und mehrsprachigen Kindern weitgehend identisch, jedoch treten bei bilingualen Kindern spezifische Phänomene wie Code-Switching auf.
Was bedeuten die Begriffe Interferenz und Code-Switching?
Interferenz bezeichnet die gegenseitige Beeinflussung der Sprachen, während Code-Switching den fließenden Wechsel zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Gesprächs oder Satzes beschreibt.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Zweisprachigkeit und Intelligenz?
Die Arbeit untersucht diesen Zusammenhang und zeigt auf, dass Bilingualität kognitive Vorteile bieten kann, sofern das Kind in beiden Sprachen adäquat unterstützt wird.
Welche Rolle spielt die Gehirnforschung bei der Bilingualität?
Moderne neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, wie das Gehirn von bilingualen Kindern beide Sprachen verarbeitet und welche neuronalen Besonderheiten bei einer frühbilingualen Entwicklung entstehen.
- Quote paper
- Tatjana Lewtschenko (Author), 2006, Spracherwerb bei (früh)bilingualen Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71911