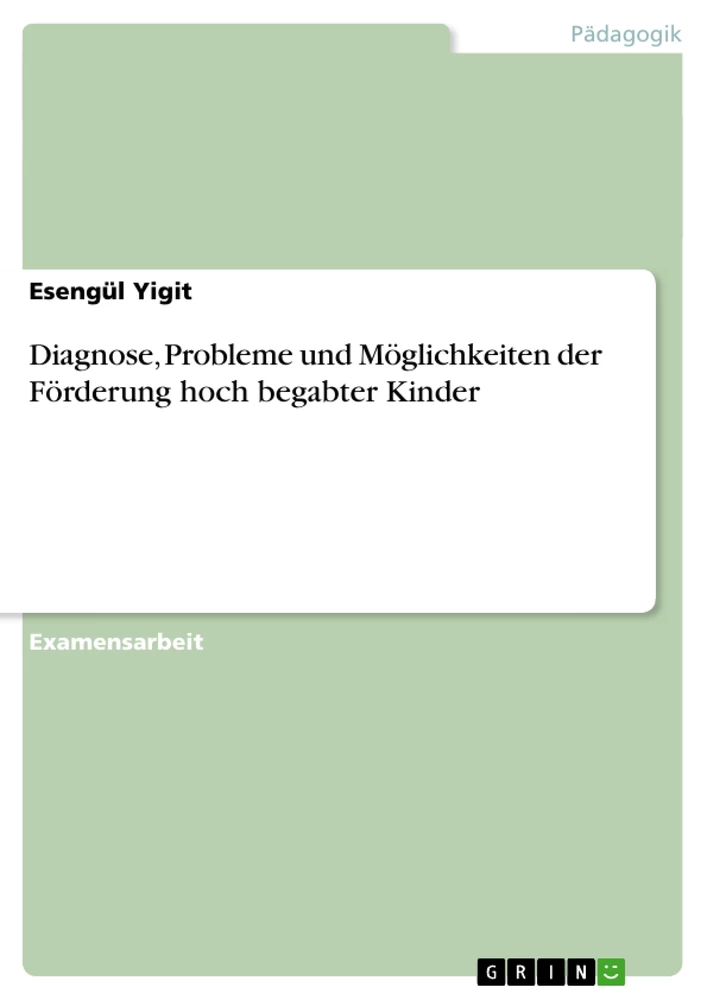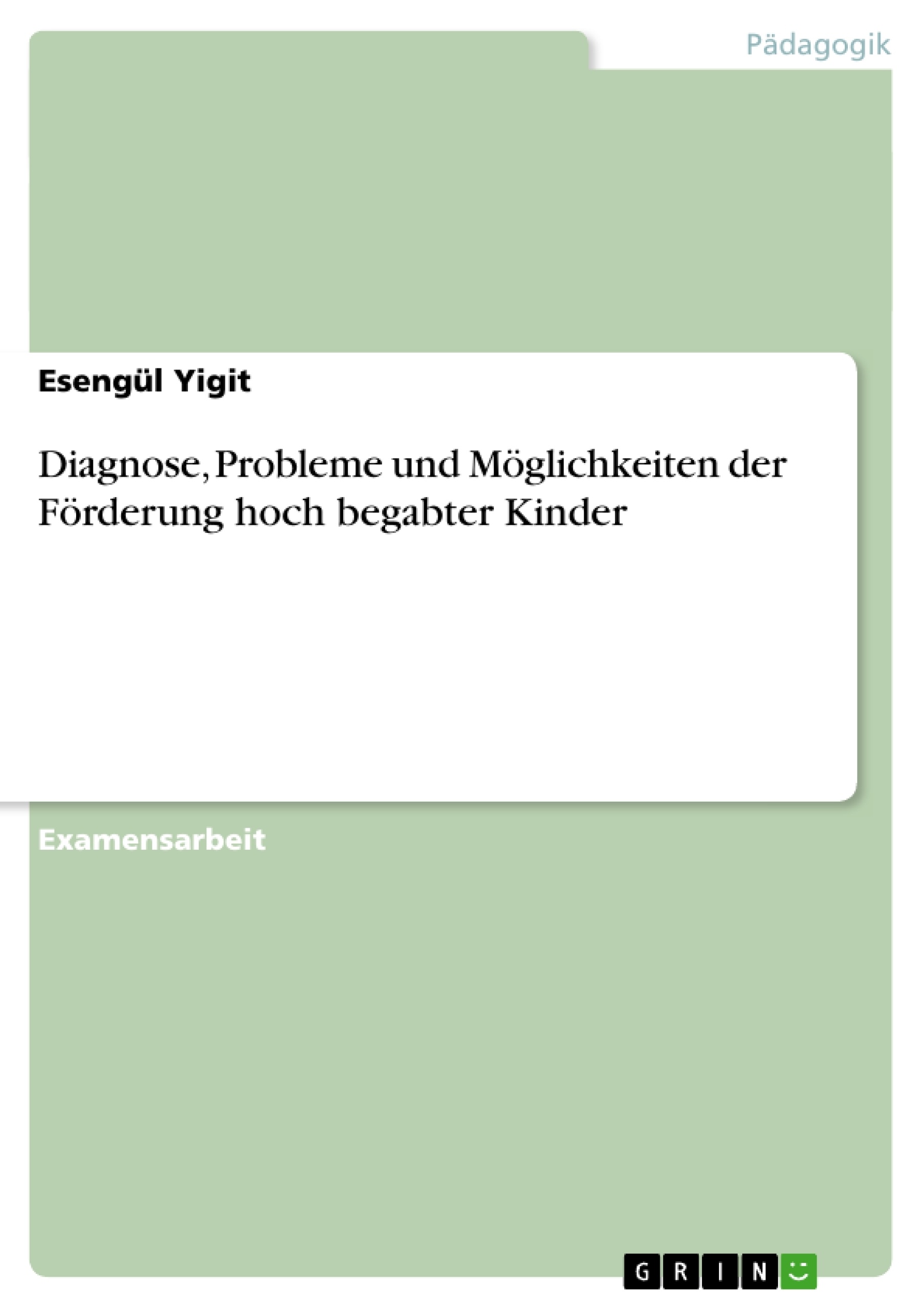Das Zusammenbringen des Begriffs Hochbegabung und der Forderung nach besonderer Förderung klingt vielleicht für manche zunächst kontrovers, da vielfach angenommen wird, das Hochbegabte die Sonnenkinder der Gesellschaft sind, denen alles zufliegt. Sie haben gute Noten in der Schule, lernen schneller als die anderen Kinder und üben als Erwachsene verantwortungsvolle und hoch angesehene Berufe aus oder werden berühmte Leute. In den Medien wird über Wunderkinder berichtet, die außergewöhnliche Dinge vollbringen. Generell löst Hochbegabung ein Erstaunen, eine Bewunderung und eine Wertschätzung aus. Wenn jedoch besondere Förderung für diese Kinder verlangt wird, wird von Elitebildung und undemokratischen Absichten gesprochen, wodurch dieses Thema negativ belegt wird. Viele teilen auch die Ansicht, eine Förderung sollte ausschließlich den Schwächeren vorbehalten sein, zum Beispiel ausschließlich Kindern mit Lernschwierigkeiten. Dabei wird vergessen, dass jeder einen Anspruch auf die Entfaltung seiner Persönlichkeit und seiner Fähigkeiten hat. Es gibt hoch begabte Kinder, in denen Begabungen schlummern, die jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bemerkt werden. Es gibt auch hoch begabte Kinder, die ihre Fähigkeiten nicht in schulische Leistungen umsetzen können und in der Schule versagen. Wenn Begabungen nicht entdeckt werden, enthalten wir diesen Kindern nicht etwas von ihrer Lebensfreude vor? Wenn sie doch bei einer Erkennung und Förderung mehr Erfolgserlebnisse verzeichnen könnten? Was ist mit denjenigen Kindern, bei denen eine hohe Begabung offensichtlich ist, die aber im Schulalltag oder in ihren Familien ständig in ihrem Wissensdurst gebremst werden? Deren viele und vielseitigen Fragen nicht erwünscht sind oder mit ungenügenden Antworten abgespeist werden? Die immer und überall auf andere warten müssen, bis diese ihren Stand erreicht haben? Es gibt Kinder, die komplexer denken und lernen als andere. Sie können mit einem Jahr in ganzen Sätzen sprechen, mit zwei Jahren interessieren sie sich für Zahlen und Buchstaben, mit drei Jahren können sie rechnen, mit vier bereits lesen, alles von sich aus und ohne eine treibende Kraft, mit sechs kommen sie in die Schule......Probleme bleiben nicht aus, die hohen Erwartungen enden meist in einer großen Enttäuschung. Es können sich vielfältigere Probleme bei diesen Kindern entwickeln, wenn ihre hohe Begabung nicht rechtzeitig erkannt und angemessen gefördert wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Definitionen und Modelle der Hochbegabung
- Die sechs Definitionsklassen der Hochbegabung von Lucito
- Ex-post-facto Definitionen
- I.Q.-Definitionen
- Soziale Definitionen
- Prozentsatzdefinitionen
- Kreativitätsdefinitionen
- Mehrfaktoren-Definitionen
- Zusammenfassung
- Modelle der Hochbegabung
- Drei-Ringe-Modell der Begabung von Renzulli
- Komponentenmodell der Talententwicklung von Wieczerkowski und Wagner
- Triadisches Interdependenzmodell der Hochbegabung von Mönks
- Mehrdimensionales Begabungskonzept von Urban
- Differenziertes Begabungs- und Talentmodell von Gagne
- Münchener (Hoch)Begabungsmodell von Heller, Perleth und Hany
- Implizite pentagonale Theorie der Hochbegabung nach Sternberg
- Zusammenfassung
- Die sechs Definitionsklassen der Hochbegabung von Lucito
- Persönlichkeitsmerkmale von hoch begabten Kindern
- Kognitive Persönlichkeitsmerkmale
- Soziale Persönlichkeitsmerkmale
- Emotionale Persönlichkeitsmerkmale
- Andere Persönlichkeitsmerkmale
- Persönlichkeitsmerkmale von Underachievern
- Diagnose von hoch begabten Kindern
- Notwendigkeit und Bedeutung einer Diagnose bei Hochbegabten
- Diagnoseverfahren zur Identifizierung hoch begabter Kinder
- Objektive (formelle) Diagnoseverfahren
- Intelligenztests
- Kreativitätstests
- Zensuren
- Wettbewerbe
- Subjektive (informelle) Diagnoseverfahren
- Lehrernomination und Lehrerurteil
- Elternauskunft und Elternnomination
- Selbstauskunft und Selbstnomination
- Peernomination
- Kombination mehrerer Verfahren
- Checklisten
- Risikogruppen
- Risikogruppe: Mädchen
- Risikogruppe: Kinder aus sozial schwachen oder ethnischen Minderheiten
- Risikogruppe: Underachiever
- Risikogruppe: Behinderte Kinder
- Risikogruppe: Kinder mit Teilleistungsschwächen
- Objektive (formelle) Diagnoseverfahren
- Probleme von hoch begabten Kindern
- Asynchronien in der Entwicklung
- Schulische Unterforderung und ihre Folgen
- Problem Underachievement: Minderleistung bei hoch begabten Kindern
- Perfektionismus als Problem bei hoch begabten Kindern
- Isolation und Ausgrenzung
- Aggressivität bei hoch begabten Kindern
- Familiäre Konflikte
- Lehrer-Schüler Konflikte
- Die Förderung hoch begabter Kinder und deren Bedeutung
- Erwartungen an die Lehrerperson für die Förderung von hoch begabten Kindern
- Zielsetzung und Prinzipien einer optimalen Förderung
- Akzeleration
- Akzeleration durch frühere Einschulung
- Akzelerationsmaßnahme: Überspringen von Klassen
- Flexible Eingangsstufe
- Akzeleration durch nachträgliche und höhere Einschulung
- Akzeleration durch Teilzeitunterricht in höheren Klassen
- Akzeleration durch Parallelfachklassen
- Weitere akzelerierende Maßnahmen
- Enrichment
- Individualisierung durch innere Differenzierung
- Enrichment durch äußere Differenzierung
- Arbeitsgemeinschaften
- Ressourcenzimmer
- Wettbewerbe als Möglichkeit des Enrichment
- Samstagsschulen
- Separation
- Abschließende Worte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Diagnose, den Problemen und den Möglichkeiten der Förderung hoch begabter Kinder im Primarbereich. Sie untersucht die verschiedenen Definitionsklassen und Modelle der Hochbegabung, analysiert die besonderen Persönlichkeitsmerkmale hoch begabter Kinder sowie die Notwendigkeit und die Verfahren ihrer Diagnose.
- Definitionen und Modelle der Hochbegabung
- Persönlichkeitsmerkmale hoch begabter Kinder
- Diagnose von Hochbegabung im Primarbereich
- Probleme, die mit Hochbegabung im Schulalltag verbunden sind
- Fördermöglichkeiten für hoch begabte Kinder im Primarbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Begriff der Hochbegabung einführt und die Bedeutung ihrer Förderung betont. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Definitionsklassen und Modelle der Hochbegabung vorgestellt und kritisch betrachtet. Dabei werden sowohl klassische Definitionen, die auf den Intelligenzquotienten fokussieren, als auch neuere Modelle, die die Multidimensionalität der Begabung berücksichtigen, behandelt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den besonderen Persönlichkeitsmerkmalen hoch begabter Kinder. Es werden kognitive, soziale, emotionale und andere Persönlichkeitsmerkmale beschrieben sowie die spezifischen Herausforderungen von Underachievern beleuchtet. Im vierten Kapitel wird die Notwendigkeit und Bedeutung einer Diagnose von Hochbegabung im Primarbereich aufgezeigt. Es werden verschiedene Diagnoseverfahren, sowohl objektive als auch subjektive, vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Das Kapitel geht auch auf Risikogruppen ein, in denen hoch begabte Kinder häufig übersehen werden. Das fünfte Kapitel behandelt die vielfältigen Probleme, die hoch begabte Kinder im Schulalltag erleben können. Dazu gehören unter anderem schulische Unterforderung, Asynchronien in der Entwicklung, Underachievement, Perfektionismus, Isolation und Ausgrenzung sowie Konflikte mit Lehrern und Eltern.
Schlüsselwörter
Hochbegabung, Definitionen, Modelle, Persönlichkeitsmerkmale, Diagnose, Diagnoseverfahren, Probleme, Underachievement, Förderung, Akzeleration, Enrichment, Separation, Primarstufe, Schule, Lehrer, Eltern.
- Quote paper
- Esengül Yigit (Author), 2004, Diagnose, Probleme und Möglichkeiten der Förderung hoch begabter Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71810