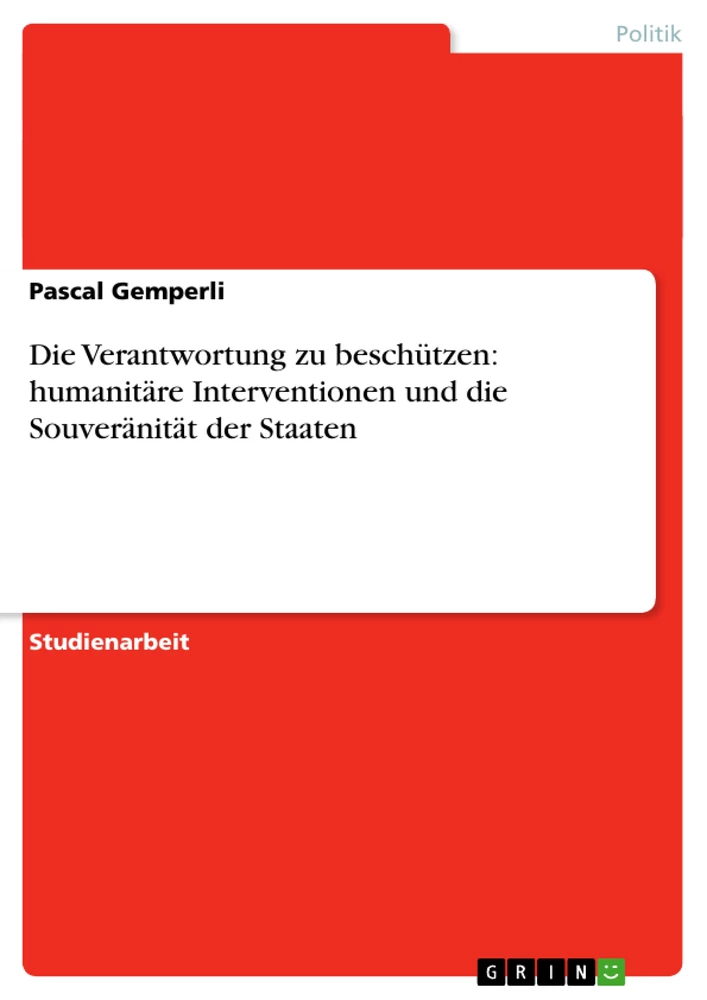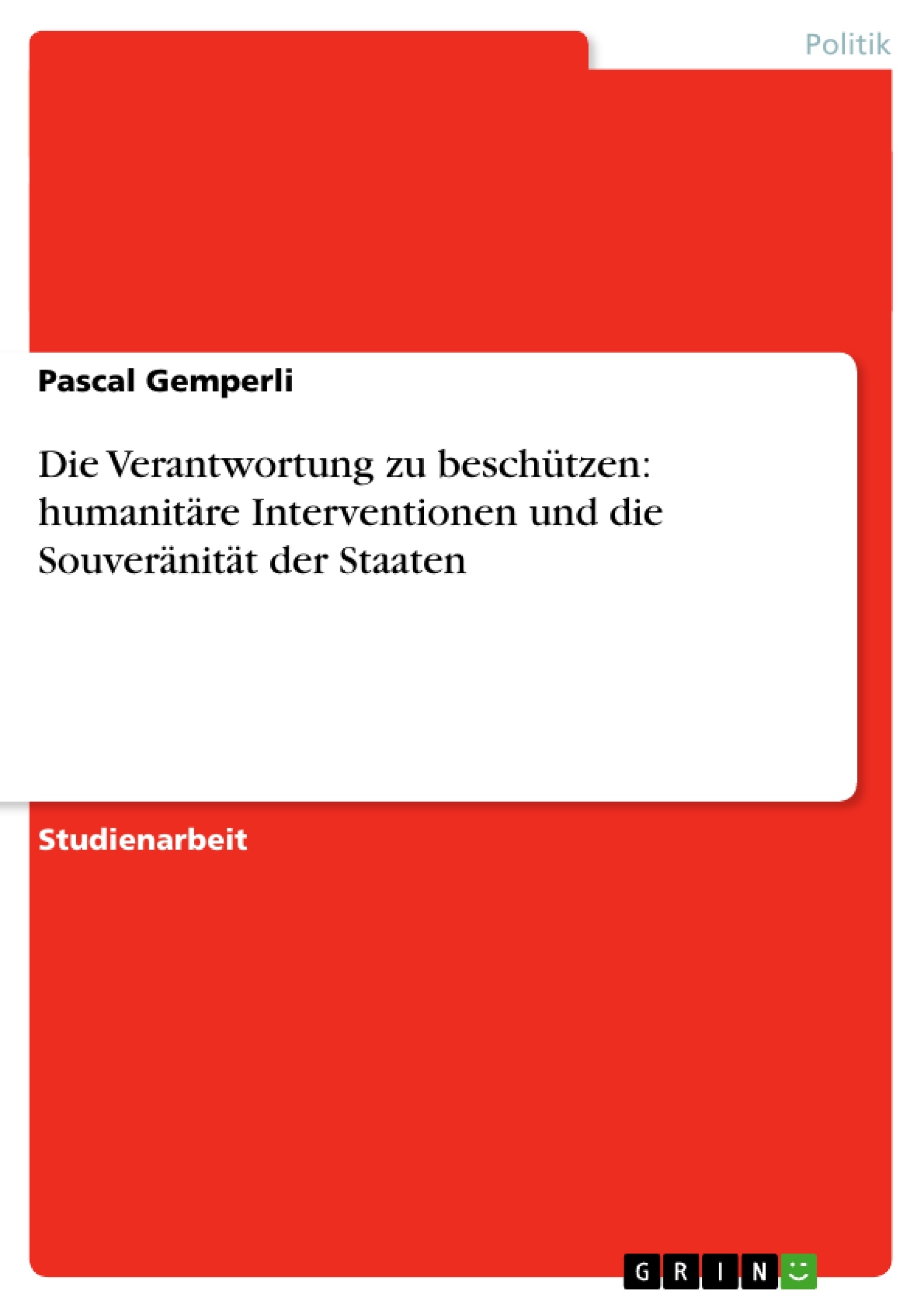Die Arbeit präsentiert eine auf hauptsächlich völkerrechtlicher Basis erstellte Darstellung des Spannungsfeldes
zwischen humanitären Interventionen bei Menschenrechtsverletzungen und der völkerrechtlichen Souveränität der Staaten. Nach eingehender Analyse der aktuellen Situation und der Tendenzen über die letzten 15 Jahre wird der Blickwinkel auch auf moralnormative Aspekte und Forderungen ausgeweitet. Dies erlaubt es die Brücke zu
schlagen zum wahrscheinlich aktuellsten und profundesten Versuch das bestehende Völkerrecht in diesem Bereich entscheidend umzuinterpretieren: der Verantwortung zu beschützen.
Im ersten Kapitel wird die Thematik umrissen indem das Spannungsfeld zwischen staatlicher Souveränität, Selbstbestimmung der Völker und Verletzung der Menschenrechte sowie der völkerrechtliche Begriff des „Volkes“ definiert werden.
Im zweiten Kapitel widmen wir uns dann den humanitären Interventionen ganz konkret. Aufgezeigt und kritisiert wird der Prozess wie diese zustande kommen und welche versteckten Motivationen dabei allenfalls eine Rolle spielen können.
Um den Blickwinkel ein wenig auszuweiten und auch mal vom Völkerrecht wegschweifen zu lassen wird ein Kriterienkatalog für das Recht auf humanitäre Intervention mit 15
moralnormativen Punkten aus unterschiedlichsten Quellen vorgestellt.
Um auch die kritischsten Geister zu befriedigen soll auch die Hinterfragung nach dem praktischen Sinn und Zweck einer humanitären Intervention nicht fehlen. Diese
weitet zuerst den Blickwinkel auf entwicklungspolitische Dimensionen und nachhaltige Konflikttransformation aus um schlussendlich den Nutzen und die Grenzen von humanitären Interventionen zum Beitrag dieser aufzuzeigen. Beim
Versuch den Begriff des Weltfriedens fassbar zu machen wird dessen wichtige direkte Beziehung zum Interventionsverständnis klar.
Als ein möglich gangbarer Weg zur Regelung des Widerspruch zwischen Souveränität der Staaten und massiver Menschrechtsverletzungen wird das von der Internationalen Kommission für Intervention und Staatssouveränität erstellte
Konzept der Verantwortung zu beschützen präsentiert. Dieses bezieht eindeutig Stellung für den Primat der Menschenrechte und geht so weit, einen geschichtlich einmaligen Paradigmenwechsel im Völkerrecht zu fordern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Völkerrecht
- Staatenrecht und Souveränität
- „Menschenrecht“ und Selbstbestimmung
- Humanitäre Intervention
- Das Spannungsfeld zwischen Menschenrechten und staatlicher Souveränität
- Recht zur Intervention
- Pflicht zur Intervention
- Der Sinn einer Intervention
- Der Begriff des Weltfriedens
- Die Internationale Kommission für Intervention und Staatssouveränität: „Die Verantwortung zu schützen“
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Spannungsfeld zwischen humanitären Interventionen bei Menschenrechtsverletzungen und der völkerrechtlichen Souveränität der Staaten. Es wird eine Darstellung auf hauptsächlich völkerrechtlicher Basis erstellt und die aktuelle Situation sowie Tendenzen der letzten 15 Jahre betrachtet. Der Fokus liegt zudem auf moralnormativen Aspekten und Forderungen, um einen Brückenschlag zur „Verantwortung zu beschützen“ zu ermöglichen, einem Konzept das eine Neuinterpretation des Völkerrechts in diesem Bereich anstrebt.
- Das Spannungsfeld zwischen staatlicher Souveränität, Selbstbestimmung der Völker und Verletzung der Menschenrechte.
- Die Definition des Begriffs „Volk“ im völkerrechtlichen Kontext.
- Die Rolle des UN-Sicherheitsrates bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.
- Die Analyse von humanitären Interventionen und deren Rechtmäßigkeit im Völkerrecht.
- Die „Verantwortung zu beschützen“ als möglicher Lösungsansatz für den Konflikt zwischen Souveränität und massiven Menschenrechtsverletzungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert das Spannungsfeld zwischen staatlicher Souveränität, Selbstbestimmung der Völker und Verletzung der Menschenrechte. Der völkerrechtliche Begriff des „Volkes“ wird definiert, und die Grenzen der staatlichen Souveränität, insbesondere in Bezug auf die Gefährdung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, werden untersucht.
Kapitel zwei widmet sich den humanitären Interventionen, beleuchtet deren Entstehungsprozess und mögliche versteckte Motivationen. Anhand von Beispielen aus Resolutionen von 1991 (Irak) bis zur Albanienresolution 1997 wird gezeigt, wie der Sicherheitsrat massive Menschenrechtsverletzungen als Gefährdung für den Weltfrieden einstuft. Dies ermöglicht die Verfolgung von Entwicklungstrends im Völkergewohnheitsrecht.
Das dritte Kapitel untersucht das Recht zur Intervention und die Möglichkeiten, Menschenrechtsverletzungen zu einer Angelegenheit der internationalen Staatengemeinschaft zu machen. Es präsentiert einen Kriterienkatalog für das Recht auf humanitäre Intervention mit 15 moralnormativen Punkten aus verschiedenen Quellen. Diese Anforderungen werden mit der völkerrechtlichen Praxis verglichen.
Kapitel vier diskutiert die Pflicht zur Intervention, insbesondere vor dem Hintergrund der wiederholten Unfähigkeit oder des Unwillens des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, bei Fällen offensichtlicher massiver Menschenrechtsverletzungen zu handeln. Es hinterfragt auch den praktischen Sinn und Zweck von humanitären Interventionen und beleuchtet deren entwicklungspolitische Dimensionen sowie Möglichkeiten zur Konflikttransformation.
Kapitel fünf präsentiert das Konzept der „Verantwortung zu beschützen“, das von der Internationalen Kommission für Intervention und Staatssouveränität erstellt wurde. Dieses Konzept setzt sich klar für den Primat der Menschenrechte ein und fordert einen historischen Paradigmenwechsel im Völkerrecht.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Völkerrechts, der Souveränität der Staaten, der Selbstbestimmung der Völker und den Menschenrechten. Weitere wichtige Begriffe sind humanitäre Interventionen, Weltfrieden, Internationale Kommission für Intervention und Staatssouveränität, die „Verantwortung zu beschützen“ und der UN-Sicherheitsrat.
- Quote paper
- Dipl. Ing. Pascal Gemperli (Author), 2007, Die Verantwortung zu beschützen: humanitäre Interventionen und die Souveränität der Staaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71638