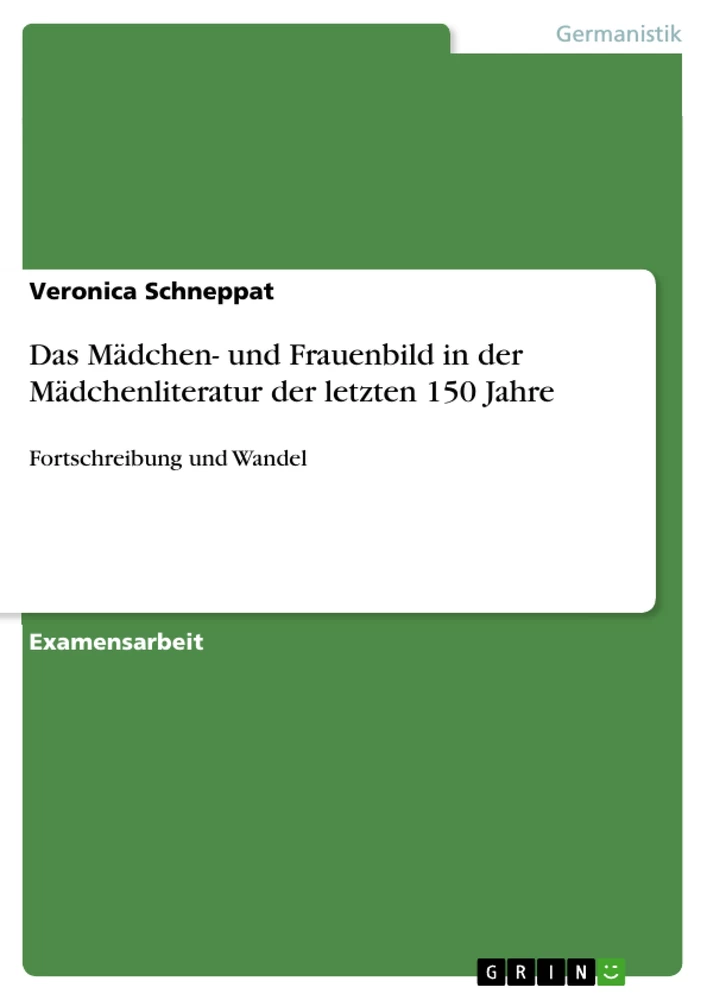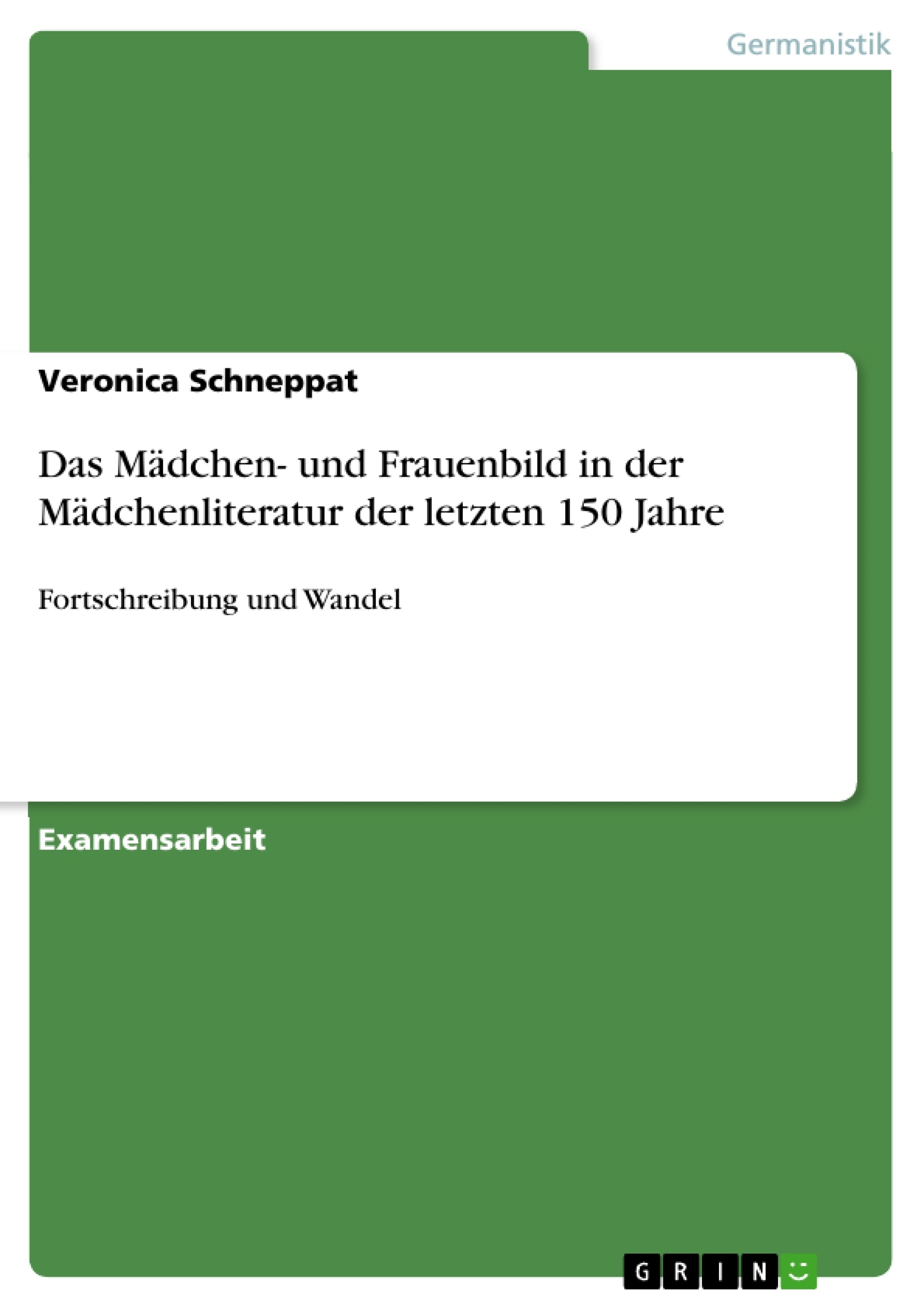Der von mir untersuchte Zeitraum umfasst die Entwicklung des Mädchenbuchs innerhalb der letzten 150 Jahre von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Jahrtausendwende.
Auch wenn ich mit Backfischchens Freuden und Leiden von Clementine Helm ein Buch für die Analyse gewählt habe, das noch zur Zeit der Restauration geschrieben wurde, werde ich in dem Kapitel über das Frauenbild in der Gesellschaft nicht näher auf diese Epoche eingehen. Nach der Märzrevolution und der Paulskirchenversammlung von 1848 befand sich auf dem Gebiet des späteren Deutschen Reiches Vieles im gesellschaftlichen und politischen Umbruch. Deutschland war in mehr als 50 Territorialstaaten mit eigenen Landesfürsten gesplittet, so dass eine Untersuchung in dieser Arbeit aufgrund der divergierenden Einstellungen und unterschiedlichen Voraussetzungen im damaligen deutschsprachigen Gebiet im Rahmen dieser Arbeit zu umfangreich und umfassend sein würde. Da es mir außerdem primär um das Mädchenbild in der Mädchenliteratur geht, halte ich diese Eingrenzung nicht nur für vertretbar, sondern auch für absolut notwendig, um den Fokus auf andere Schwerpunkte richten zu können.
Die von mir gewählten Titel behandeln allesamt das Leben der weiblichen Protagonistin im Elternhaus, in der Schule oder im Internat, an der Universität oder Ausbildungsstätte. Freundschaft und Liebe spielen eine große Rolle, ebenso wie Probleme im Rahmen der eigenen pubertären Entwicklung und Konflikte mit anderen Personen. Ich untersuche sowohl Bücher, deren empfohlenes Lesealter einmal für „jüngere” Mädchen in etwa bis zum zwölften Lebensalter reicht (Hanni& Nanni)als auch Bücher für die „jugendliche Leserin”. Den umfangreichen Bereich der (seriellen) Pferdegeschichten möchte ich dabei jedoch ausklammern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil
- Definition: Mädchenliteratur
- Allgemeine Definition
- Die Geschichte der Mädchenliteratur
- Kritik am Mädchenbuch
- Das „typische“ Mädchenbuch
- Zielgruppe
- Themen
- Funktion
- Erzählstrukturen
- Mädchenbild
- Das Frauenbild in der Gesellschaft
- Rollenspezifische Sozialisation
- Erziehung
- Bildung
- Abweichen von traditioneller Geschlechtersozialisation
- Aktuelle Veränderungen
- Zweiter Teil
- Analyse
- Clementine Helm: Backfischchens Freuden und Leiden
- Else Ury: Nesthäkchen - Serie
- Emma Gündel: Elke der Schlingel
- Enid Blyton: Hanni und Nanni
- Dagmar Chidolue: Aber ich werde alles anders machen
- Christian Bienik: Knutschen erlaubt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Mädchen- und Frauenbildes in der Mädchenliteratur der letzten 150 Jahre. Ziel ist es, die Veränderungen und Kontinuitäten in der Darstellung von Mädchen und Frauen in dieser spezifischen Literaturgattung aufzuzeigen und deren Einfluss auf die weibliche Sozialisation zu beleuchten. Die Analyse berücksichtigt sowohl die inhaltlichen Aspekte als auch die erzählerischen Strukturen der Texte.
- Entwicklung des Mädchenbildes in der Mädchenliteratur
- Veränderung des Frauenbildes in der Gesellschaft und seine Reflexion in der Literatur
- Der Einfluss von Mädchenliteratur auf die weibliche Sozialisation
- Analyse spezifischer Beispiele aus der Mädchenliteratur verschiedener Epochen
- Kritik an traditionellen Geschlechterrollen und deren Darstellung in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Mädchenliteratur und deren Bedeutung für die weibliche Sozialisation ein. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung und nennt die Autorin Christine de Pizan als frühe Stimme der Kritik am traditionellen Frauenbild, dessen Aussagen bis ins 21. Jahrhundert relevant bleiben und Vorurteile gegenüber Frauen aufzeigen. Die Einleitung stellt ein historisches Fundament für die anschließende Analyse dar und kontrastiert frühe kritische Stimmen mit der späteren Verinnerlichung des Frauenbildes als Hausfrau, Mutter und Gattin.
Definition: Mädchenliteratur: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Definition von Mädchenliteratur, beleuchtet deren Geschichte und kritisiert gängige Stereotype und Konventionen. Es analysiert die Entwicklung der Gattung und setzt sich kritisch mit deren normativen und gesellschaftlichen Einflüssen auseinander. Der Fokus liegt auf der historischen Einordnung und der kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff und seinen impliziten Bedeutungen.
Das „typische“ Mädchenbuch: Dieses Kapitel untersucht die typischen Merkmale von Mädchenbüchern, inklusive der Zielgruppe, der behandelten Themen, ihrer Funktion in der Gesellschaft, der verwendeten Erzählstrukturen und der Darstellung des Mädchenbildes. Die Analyse beleuchtet die stereotypen Rollenbilder und die darin implizierten Erwartungen an Mädchen. Es wird dargelegt, wie diese Bücher zur Konstruktion und Festigung sozialer Normen beitragen.
Das Frauenbild in der Gesellschaft: Dieses Kapitel widmet sich dem breiteren Kontext, indem es das Frauenbild in der Gesellschaft in seinen verschiedenen historischen und gesellschaftlichen Facetten beleuchtet. Es analysiert die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und untersucht, wie diese Erwartungen die Darstellung von Frauen in der Literatur beeinflussen. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Rolle der Frau werden erörtert.
Rollenspezifische Sozialisation: Dieses Kapitel untersucht die Sozialisation von Mädchen innerhalb der traditionellen Geschlechterrollen. Es analysiert verschiedene Aspekte wie Erziehung, Bildung und Abweichungen von traditionellen Mustern sowie aktuelle Veränderungen in der Geschlechterrolle. Die Zusammenfassung der Unterkapitel über Erziehung, Bildung und Abweichen von traditionellen Geschlechterrollen zeigt, wie diese Faktoren das Frauenbild prägen und beeinflussen.
Schlüsselwörter
Mädchenliteratur, Frauenbild, Mädchenbild, Geschlechterrollen, Sozialisation, Erziehung, Bildung, Literaturanalyse, historische Entwicklung, Emanzipation, Stereotype.
Häufig gestellte Fragen zu: Entwicklung des Mädchen- und Frauenbildes in der Mädchenliteratur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Mädchen- und Frauenbildes in der Mädchenliteratur der letzten 150 Jahre. Sie analysiert Veränderungen und Kontinuitäten in der Darstellung von Mädchen und Frauen und deren Einfluss auf die weibliche Sozialisation. Die Analyse betrachtet sowohl inhaltliche Aspekte als auch Erzählstrukturen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die Veränderungen und Kontinuitäten in der Darstellung von Mädchen und Frauen in der Mädchenliteratur aufzeigen und deren Einfluss auf die weibliche Sozialisation beleuchten. Es geht darum, die Entwicklung des Mädchenbildes, die Reflexion des Frauenbildes in der Gesellschaft und den Einfluss der Mädchenliteratur auf die Sozialisation von Mädchen zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Mädchenbildes in der Mädchenliteratur, der Veränderung des Frauenbildes in der Gesellschaft und seiner Reflexion in der Literatur, dem Einfluss von Mädchenliteratur auf die weibliche Sozialisation, der Analyse spezifischer Beispiele aus verschiedenen Epochen und der Kritik an traditionellen Geschlechterrollen und deren Darstellung in der Literatur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen ersten und zweiten Teil. Der erste Teil umfasst eine Einleitung, eine Definition von Mädchenliteratur, eine Beschreibung des „typischen“ Mädchenbuches, eine Analyse des Frauenbildes in der Gesellschaft und eine Betrachtung der rollenspezifischen Sozialisation von Mädchen. Der zweite Teil beinhaltet eine Analyse verschiedener ausgewählter Mädchenbücher.
Welche Bücher werden im zweiten Teil analysiert?
Der zweite Teil analysiert folgende Bücher: Clementine Helm: Backfischchens Freuden und Leiden; Else Ury: Nesthäkchen - Serie; Emma Gündel: Elke der Schlingel; Enid Blyton: Hanni und Nanni; Dagmar Chidolue: Aber ich werde alles anders machen; Christian Bienik: Knutschen erlaubt.
Was wird unter "Mädchenliteratur" verstanden?
Die Arbeit liefert eine umfassende Definition von Mädchenliteratur, beleuchtet deren Geschichte und kritisiert gängige Stereotype und Konventionen. Es wird die historische Einordnung und die kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff und seinen impliziten Bedeutungen behandelt.
Wie werden die „typischen“ Merkmale von Mädchenbüchern beschrieben?
Die Analyse betrachtet die Zielgruppe, die behandelten Themen, die Funktion in der Gesellschaft, die Erzählstrukturen und die Darstellung des Mädchenbildes. Es werden die stereotypen Rollenbilder und die implizierten Erwartungen an Mädchen beleuchtet, sowie der Beitrag dieser Bücher zur Konstruktion und Festigung sozialer Normen.
Wie wird das Frauenbild in der Gesellschaft betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet das Frauenbild in seinen verschiedenen historischen und gesellschaftlichen Facetten. Sie analysiert die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und untersucht, wie diese Erwartungen die Darstellung von Frauen in der Literatur beeinflussen. Unterschiedliche Sichtweisen auf die Rolle der Frau werden erörtert.
Wie wird die rollenspezifische Sozialisation von Mädchen behandelt?
Dieser Abschnitt untersucht die Sozialisation von Mädchen innerhalb traditioneller Geschlechterrollen. Er analysiert Aspekte wie Erziehung, Bildung, Abweichungen von traditionellen Mustern und aktuelle Veränderungen in der Geschlechterrolle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mädchenliteratur, Frauenbild, Mädchenbild, Geschlechterrollen, Sozialisation, Erziehung, Bildung, Literaturanalyse, historische Entwicklung, Emanzipation, Stereotype.
- Quote paper
- Veronica Schneppat (Author), 2005, Das Mädchen- und Frauenbild in der Mädchenliteratur der letzten 150 Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71602