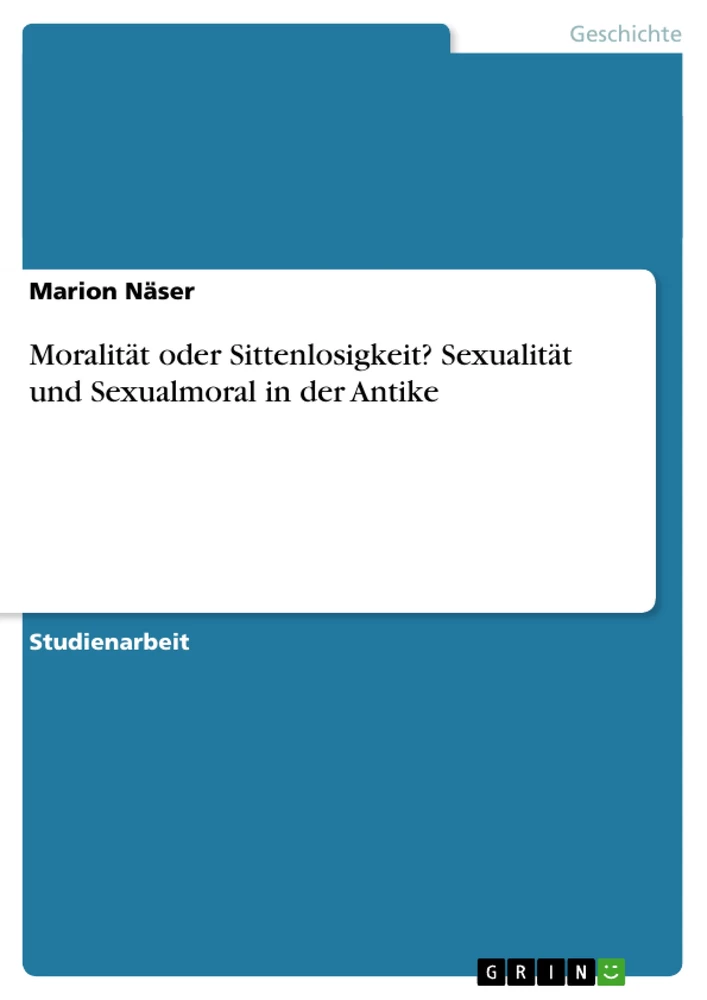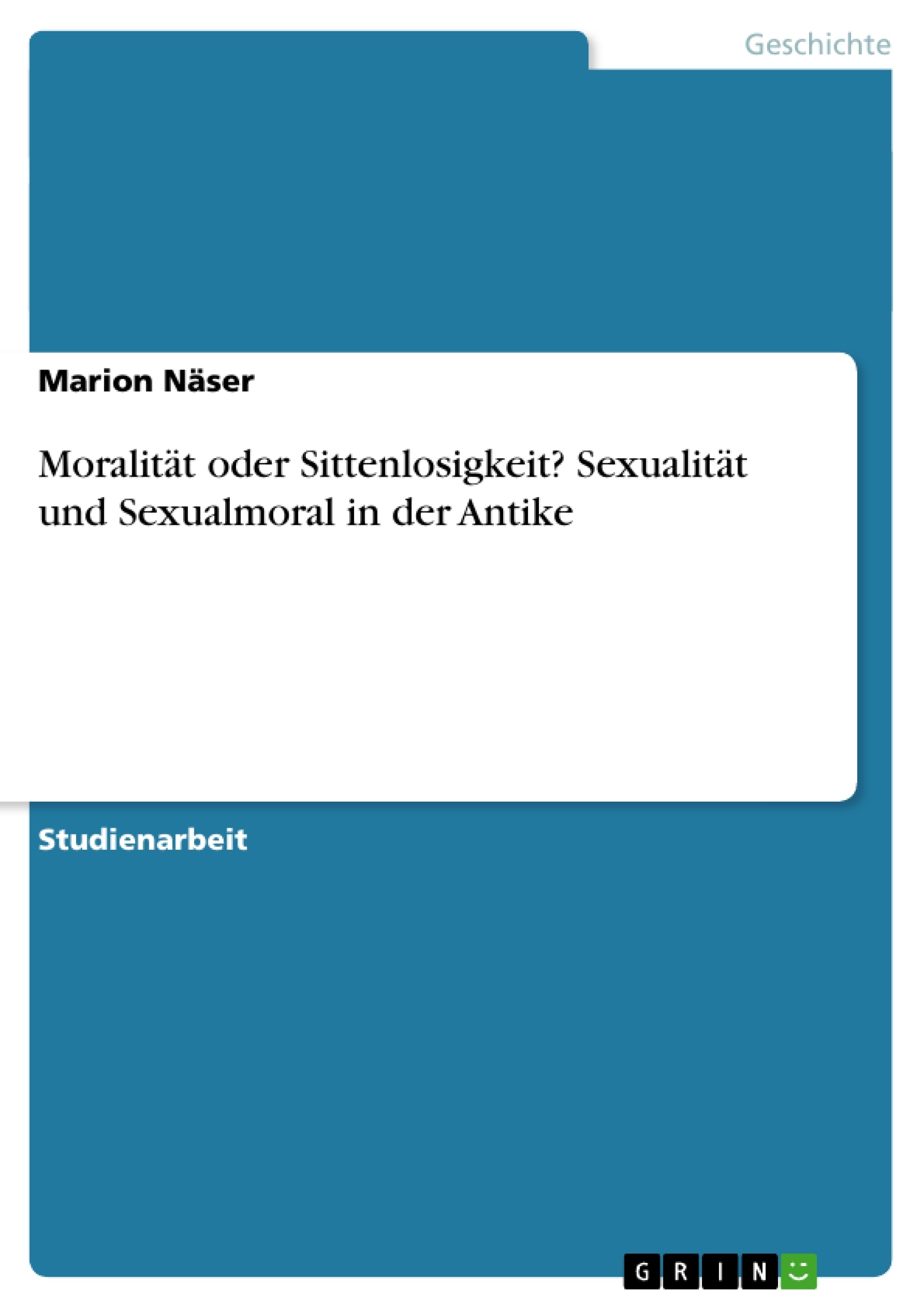Wie wird uns das römische Verhältnis zur Sexualität im Satyricon geschildert?
Das Satyricon des Petronius Arbiter stellt uns das erotische Leben im kaiserzeitlichen Rom
als zügellosen Sex ohne Liebe vor: Es gibt mannigfaltige Paarungen zwischen den drei Gefährten
und dem Kreis um Lycurg und Lichas, danach erleben unsere Helden noch verschiedene
erotische Abenteuer – ein zur oftmals zitierten römischen Sittenstrenge konträres Bild.
Zu beachten ist jedoch, daß sich die Figuren des Satyricon außerhalb der Gesellschaft befinden
und daß die Form der Satire Übertreibungen erfordert.
Aber auch die anderen Quellen zum Thema Sexualität sind von Ambivalenz geprägt:
Römische Grabinschriften preisen die Tugenden der keuschen Ehefrau1 – Graffiti an Häuserwänden
preisen die Dienste von Prostituierten an und dienen dem Weiterleiten von Liebesgrüßen
oder allgemeinen Stellungnahmen zu sexuellen Themen. In der Literatur gibt es auf
der einen Seite Moralisten wie Cicero, die den Sittenverfall beklagen und auf der anderen
Satiriker und zahlreiche erotische Werke von Dichtern wie Ovid, Horaz und Catull – die Erotikdichter
der Kaiserzeit beriefen sich jedoch auf literarische Traditionen, um sich zu rechtfertigen.
Im Rahmen der bildenden Kunst gab es viele erotische Darstellungen auf Vasen, Gefäßen und
Öllampen; zudem zahlreiche erotische Statuen und Wandmalereien in Bordellen und Thermen
in Privathäusern.
Auch der Umgang mit der Prostitution zeigt Sexualität als etwas Alltägliches: Es gab keine
schmuddeligen Vergnügungsviertel, sondern Bordelle und Straßenprostitution fanden sich
überall, wobei belebte, zentralen Punkte der Städte natürlich besonders beliebt für die Straßenprostitution
waren (so etwa Foren, Thermen oder Circusanlagen). Auch in Hotels, Restaurants,
Kneipen und Thermen war sie oft integriert. Der Umgang mit Prostituierten galt
nur bedingt als anstößig. Mit der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, die Widersprüche zwischen den verschiedenen
uns überlieferten Quellen auszuleuchten und zu einer Synthese zu führen, wobei der
Focus auf der frühen Kaiserzeit (also etwa zu Zeiten des Petronius) liegt.
Auf der einen Seite scheint man also mit Sexualität locker umzugehen, auf der anderen Seite
scheint es – wie wir sehen werden – eine Sexualmoral und feste Regeln für sexuelle Beziehungen
zu geben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung/Quellenlage
- 2. Sexualität in der Religion
- 3. „Sittenverfall“ vs. Moralität
- 3.1 Elemente des Sittenverfalls
- a) Dekadente Erscheinungen der römischen Kaiserzeit
- b) Praxis von Ehe und Scheidung in der Kaiserzeit
- 3.2 Elemente der Moralität
- a) Verhaltenskodizes für ehrbare Frauen
- b) Verfolgung von Ehebruch
- 3.1 Elemente des Sittenverfalls
- 4. Verständnis von Liebe und Sexualität
- 4.1 Sexualität als Ausdruck von Macht
- 4.2 Sexualität und Selbstbeherrschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die widersprüchlichen Quellen zum Thema Sexualität im römischen Reich der frühen Kaiserzeit und versucht, diese zu synthetisieren. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen einem scheinbar lockeren Umgang mit Sexualität und gleichzeitig existierenden Moralvorstellungen und Regeln sexueller Beziehungen.
- Das ambivalente Bild der römischen Sexualität in den Quellen
- Die Rolle der Religion in der Gestaltung des Verständnisses von Sexualität
- Die Aspekte des „Sittenverfalls“ in der römischen Kaiserzeit
- Die Elemente der Moralität und ihre Durchsetzung
- Das Verständnis von Liebe und Sexualität im Kontext von Macht und Selbstbeherrschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung/Quellenlage: Die Einleitung beleuchtet die divergierenden Darstellungen der römischen Sexualität, insbesondere im Kontrast zwischen dem zügellosen Sex im Satyricon des Petronius und den scheinbar strengeren Moralvorstellungen. Sie analysiert die Ambivalenz verschiedener Quellen, wie Grabinschriften, Graffiti und literarische Werke, die sowohl von Sittenverfall als auch von Moralvorstellungen zeugen. Die Einleitung weist auf die Bedeutung der unterschiedlichen Quellen und deren Interpretation hin und umreißt den Forschungsansatz der Arbeit, der sich auf die Widersprüche zwischen scheinbarer sexueller Lockerheit und gleichzeitig bestehenden Moralvorstellungen konzentriert.
2. Sexualität in der Religion: Dieses Kapitel untersucht die enge Verknüpfung von Sexualität und Religion im antiken Rom. Es zeigt, wie Sexualität, im Gegensatz zum christlichen Verständnis, nicht als Sünde, sondern als natürlicher Bestandteil des Lebens von Göttern und Menschen betrachtet wurde. Die Arbeit analysiert die Rolle von Gottheiten wie Zeus und Hera, sowie die Bedeutung von Fruchtbarkeitskulten, Tempelprostitution und die Verwendung des Phallus als Symbol. Es wird deutlich, wie Sexualität in Riten und Festen integriert war und eine positive, nicht moralisch verurteilende Rolle spielte. Die Kapitelbetrachtung veranschaulicht die tiefgreifende Integration der Sexualität in die religiöse Struktur und Weltanschauung des antiken Roms.
3. „Sittenverfall“ vs. Moralität: Dieses Kapitel analysiert gegensätzliche Aspekte der römischen Sexualmoral. Der Abschnitt „Elemente des Sittenverfalls“ diskutiert den Einfluss von Gladiatorenspielen, Mimus und der Verfügbarkeit von Sklaven auf die traditionellen ehelichen Beziehungen. Es zeigt, wie diese Faktoren zu einer Aufweichung sexueller Normen beitrugen. Der Abschnitt „Elemente der Moralität“ beleuchtet hingegen die Existenz von Verhaltenskodizes für Frauen und die Verfolgung von Ehebruch, die auf die Aufrechterhaltung bestimmter moralischer Standards hindeuten. Das Kapitel präsentiert somit ein komplexes Bild, das sowohl den „Sittenverfall“ als auch die gleichzeitige Existenz von Moralvorstellungen und deren Durchsetzung aufzeigt und deren Zusammenspiel beleuchtet.
Schlüsselwörter
Römische Sexualität, Sexualmoral, Antike, Petronius, Satyricon, Kaiserzeit, Religion, Mythologie, Sittenverfall, Moralität, Prostitution, Fruchtbarkeitskult, Macht, Selbstbeherrschung, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Römische Sexualität in der frühen Kaiserzeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die widersprüchlichen Quellen zum Thema Sexualität im römischen Reich der frühen Kaiserzeit und versucht, diese zu synthetisieren. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen einem scheinbar lockeren Umgang mit Sexualität und gleichzeitig existierenden Moralvorstellungen und Regeln sexueller Beziehungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das ambivalente Bild der römischen Sexualität, die Rolle der Religion im Verständnis von Sexualität, Aspekte des „Sittenverfalls“, Elemente der Moralität und deren Durchsetzung, sowie das Verständnis von Liebe und Sexualität im Kontext von Macht und Selbstbeherrschung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit analysiert diverse Quellen, darunter Grabinschriften, Graffiti und literarische Werke wie das Satyricon des Petronius. Die Ambivalenz dieser Quellen und deren unterschiedliche Interpretationen werden berücksichtigt.
Wie wird die Rolle der Religion dargestellt?
Das Kapitel zur Religion zeigt, dass Sexualität im antiken Rom, im Gegensatz zum christlichen Verständnis, nicht als Sünde, sondern als natürlicher Bestandteil des Lebens von Göttern und Menschen betrachtet wurde. Die Rolle von Gottheiten, Fruchtbarkeitskulten, Tempelprostitution und die Symbolik des Phallus werden analysiert.
Wie wird der „Sittenverfall“ beschrieben?
Der „Sittenverfall“ wird im Kontext von Gladiatorenspielen, Mimus und der Verfügbarkeit von Sklaven diskutiert, die als Faktoren für eine Aufweichung sexueller Normen betrachtet werden.
Wie werden die Elemente der Moralität dargestellt?
Die Elemente der Moralität werden anhand von Verhaltenskodizes für Frauen und der Verfolgung von Ehebruch beleuchtet, die auf die Aufrechterhaltung bestimmter moralischer Standards hindeuten.
Wie werden Liebe und Sexualität im Kontext von Macht und Selbstbeherrschung betrachtet?
Die Arbeit untersucht, wie Sexualität als Ausdruck von Macht verstanden wurde und welche Rolle Selbstbeherrschung spielte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung/Quellenlage, Sexualität in der Religion, „Sittenverfall“ vs. Moralität, und Verständnis von Liebe und Sexualität. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Themen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römische Sexualität, Sexualmoral, Antike, Petronius, Satyricon, Kaiserzeit, Religion, Mythologie, Sittenverfall, Moralität, Prostitution, Fruchtbarkeitskult, Macht, Selbstbeherrschung, Quellenkritik.
Wie ist der Forschungsansatz der Arbeit?
Der Forschungsansatz konzentriert sich auf die Widersprüche zwischen scheinbarer sexueller Lockerheit und gleichzeitig bestehenden Moralvorstellungen.
- Quote paper
- M.A. Marion Näser (Author), 2000, Moralität oder Sittenlosigkeit? Sexualität und Sexualmoral in der Antike, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7155