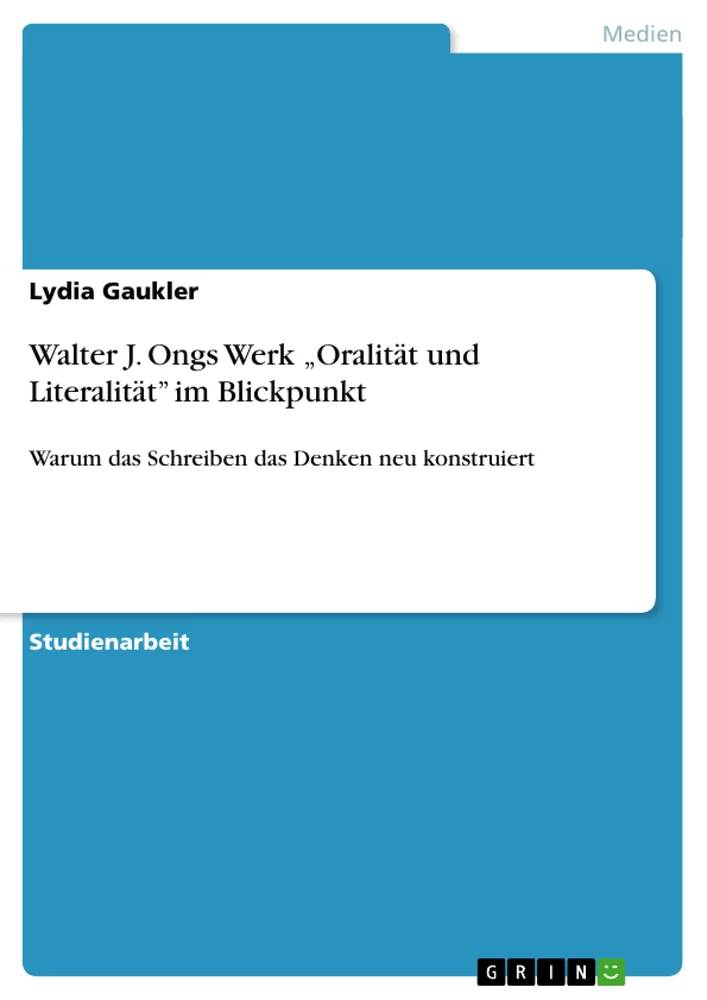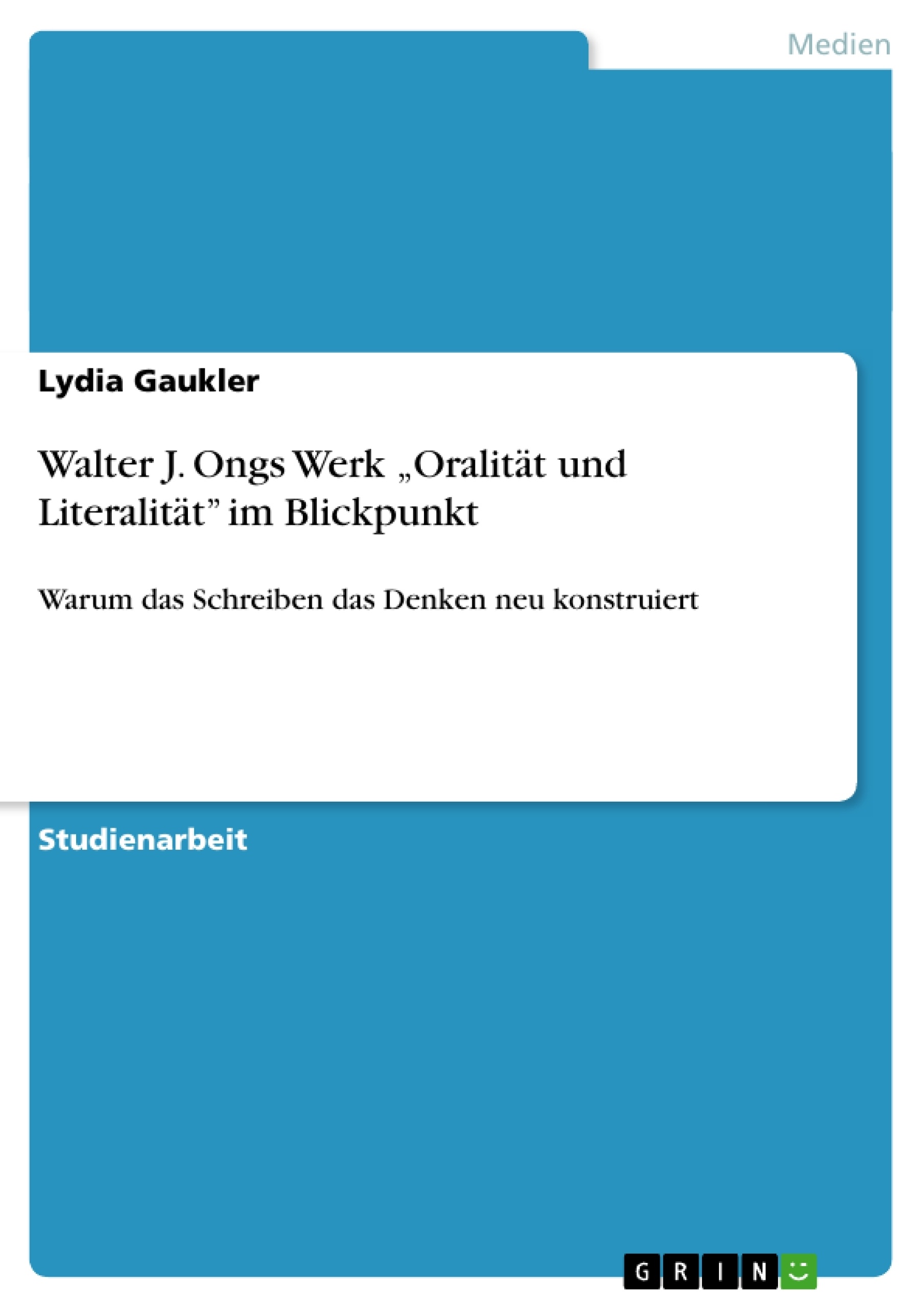Vor etwa 17000 Jahren tauchten die Höhlenmalereien auf. In diesen ersten Bildern fixierten die Steinzeitmenschen Dinge, die sie bewegten: Gegenstände oder Lebewesen aus ihrer unmittelbaren Umgebung, aber auch Darstellungen des Übernatürlichen. Der erste Gebrauch von Schrift diente daher weniger der Dokumentation oder der Erinnerung; vielmehr diente er der Verbindung zwischen eigener Realität und anderen Welten. Zwischen den ersten auf Felswänden aufgemalten Zeichnungen bis hin zu multimedialen Texten im 21. Jahrhundert hat sich die Schrift sowohl optisch als auch hinsichtlich ihrer Bedeutung und Funktion stark gewandelt. Der Frage nachzugehen, inwiefern Schrift auch im Zeitalter der digitalen Medien eine Rolle spielt, wird Inhalt folgender Arbeit sein.
In seinem berühmten Werk „Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes.” stellt Walter J. Ong die These auf, das Schreiben konstruiere das Denken neu. Wie keine andere Technologie habe das Schreiben unser Bewusstsein und unser Denken verändert, so Ongs Behauptung.
Folgende Arbeit wird sich mit der Bedeutung der Schrift näher auseinanderset-zen und dabei versuchen zu erklären, ob und inwieweit das Schreiben unser Denken neu konstruiert. Die Arbeit wird sich weitestgehend chronologisch an Ongs Werk orientieren, jedoch auch einige neue Aspekte einbringen. So wird im achten Kapitel der Begriff des kulturellen Gedächtnisses eingeführt, anhand dessen Ongs Thesen bestätigt werden sollen. Im neunten Kapitel sollen Ongs Thesen mit jenen von Eric A. havelock kontrastiert werden. Zentraler Kern der Arbeit ist die Frage, ob und inwiefern das Schreiben unser Denken beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ongs „Oralität und Literalität“
- Platons Schriftkritik
- Das Schreiben als Technologie
- Was ist Schrift?
- Die Geschichte der Schrift
- Die Leistung der Schrift
- Schrift und kulturelles Gedächtnis
- Warum die Schrift das Denken neu konstruiert
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Walter J. Ongs These, dass das Schreiben das Denken neu konstruiert, im Kontext seines Werkes „Oralität und Literalität“. Die Analyse beleuchtet den Einfluss der Schrift auf das menschliche Bewusstsein und die Denkprozesse. Dabei wird die Arbeit weitestgehend chronologisch Ongs Argumentation folgen, aber auch zusätzliche Aspekte einbringen.
- Der Einfluss der Schrift auf das menschliche Denken
- Platons Kritik an der Schrift und deren Relevanz für Ongs These
- Die Schrift als Technologie und deren Auswirkungen auf die Kommunikation
- Der Begriff des kulturellen Gedächtnisses im Zusammenhang mit Schriftlichkeit
- Ein Vergleich der Thesen Ongs mit denen anderer Autoren (z.B. Havelock)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These von Walter J. Ongs Werk „Oralität und Literalität“ vor: Das Schreiben konstruiert das Denken neu. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese These zu untersuchen und zu beleuchten, inwieweit und ob die Schrift unser Denken tatsächlich umgestaltet hat. Es wird eine chronologische Auseinandersetzung mit Ongs Werk angekündigt, ergänzt um zusätzliche Aspekte wie den Begriff des kulturellen Gedächtnisses und einen Vergleich mit den Thesen von Eric A. Havelock.
Ongs „Oralität und Literalität“: Dieses Kapitel präsentiert Ongs Kernthese: Die Erfindung der Schrift geht über die Funktion eines bloßen technischen Hilfsmittels hinaus; sie hat die menschlichen Denkweisen grundlegend verändert. Ong argumentiert, dass die Schrift einen autonomen Diskurs ermöglicht, der im Gegensatz zur mündlichen Kommunikation nicht unmittelbar befragt oder angezweifelt werden kann. Diese Distanz zwischen Autor und Inhalt ist ein zentraler Punkt in Ongs Argumentation, der im weiteren Verlauf der Arbeit vertieft wird. Die Arbeit erwähnt die unterschiedlichen Bewertungen dieser Distanz im Laufe der Geschichte.
Platons Schriftkritik: Hier wird Platons Kritik an der Schrift behandelt. Platon sieht die Schrift als Ursache für Gedächtnisschwäche, da sie die innere Selbstbesinnung durch externes Wissen ersetzt. Weiterhin kritisiert er die Schrift als verdinglicht, unmenschlich und als Produzent vermeintlichen Wissens. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Unfähigkeit der Schrift, auf Fragen zu antworten oder sich gegen Kritik zu verteidigen. Ong selbst analysiert diese Kritik und betont die Ironie, dass Platon seine Einwände schriftlich formulieren musste – ein Beweis für die Macht der Schrifttechnologie selbst.
Schlüsselwörter
Oralität, Literalität, Schrift, Denken, Technologie, Kommunikation, Platon, Walter J. Ong, kulturelles Gedächtnis, Diskurs, Autorität.
Häufig gestellte Fragen zu „Oralität und Literalität“
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Walter J. Ongs These, dass die Schrift das Denken neu konstruiert, im Kontext seines Werkes „Oralität und Literalität“. Analysiert wird der Einfluss der Schrift auf das menschliche Bewusstsein und die Denkprozesse. Die Arbeit folgt weitestgehend chronologisch Ongs Argumentation und erweitert diese um zusätzliche Aspekte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der Schrift auf das menschliche Denken, Platons Kritik an der Schrift und deren Relevanz für Ongs These, die Schrift als Technologie und deren Auswirkungen auf die Kommunikation, den Begriff des kulturellen Gedächtnisses im Zusammenhang mit Schriftlichkeit und vergleicht die Thesen Ongs mit denen anderer Autoren (z.B. Havelock).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die Ongs zentrale These vorstellt und die Ziele der Arbeit umreißt. Das Kapitel zu Ongs "Oralität und Literalität" präsentiert seine Kernthese: Die Schrift verändert grundlegend menschliche Denkweisen. Das Kapitel zu Platons Schriftkritik behandelt dessen Kritik an der Schrift als Ursache für Gedächtnisschwäche und deren Unfähigkeit zur Selbstverteidigung. Weitere Kapitel befassen sich mit der Schrift als Technologie, dem kulturellen Gedächtnis und einem Fazit sowie Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind Oralität, Literalität, Schrift, Denken, Technologie, Kommunikation, Platon, Walter J. Ong, kulturelles Gedächtnis, Diskurs und Autorität.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Der Aufbau ist im Wesentlichen chronologisch und folgt der Argumentationslinie von Walter J. Ong. Es beginnt mit einer Einleitung, die die These und die Ziele der Arbeit erläutert, gefolgt von Kapiteln zu Ongs Werk, Platons Schriftkritik, der Schrift als Technologie und dem kulturellen Gedächtnis. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick.
Welche zusätzlichen Aspekte werden neben Ongs Argumentation behandelt?
Neben Ongs Argumentation werden zusätzliche Aspekte wie der Begriff des kulturellen Gedächtnisses und ein Vergleich mit den Thesen anderer Autoren, insbesondere Eric A. Havelock, eingebracht.
Wie wird Platons Schriftkritik in der Arbeit behandelt?
Platons Kritik an der Schrift wird als wichtiger Bestandteil der Argumentation behandelt. Platon sieht in der Schrift eine Ursache für Gedächtnisschwäche und kritisiert ihre Unfähigkeit, auf Fragen zu antworten oder sich zu verteidigen. Die Arbeit analysiert diese Kritik und betont die Ironie, dass Platon seine Kritik schriftlich formulierte.
- Quote paper
- Lydia Gaukler (Author), 2006, Walter J. Ongs Werk „Oralität und Literalität” im Blickpunkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71527