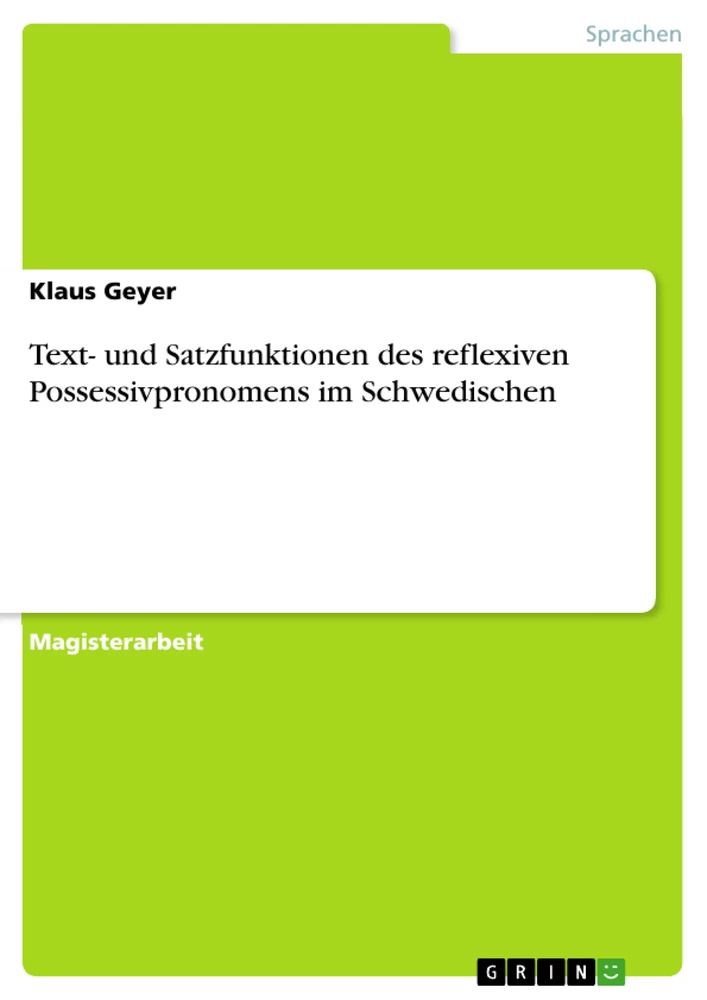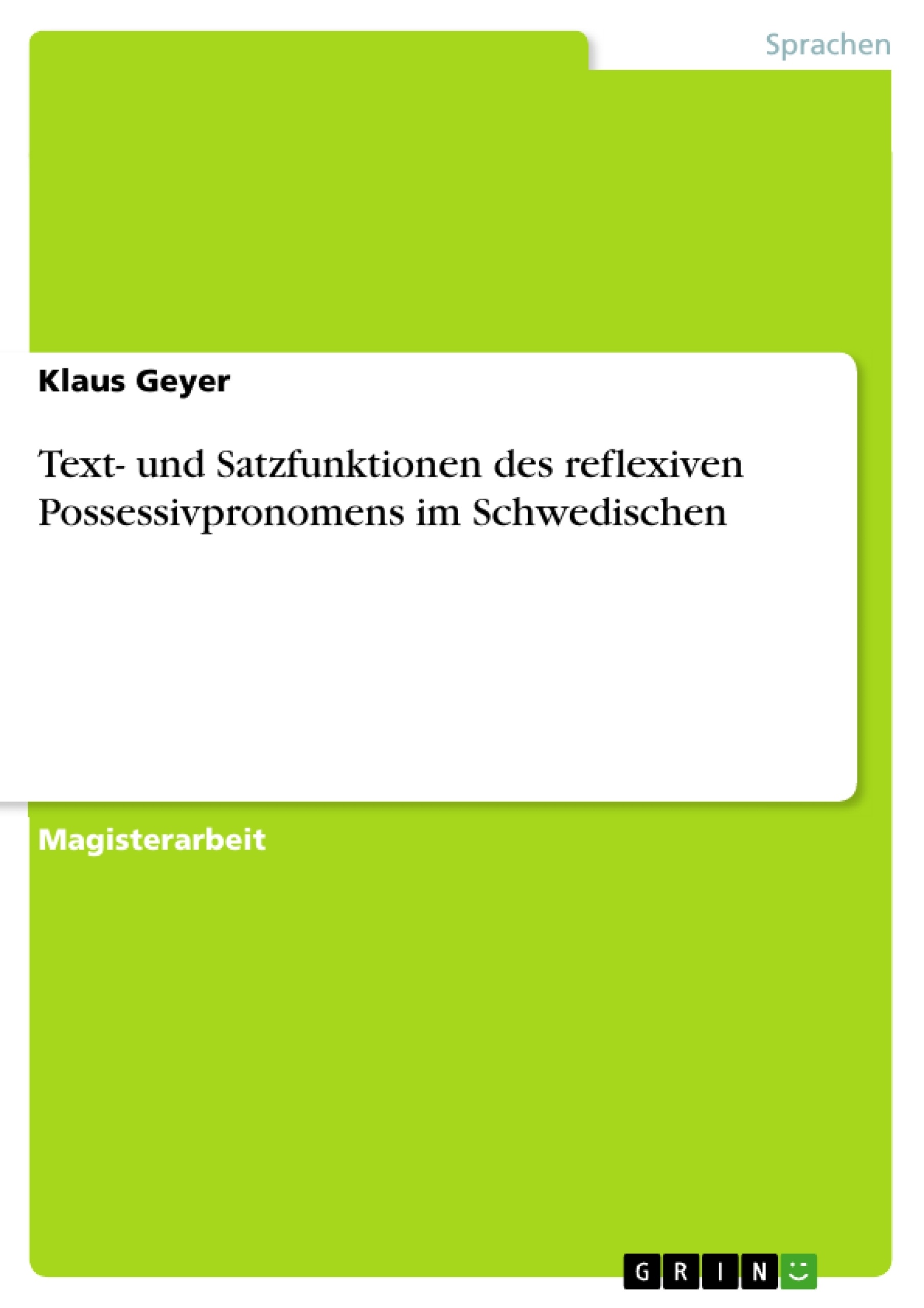1.1 Reflexives und nicht-reflexives Possessivpronomen: eine Skizze
Im Schwedischen gibt es - im Gegensatz zum Deutschen - zwei Possessivpronomina; sie werden
i.a. als reflexives Possessivpronomen [im folgenden: RP] und als nicht-reflexives Possessivpronomen
[im folgenden: NRP] bezeichnet.
In diesem ersten Abschnitt soll grob skizziert werden, wodurch sich die beiden Possessivpronomina
unterscheiden. Ausgangspunkt der Überlegung ist der folgende deutsche Satz (1.1):
(1.1) Sieh nur, jetzt gießt der Svensson seine Blumen!
Das Possessivpronomen seine in (1.1) hat zwei mögliche Lesarten:
i) Svensson ist das Korrelat von seine; diese ist die bevorzugte Lesart, wenn Satz (1.1) isoliert
auftritt. Semantisch bedeutet diese Lesart, daß Svensson auch der Possessor der Blumen (= des
Possessums) ist;
ii) seine bezieht sich auf einen anderen Ausdruck, z.B. wie in (1.2) auf eine NP im
vorausgehenden Satz (Karlsson); Svensson ist dann nicht der Possessor der Blumen:
(1.2) Dem Karlsson helfen alle Nachbarn gerne im Garten. Sieh nur, jetzt gießt
der Svensson seine Blumen!
Die Entsprechung von (1.1) im Schwedischen läßt keine Ambiguität hinsichtlich des Possessivpronomens
zu. Auch ohne Kontext wird klar, ob Svensson der Possessor ist oder ein anderer.
Hierfür stehen zwei verschiedene Possessivpronomina zur Wahl: Ist im Beispiel Svensson der
Possessor der Blumen, steht das RP, ist irgendein anderer, z.B. Karlsson in (1.2), der Possessor,
steht das NRP. Satz (1.3) enthält das RP.PL sina. Korrelat des RP ist das Satzsubjekt Svensson,
womit eindeutig Svensson als Possessor identifiziert wird.
Die Koreferenz von Possessivpronomen und Korrelat wird hier und im weiteren durch Halbfettdruck
markiert.
(1.3) Titta bara, nu vattnar Svensson sina blommor!
sieh nur jetzt gießt S. RP.PL Blume.PL
‘Sieh nur, jetzt gießt der Svensson seine (= Svenssons) Blumen.’ [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Reflexives und nicht-reflexives Possessivpronomen: eine Skizze
- 1.2 Ziel und Skopus der Arbeit
- 1.3 Struktur der Arbeit
- 2 Über Reflexivität und reflexive Possessivpronomina
- 2.1 Semantische, morphologische und explizite Reflexivität
- 2.2 Explizite reflexive Konstruktion und reflexives Possessivpronomen
- 2.2.1 Das Instrumentarium zur Beschreibung
- 2.2.2 Syntaktische Ähnlichkeiten zwischen possessiven und personalen Reflexivpronomina
- 2.2.3 Morphologische Ähnlichkeiten zwischen possessiven und personalen Reflexivpronomina
- 2.3 Reflexive Possessivpronomina in den nordgermanischen Sprachen und in den Sprachen der Welt: ergänzende Hinweise
- 3 Die Syntax des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen
- 3.1 Charakterisierung der ausgewerteten Literatur
- 3.2 Zur Reichweite der reflexiven Possessivpronomina: Bezugsrahmen und Prädikation
- 3.3 Nicht-prototypische Bezugsrahmen des reflexiven Possessivpronomens
- 3.3.1 Konstruktionen mit Nomen actionis
- 3.3.2 Konstruktionen mit Nomen agentis
- 3.3.3 Konstruktionen mit attributiver Adjektiv- oder Partizipphrase
- 3.3.4 Konstruktionen mit med-Attribut
- 3.3.5 Konstruktionen mit Apposition
- 3.3.6 Konstruktionen mit Komparativausdruck
- 3.3.7 Konstruktionen mit Infinitivphrase
- 3.3.8 Konstruktionen mit Prädikativphrase
- 3.3.9 Konstruktionen mit Nicht-Subjekt-Satzgliedern - ohne Prädikation
- 3.3.10 Konstruktionen mit „unechten“ Präpositionen
- 3.3.11 Konstruktionen mit 2 finiten Sätzen
- 3.4 Ergänzende Beobachtungen zum prototypischen Bezugsrahmen
- 3.4.1 Präsentierungskonstruktion
- 3.4.2 Markierte Reihenfolge von Korrelat und reflexivem Possessivpronomen
- 3.5 Zusammenfassung: syntaktische Präferenzen und Restriktionen
- 3.5.1 Syntaktische Präferenzen: Zur Effektivität der nicht-prototypischen Bezugsrahmen
- 3.5.2 Syntaktische Restriktionen: Hierarchien der möglichen Korrelate von reflexiven Possessivpronomina
- 4 Jenseits der Syntax
- 4.1 Semantische Faktoren: Belebtheit des Possessors
- 4.1.1 Hierarchie der möglichen RP-Korrelate vs. Hierarchie der syntaktischen Funktionen
- 4.1.2 Der Test von DAHL 1980
- 4.1.2.1 Testaufbau
- 4.1.2.2 Testergebnisse
- 4.2 Zur Bedeutung der Textgrammatik
- 4.2.1 HELLBERGS Begriff des Textsubjekts
- 4.2.1.1 Empathie nach KUNO & KABURAKI 1977 bzw. KUNO 1987
- 4.2.1.2 Von der Empathie zum Textsubjekt
- 4.2.1.3 Merkmale von Textsubjekten
- 4.2.1.4 Auswirkungen von Textsubjekten auf reflexive Possessivpronomina
- 4.2.2 Prominenter Partizipant
- 4.3 Weitere nicht-syntaktische Faktoren: die Umstände der Äußerung
- 5 Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Text- und Satzfunktionen des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen. Das Hauptziel besteht darin, die syntaktischen und semantischen Bedingungen für die Verwendung dieses Pronomens zu beschreiben und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion zwischen syntaktischen Strukturen, semantischen Faktoren und textgrammatischen Aspekten.
- Syntaktische Bedingungen für den Gebrauch des reflexiven Possessivpronomens
- Semantische Faktoren wie die Belebtheit des Possessors
- Einfluss der Textgrammatik auf die Verwendung des Pronomens
- Nicht-prototypische Bezugsrahmen des reflexiven Possessivpronomens
- Vergleich mit anderen nordgermanischen Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einführende Kapitel skizziert den Unterschied zwischen reflexiven und nicht-reflexiven Possessivpronomina und legt die Zielsetzung und den Umfang der Arbeit dar. Es beschreibt den Aufbau und die Struktur der folgenden Kapitel und liefert eine prägnante Übersicht über den Forschungsansatz.
2 Über Reflexivität und reflexive Possessivpronomina: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der Reflexivität und beleuchtet semantische, morphologische und explizite Aspekte reflexiver Konstruktionen. Es vergleicht reflexive Possessivpronomina mit personalen Reflexivpronomina hinsichtlich ihrer syntaktischen und morphologischen Eigenschaften, unter Einbezug von Beispielen aus verschiedenen Sprachen.
3 Die Syntax des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen: Dieses zentrale Kapitel analysiert die Syntax des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen. Es charakterisiert die verwendete Literatur, untersucht den Bezugsrahmen und die Prädikation, und widmet sich detailliert den nicht-prototypischen Bezugsrahmen des Pronomens in verschiedenen Konstruktionen. Die Analyse umfasst Konstruktionen mit Nomen actionis und agentis, attributiven Phrasen, med-Attributen, Appositionen, Komparativen, Infinitivphrasen, Prädikativphrasen, sowie Konstruktionen mit Nicht-Subjekt-Satzgliedern und "unechten" Präpositionen. Die Kapitel gipfelt in einer Zusammenfassung der syntaktischen Präferenzen und Restriktionen.
4 Jenseits der Syntax: Dieses Kapitel erweitert die Analyse über rein syntaktische Aspekte hinaus. Es untersucht semantische Faktoren wie die Belebtheit des Possessors und deren Einfluss auf die Wahl des Pronomens. Der Einfluss der Textgrammatik und der Begriff des Textsubjekts nach Hellberg werden ausführlich diskutiert, ebenso wie der Einfluss prominenter Partizipanten und die Rolle der Äußerungsumstände.
Schlüsselwörter
Reflexives Possessivpronomen, Schwedisch, Syntax, Semantik, Textgrammatik, Reflexivität, Bezugsrahmen, Prädikation, Nordgermanische Sprachen, DAHL-Test, Textsubjekt, Empathie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Reflexive Possessivpronomina im Schwedischen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die syntaktischen und semantischen Bedingungen für den Gebrauch reflexiver Possessivpronomina im Schwedischen. Sie analysiert die Interaktion zwischen Syntax, Semantik und Textgrammatik bei der Verwendung dieser Pronomen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: die syntaktischen Bedingungen für den Gebrauch reflexiver Possessivpronomina, semantische Faktoren wie die Belebtheit des Possessors, den Einfluss der Textgrammatik, nicht-prototypische Bezugsrahmen des Pronomens, und einen Vergleich mit anderen nordgermanischen Sprachen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Zielsetzung und Struktur der Arbeit), Reflexivität und reflexive Possessivpronomina (semantische, morphologische und explizite Aspekte), Syntax des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen (detaillierte syntaktische Analyse verschiedener Konstruktionen), Jenseits der Syntax (semantische und textgrammatische Faktoren), und Ergebnisse und Ausblick.
Wie wird die Syntax der reflexiven Possessivpronomina im Schwedischen analysiert?
Kapitel 3 analysiert detailliert die Syntax im Schwedischen. Es untersucht den Bezugsrahmen und die Prädikation und beschreibt verschiedene nicht-prototypische Bezugsrahmen in Konstruktionen mit Nomen actionis und agentis, attributiven Phrasen, med-Attributen, Appositionen, Komparativen, Infinitivphrasen, Prädikativphrasen, Nicht-Subjekt-Satzgliedern, "unechten" Präpositionen und Konstruktionen mit zwei finiten Sätzen. Die Analyse endet mit einer Zusammenfassung syntaktischer Präferenzen und Restriktionen.
Welche semantischen und textgrammatischen Faktoren werden berücksichtigt?
Kapitel 4 erweitert die Analyse über die Syntax hinaus. Es untersucht die Rolle der Belebtheit des Possessors, den Einfluss der Textgrammatik (insbesondere den Begriff des Textsubjekts nach Hellberg und den Einfluss prominenter Partizipanten), sowie den Einfluss der Umstände der Äußerung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus syntaktischer und semantischer Analyse, unter Einbezug von Beispielen aus dem Schwedischen und anderen Sprachen. Der DAHL-Test wird zur Untersuchung der Belebtheit des Possessors eingesetzt. Die Analyse berücksichtigt auch textgrammatische Aspekte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Reflexives Possessivpronomen, Schwedisch, Syntax, Semantik, Textgrammatik, Reflexivität, Bezugsrahmen, Prädikation, Nordgermanische Sprachen, DAHL-Test, Textsubjekt, Empathie.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, insbesondere für diejenigen, die sich mit Syntax, Semantik und Textgrammatik des Schwedischen oder der nordgermanischen Sprachen befassen. Sie ist auch für Studierende der Linguistik und vergleichender Sprachwissenschaft von Interesse.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Arbeit enthält detaillierte Analysen und Beispiele. (Hinweis: Der Link zur vollständigen Arbeit fehlt hier und müsste ergänzt werden, wenn verfügbar.)
- Quote paper
- Dr. Klaus Geyer (Author), 1998, Text- und Satzfunktionen des reflexiven Possessivpronomens im Schwedischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7146