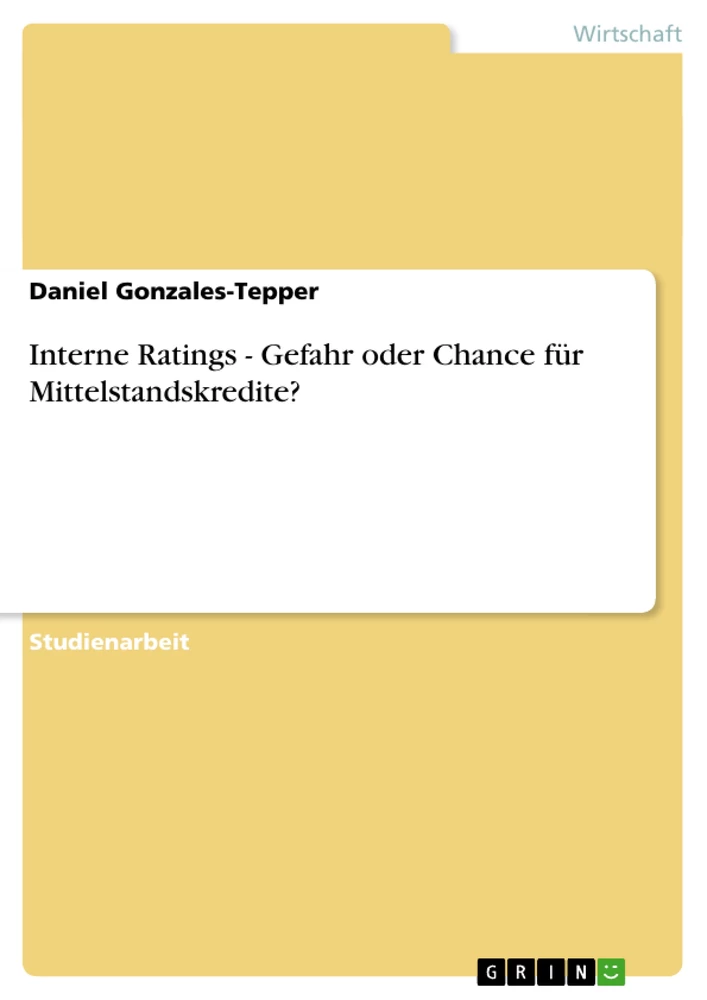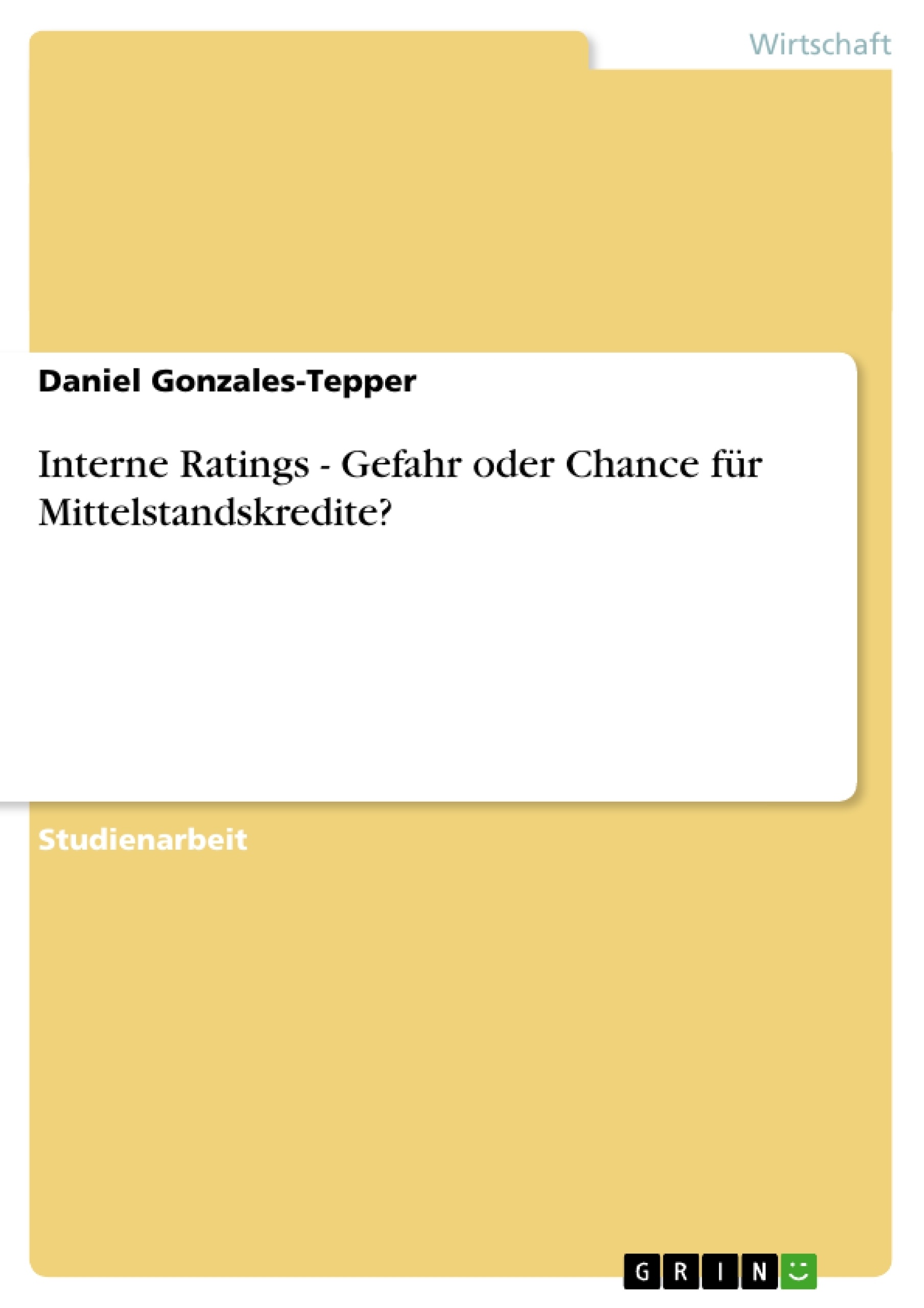Bisher stützte sich die Kreditwürdigkeitsprüfung der Banken im Wesentlichen auf die Analyse der wirtschaftlichen Lage. Durch Vorlage von Jahresabschlüssen der Vorjahre, ergänzt durch aktuelle Zahlen, wurde das Risiko des Kredits eingestuft. Durch die Neuregelung der Eigenkapitalausstattung für Banken durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel II) rückt die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens stärker ins Blickfeld. Dazu gehören beispielsweise die Unternehmensstrategie, die Managementqualität, die Innovationskraft oder das Marktumfeld, die sich nicht aus den Bilanzen ablesen lassen. Bei Ratings werden solche qualitativen Fakten mit quantitativen Daten verknüpft. Dadurch entsteht eine ganzheitliche Gesamtsicht auf das Unternehmen, die nicht nur die Verhältnisse des Unternehmens, sondern auch z.B. das Marktumfeld bewertet.
Doch die Ratings werden bzw. wurden speziell durch den deutschen Mittelstand mit Skepsis betrachtet. Die Angst geht (bzw. ging) um, Ratings könnten den enorm wichtigen Weg der Kreditfinanzierung für klein- und mittelgroße Unternehmen (KMU) blockieren. Bei der Finanzierung von Mittelstandsinvestitionen kommt Bankkrediten eine überragende Bedeutung zu. 27,5 Prozent der Unternehmen halten Kredite für unverzichtbar, weitere 33,9 Prozent für sehr wichtig. Vor allem bei Kleinstunternehmen mit einer Zahl von 1 bis 4 Mitarbeitern und einem Umsatz von unter 250.000 Euro, deren Zahl zwischen 2001 und 2005 von 45,7 auf 48,6 Prozent gestiegen ist , ist (bzw. war) die Sorge groß. Hat der Mittelstand Sorgen, ist die Gefahr der Ausbreitung auf die gesamte Wirtschaft groß. Schließlich repräsentieren die rund 4 Millionen selbständigen Mittelständler in Deutschland 2005 über 70 Prozent aller Arbeitsplätze und 82 Prozent aller Lehrstellen. Knapp 49 Prozent der Wertschöpfung, was rund 1.100 Milliarden Euro entspricht, wird vom Mittelstand erbracht.
Diese Arbeit soll in Anrissen zeigen, welche Daten beim internen Rating untersucht werden, um dadurch Ängsten zu begegnen. Denn ein in der Literatur immer wieder genannter Vorteil von Basel II ist zukünftig die Möglichkeit für Kreditnehmer, Kreditkonditionen aktiv mitbestimmen zu können und dadurch unmittelbar den Unternehmenserfolg zu beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage für die Kreditinstitute
- Definition „Rating“ – wofür das ganze?
- Ablauf eines (internen) Rating
- Soll-/Ist-Analyse – Die Gegebenheiten im Mittelstand in Deutschland
- Problemanalyse und Lösungsansätze
- Rating in der Praxis – das Beispiel Sparkasse der Stadt Straelen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Thesenpapier beschäftigt sich mit dem Thema der internen Ratings und deren Bedeutung für die Kreditvergabe an den Mittelstand im Kontext von Basel II. Es soll die Relevanz von Ratings für Kreditinstitute beleuchten und die Befürchtungen des Mittelstands hinsichtlich der Auswirkung von Ratings auf die Kreditfinanzierung diskutieren. Die Arbeit zielt darauf ab, die relevanten Faktoren für interne Ratings darzustellen und durch praktische Beispiele aus der Finanzwelt zu verdeutlichen.
- Die Bedeutung von internen Ratings im Kontext von Basel II
- Die Befürchtungen des Mittelstands bezüglich interner Ratings
- Die relevanten Faktoren für interne Ratings
- Praktische Beispiele für interne Ratings
- Die Auswirkungen von internen Ratings auf die Kreditvergabe
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert die veränderte Rolle der Kreditwürdigkeitsprüfung im Kontext von Basel II und beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Ratings für die Bewertung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Sie stellt die Sorgen des Mittelstands hinsichtlich der Auswirkungen von Ratings auf die Kreditvergabe dar.
- Kapitel 2 beleuchtet die Ausgangslage für Kreditinstitute im Zuge von Basel II und betont die Notwendigkeit von Ratings zur Risikoeinschätzung und angemessenen Eigenkapitalunterlegung. Die Kapitel diskutiert auch die verschiedenen Prüfkriterien, die bei der Risikoeinschätzung berücksichtigt werden müssen.
- Kapitel 3 definiert den Begriff „Rating“ und erläutert die Unterscheidung zwischen externen und internen Ratings. Es wird außerdem dargestellt, welche Informationen ein Rating liefert und welche Faktoren bei der Bewertung der zukünftigen Kapitaldienstfähigkeit berücksichtigt werden.
- Kapitel 4 beschreibt den Ablauf eines internen Ratings und erläutert die Schritte, die bei der Erstellung eines Ratings durchlaufen werden. Die Kapitel geht auf die Bedeutung der Datenerhebung, der Datenanalyse und der Interpretation der Ergebnisse ein.
- Kapitel 5 analysiert die Besonderheiten des Mittelstands in Deutschland und stellt die relevanten Punkte dar, die bei der Erstellung eines internen Ratings für Mittelstandsunternehmen berücksichtigt werden sollten. Die Kapitel zeigt auf, wie die spezifischen Herausforderungen des Mittelstands bei der Finanzierung berücksichtigt werden können.
- Kapitel 6 diskutiert die Problematik der Anwendung von Ratings im Kontext des Mittelstands und präsentiert Lösungsansätze, die die Kreditvergabe an den Mittelstand verbessern und gleichzeitig die Anforderungen von Basel II erfüllen können. Die Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung einer transparenten und nachvollziehbaren Ratingmethode.
- Kapitel 7 stellt die Anwendung von Ratings in der Praxis anhand des Beispiels der Sparkasse der Stadt Straelen vor. Die Kapitel zeigt auf, wie die Bank Ratings zur Risikoeinschätzung und Kreditvergabe an Unternehmen einsetzt und wie die Ergebnisse in die Kreditentscheidung einfließen.
Schlüsselwörter
Interne Ratings, Basel II, Mittelstand, Kreditvergabe, Risikoeinschätzung, Zukunftsfähigkeit, Kapitaldienstfähigkeit, Kreditfinanzierung, Datenanalyse, Unternehmenserfolg, Probability-of-default (PD), Expected-Default-Frequency (EDF), Loss-Given-Default (LGD), Kreditportfolio.
- Arbeit zitieren
- Daniel Gonzales-Tepper (Autor:in), 2006, Interne Ratings - Gefahr oder Chance für Mittelstandskredite?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71368