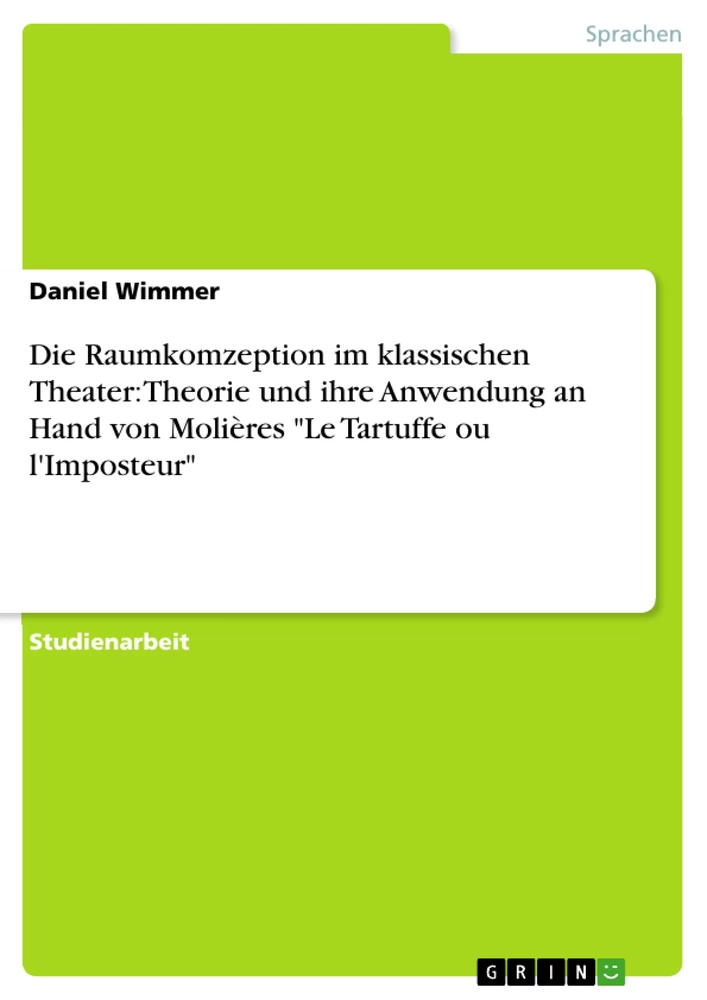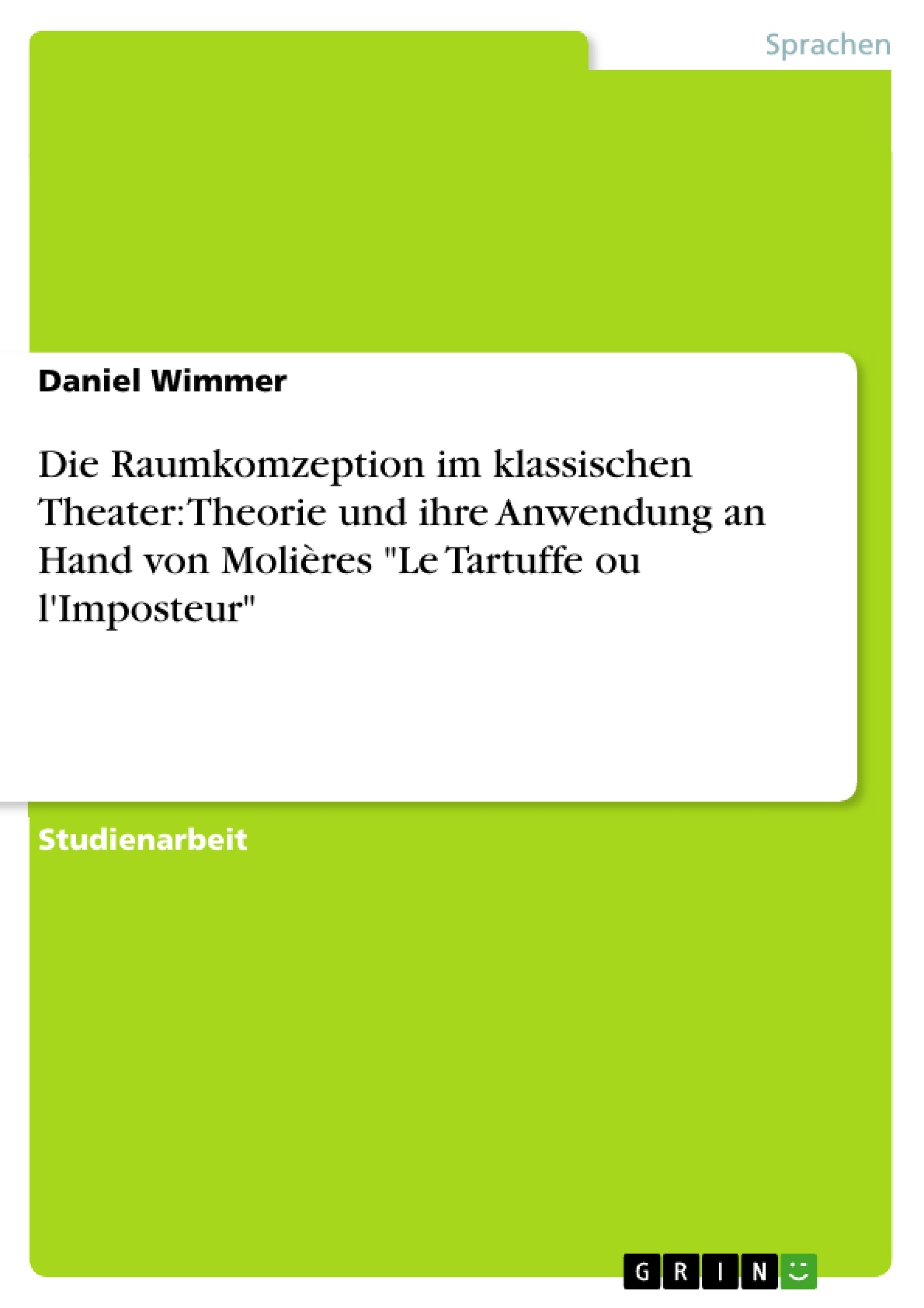Gegenstand dieser Hausarbeit ist die Raumkonzeption für die Inszenierung eines Dramas. Um in diesen Themenbereich einsteigen zu können, muss man sich zunächst das Begrifffeld abstecken. Welche Unterbereiche berührt das Thema Raumkonzeption? Welche Arten von Inszenierungen gibt es, worauf gründen ihre Konzepte, wie werden sie umgesetzt? Wie muss eine Bühne beschaffen sein, um eine bestimmte Inszenierungsart realisieren zu können? Wie nimmt man als Zuschauer eine Aufführung wahr und ist diese Wahrnehmung vom Dramatiker gewollt? Dient die Bühne als Reflektionsraum für das Bewusstsein der Figuren oder geht es nur um das Abbild eines realen Raumes? Als Zuschauer oder auch als Leser eines Dramas nehmen wir unbewusst Informationen auf und verarbeiten sie in einer Weise, sodass uns der Dramatiker in unserer Wahrnehmung lenken kann. Und um diese Informationsvermittlung über das Medium Raum und seine Gestaltung soll es in meiner Hausarbeit gehen.
In meiner Hausarbeit definiere ich zunächst den Begriff „Dramatischer Raum“. Das Verständnis dieses Begriffes in seinen zwei Inhaltsebenen ist elementar wichtig, um meinen weiteren Ausführungen in dieser Hausarbeit folgen zu können. Anschließend gehe ich auf die Möglichkeiten der Raumkonzeption ein. Man kann den fiktiven Ort eines Dramas auf verschiedene Arten optisch im realen Raum umsetzen. Jede Art hat eine andere Funktion und möchte dem Zuschauer einen anderen Aspekt des Schauspiels näher bringen. Um dies zu erreichen bedient sich der Regisseur auch verschiedener Techniken, auf die ich im Rahmen der Möglichkeiten der Raumkonzeption eingehen werde.
Darauf folgt die Vorstellung verschiedener Bühnenformen und deren Beitrag zur Illusionsbildung. Im Laufe der Zeit entwickelten sich in unserem europäischen Kulturkreis voneinander sehr unterschiedliche Formen des realen Raumes einer Vorführung. Sie unterscheiden sich in ihren Möglichkeiten der optischen Umsetzung des fiktiven Ortes. Anschließend möchte ich versuchen, die gewonnenen Erkenntnisse auf das Drama „le Tartuffe ou l’Imposteur“ von Molière anzuwenden. Im Anschluss darauf folgt meine Zusammenfassung meiner Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Dramatischer Raum
- 3 Möglichkeiten der Raumkonzeption
- 3.1 Neutralität
- 3.2 Stilisierung
- 3.3 Konkretisierung
- 3.4 Lokalisierungstechniken
- 3.4.1 verbale Lokalisierungstechniken
- 3.4.2 nonverbale Lokalisierungstechniken
- 4 verschiedene Bühnenformen und ihr Beitrag zur Illusionsbildung
- 4.1 antike Orchestrabühne
- 4.2 mittelalterliche Simultanbühne
- 4.3 Shakespearebühne
- 4.4 Hoftheater
- 4.5 Guckkastenbühne
- 5 Anwendung auf Le Tartuffe ou l'Imposteur von Molière
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Raumkonzeption im klassischen Theater. Das Ziel ist es, den Begriff des „dramatischen Raumes“ zu definieren und verschiedene Möglichkeiten seiner Umsetzung auf der Bühne zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion zwischen realem Bühnenraum und fiktivem Handlungsort und untersucht, wie verschiedene Raumkonzeptionen die Wahrnehmung des Zuschauers beeinflussen.
- Definition und Differenzierung des dramatischen Raumes (realer vs. fiktiver Raum)
- Analyse verschiedener Raumkonzeptionen (Neutralität, Stilisierung, Konkretisierung)
- Untersuchung des Einflusses verschiedener Bühnenformen auf die Illusionsbildung
- Anwendung der theoretischen Erkenntnisse auf Molières "Le Tartuffe ou l'Imposteur"
- Zusammenhang zwischen Raumgestaltung und Figurenbewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert das Thema der Hausarbeit – die Raumkonzeption im klassischen Theater – und definiert die zentralen Fragestellungen. Es wird die Bedeutung des Raumes als Vermittler von Informationen an den Zuschauer hervorgehoben, sowie die Rolle des Dramatikers bei der Lenkung der Zuschauerwahrnehmung. Die Arbeit kündigt die einzelnen Schritte der Analyse an: die Definition des „dramatischen Raumes“, die Untersuchung verschiedener Raumkonzeptionen, die Betrachtung unterschiedlicher Bühnenformen und schließlich die Anwendung der Erkenntnisse auf Molières "Le Tartuffe".
2 Dramatischer Raum: Dieses Kapitel definiert den zentralen Begriff „dramatischer Raum“ als das Zusammenspiel von realem Bühnenraum und fiktivem Handlungsort. Der reale Raum wird als der durch Bühnenform, Dekoration etc. bestimmte Schauplatz beschrieben, während der fiktive Ort der vom Drama vorgegebene Handlungsort ist. Das Kapitel betont das flexible Verhältnis zwischen beiden Raumkonzeptionen und wie ein leerer Bühnenraum verschiedene fiktive Orte darstellen kann, im Gegensatz zu einer vollständigen Transformation des Bühnenraums in den fiktiven Ort.
3 Möglichkeiten der Raumkonzeption: Hier werden verschiedene Grade der Raumkonzeption – Neutralität, Stilisierung und Konkretisierung – erläutert. Die unterschiedlichen Grade der Konkretisierung des Schauplatzes beeinflussen die Funktion des Raumes. Während die neutrale Raumkonzeption den Fokus auf die Figuren und ihr Bewusstsein legt, dient der Raum bei der Stilisierung als abstrakter Rahmen zur Spiegelung der Bewusstseinslage. Die Konkretisierung hingegen zielt auf die Nachahmung der Wirklichkeit ab.
4 verschiedene Bühnenformen und ihr Beitrag zur Illusionsbildung: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene historische Bühnenformen (antike Orchestrabühne, mittelalterliche Simultanbühne, Shakespearebühne, Hoftheater, Guckkastenbühne) und deren jeweilige Möglichkeiten der optischen Umsetzung des fiktiven Ortes. Der Fokus liegt auf dem Beitrag der jeweiligen Bühnenform zur Illusionsbildung und wie die unterschiedlichen Strukturen die Wahrnehmung des Zuschauers beeinflussen.
Schlüsselwörter
Dramatischer Raum, Raumkonzeption, Bühnenraum, fiktiver Ort, Neutralität, Stilisierung, Konkretisierung, Lokalisierungstechniken, Bühnenformen, Illusionsbildung, Molière, Le Tartuffe ou l'Imposteur, Zuschauerwahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Raumkonzeption im klassischen Theater
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Raumkonzeption im klassischen Theater. Sie analysiert den "dramatischen Raum" – das Zusammenspiel von realem Bühnenraum und fiktivem Handlungsort – und seine verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit definiert den Begriff des "dramatischen Raumes", analysiert verschiedene Möglichkeiten seiner Umsetzung auf der Bühne und untersucht, wie diese Raumkonzeptionen die Wahrnehmung des Zuschauers beeinflussen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interaktion zwischen realem und fiktivem Raum.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Differenzierung des dramatischen Raumes (realer vs. fiktiver Raum), Analyse verschiedener Raumkonzeptionen (Neutralität, Stilisierung, Konkretisierung), Untersuchung des Einflusses verschiedener Bühnenformen auf die Illusionsbildung, Anwendung der theoretischen Erkenntnisse auf Molières "Le Tartuffe ou l'Imposteur" und den Zusammenhang zwischen Raumgestaltung und Figurenbewusstsein.
Welche Arten der Raumkonzeption werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet drei Arten der Raumkonzeption: Neutralität (Fokus auf Figuren und Bewusstsein), Stilisierung (Raum als abstrakter Rahmen), und Konkretisierung (Nachahmung der Wirklichkeit). Diese verschiedenen Grade der Konkretisierung beeinflussen die Funktion des Raumes im Stück.
Welche Bühnenformen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene historische Bühnenformen und deren Beitrag zur Illusionsbildung: antike Orchestrabühne, mittelalterliche Simultanbühne, Shakespearebühne, Hoftheater und Guckkastenbühne. Der Fokus liegt dabei auf dem Einfluss der Bühnenform auf die Zuschauerwahrnehmung.
Wie wird die Theorie auf ein konkretes Werk angewendet?
Die theoretischen Erkenntnisse der Arbeit werden auf Molières "Le Tartuffe ou l'Imposteur" angewendet, um die Raumkonzeption in diesem Stück zu analysieren und zu interpretieren.
Was wird unter "dramatischem Raum" verstanden?
Der "dramatische Raum" ist das Zusammenspiel zwischen dem realen Bühnenraum (Bühnenform, Dekoration etc.) und dem fiktiven Handlungsort, der durch das Drama vorgegeben ist. Die Arbeit betont das flexible Verhältnis zwischen beiden und die Möglichkeit, mit einem leeren Bühnenraum verschiedene fiktive Orte darzustellen.
Welche Rolle spielen Lokalisierungstechniken?
Die Arbeit betrachtet verbale und nonverbale Lokalisierungstechniken, die dazu beitragen, den fiktiven Handlungsort für den Zuschauer zu etablieren und seine Wahrnehmung zu lenken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Dramatischer Raum, Raumkonzeption, Bühnenraum, fiktiver Ort, Neutralität, Stilisierung, Konkretisierung, Lokalisierungstechniken, Bühnenformen, Illusionsbildung, Molière, Le Tartuffe ou l'Imposteur, Zuschauerwahrnehmung.
- Quote paper
- Daniel Wimmer (Author), 2004, Die Raumkomzeption im klassischen Theater: Theorie und ihre Anwendung an Hand von Molières "Le Tartuffe ou l'Imposteur", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71176